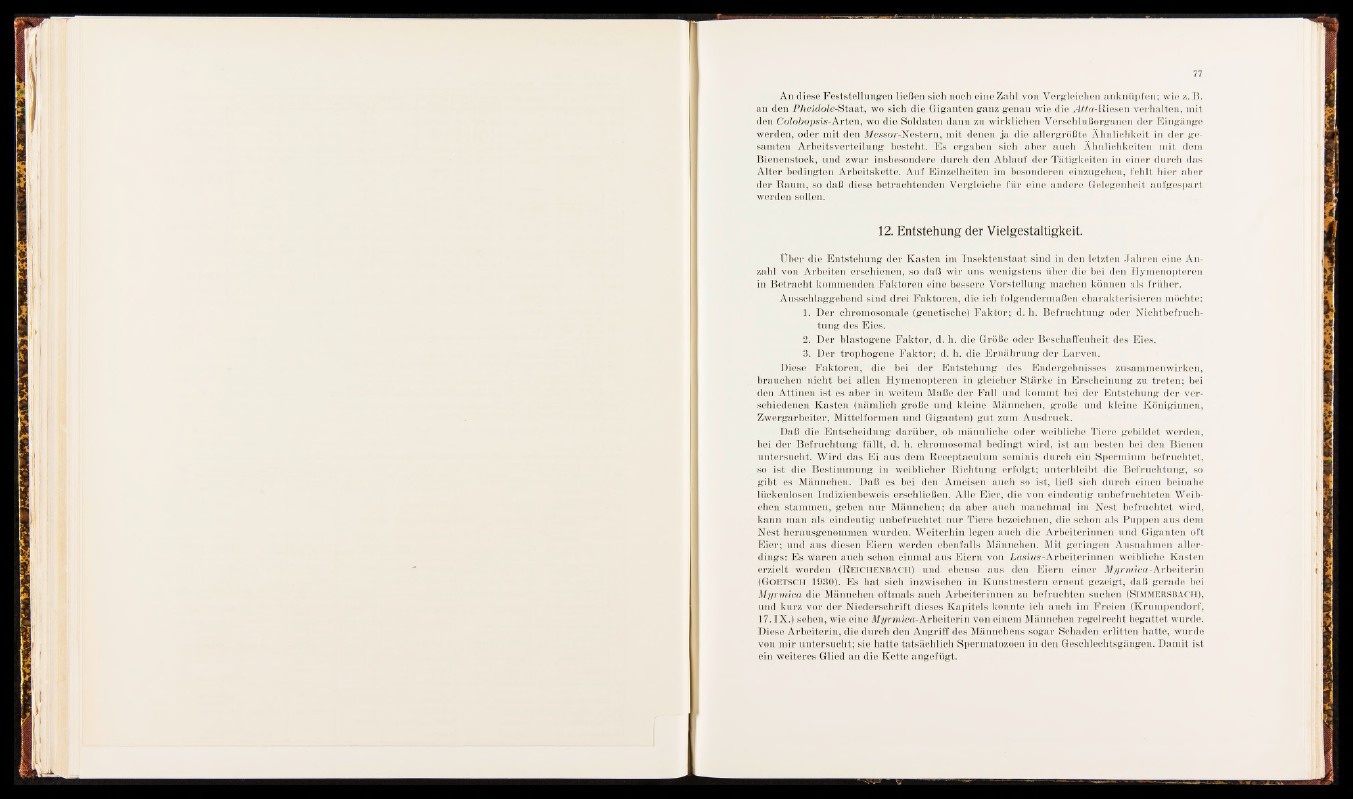
An diese Feststellungen ließen sich noch eine Zahl von Vergleichen anknüpfen; wie z. B.
an den PheidoleStasit, wo sich die Giganten ganz genau wie die ^¿¿a-Riesen verhalten, mit
den Colobopsis-Arten, wo die Soldaten dann zu wirklichen Verschlußorganen der Eingänge
werden, oder mit den Messor-Nestern, mit denen ja die allergrößte Ähnlichkeit in der gesamten
Arbeitsverteilung besteht. Es ergaben sich aber auch Ähnlichkeiten mit dem
Bienenstock, und zwar insbesondere durch den Ablauf der Tätigkeiten in einer durch das
Alter bedingten Arbeitskette. Auf Einzelheiten im besonderen einzugehen, fehlt hier aber
der Raum, so daß diese betrachtenden Vergleiche für eine andere Gelegenheit auf gespart
werden sollen.
12. Entstehung der Vielgestaltigkeit.
Über die Entstehung der Kasten im Insektenstaat sind in den letzten Jahren eine Anzahl
von Arbeiten erschienen, so daß wir uns wenigstens über die bei den Hymenopteren
in Betracht kommenden Faktoren eine bessere Vorstellung machen können als früher.
Ausschlaggebend sind drei Faktoren, die ich folgendermaßen charakterisieren möchte:
1. Der chromosomale (genetische) Faktor; d. h. Befruchtung oder Nichtbefruchtung
des Eies.
2. Der blastogene Faktor, d. h. die Größe oder Beschaffenheit des Eies.
3. Der trophogene Faktor; d. h. die Ernährung der Larven.
Diese Faktoren, die bei der Entstehung des Endergebnisses Zusammenwirken,
brauchen nicht bei allen Hymenopteren in gleicher Stärke in Erscheinung zu treten; bei
den Attinen ist es aber in weitem Maße der Fall und kommt bei der Entstehung der verschiedenen
Kasten (nämlich große und kleine Männchen, große und kleine Königinnen,
Zwergarbeiter, Mittelformen und Giganten) gut zum Ausdruck.
Daß die Entscheidung darüber, ob männliche oder weibliche Tiere gebildet werden,
bei der Befruchtung fällt, d. h. chromosomal bedingt wird, ist am besten bei den Bienen
untersucht. Wird das Ei aus dem Receptaculum seminis durch ein Spermium befruchtet,
so ist die Bestimmung in weiblicher Richtung erfolgt; unterbleibt die Befruchtung, so
gibt es Männchen. Daß es bei den Ameisen auch so ist, ließ sich durch einen beinahe
lückenlosen Indizienbeweis erschließen. Alle Eier, die von eindeutig unbefruchteten Weibchen
stammen, geben nur Männchen; da aber auch manchmal im Nest befruchtet wird,
kann man als eindeutig unbefruchtet nur Tiere bezeichnen, die schon als Puppen aus dem
Nest herausgenommen wurden. Weiterhin legen auch die Arbeiterinnen und Giganten oft
Eier; und aus diesen Eiern werden ebenfalls Männchen. Mit geringen Ausnahmen allerdings:
Es waren auch schon einmal aus Eiern von Lasius-Arbeiterinnen weibliche Kasten
erzielt worden ( R e i c h e n b a c h ) und ebenso aus den Eiern einer Myrmica-Arbeiterin
( G o e t s c h 1930). Es hat sich inzwischen in Kunstnestern erneut gezeigt, daß gerade bei
Myrmica die Männchen oftmals auch Arbeiterinnen zu befruchten suchen ( S im m e r s b a c h ) ,
und kurz vor der Niederschrift dieses Kapitels konnte ich auch im Freien (Krumpendorf,
17. IX.) sehen, wie eine Myrmica-Arbeiterin von einem Männchen regelrecht begattet wurde.
Diese A rbeiterin, die durch den Angriff des Männchens sogar Schaden erlitten hatte, wurde
von mir untersucht; sie hatte tatsächlich Spermatozoen in den Geschlechtsgängen. Damit ist
ein weiteres Glied an die Kette angefügt.