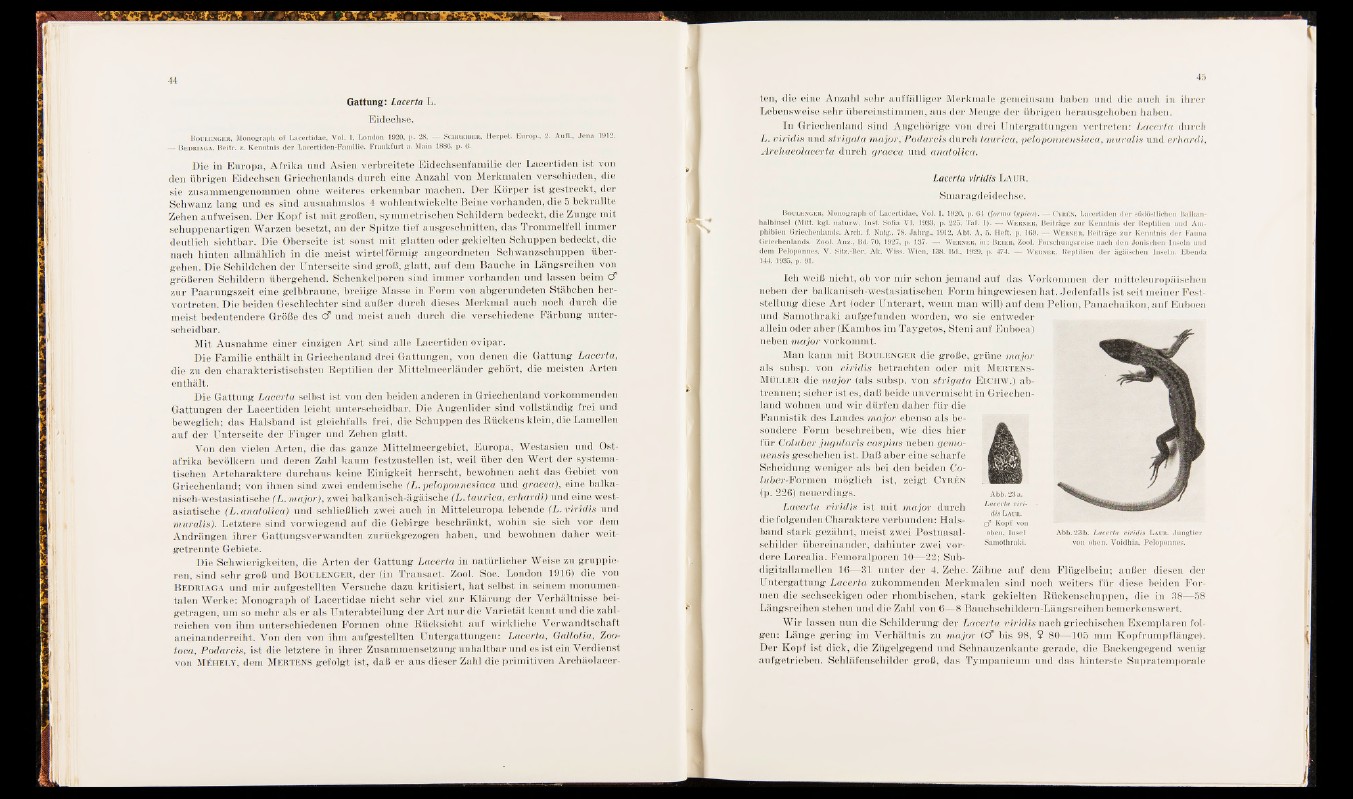
Gattung: Lacerta L.
Eidechse.
Boulenger, Monograph of Lacertidae, Vol. I, London 1920, p. 28. — Schreiber, Herpet. Europ., 2. Aufl., Jena 1912.
— Bedriaga, Beitr. z. Kenntnis der Lacertiden-Familie. Frankfurt a. Main 1886, p. 6.
Die in Europa, Afrika und Asien verbreitete Eidechsenfamilie der Lacertiden ist von
den übrigen Eidechsen Griechenlands durch eine Anzahl von Merkmalen verschieden, die
sie zusammengenommen ohne weiteres erkennbar machen. Der Körper ist gestreckt, der
Schwanz lang und es sind ausnahmslos 4 wohlentwickelte Beine vorhanden, die 5 bekrallte
Zehen auiweisen. Der Kopf ist mit großen, symmetrischen Schildern bedeckt, die Zunge mit
sehuppenartigen Warzen besetzt, an der Spitze tief ausgeschnitten, das Trommelfell immer
deutlich sichtbar. Die Oberseite ist sonst mit glatten oder gekielten Schuppen hedeekt, die
nach hinten allmählich in die meist wirtelförmig angeordneten Sehwanzschuppen übergehen.
Die Schildehen der Unterseite sind groß, glatt, auf dem Bauche in Längsreihen von
größeren Schildern übergehend. Schenkelpöfen sind immer vorhanden und lassen beim Cf
zur Paarungszeit eine gelbbraune, breiige Masse in Form von abgerundeten Stäbchen hervortreten.
Die beiden Geschlechter sind außer durch dieses Merkmal auch noch durch die
meist bedeutendere Größe des C? und meist auch durch die verschiedene Färbung unter-
scheidbar.
Mit Ausnahme einer einzigen Art sind alle Lacertiden ovipar.
Die Familie enthält in Griechenland drei Gattungen, von denen die Gattung Lacerta,
die zu den charakteristischsten Reptilien der Mittelmeerländer gehört, die meisten Arten
enthält.
Die Gattung Lacerta selbst ist von den beiden anderen in Griechenland vorkommenden
Gattungen der Lacertiden leicht unterscheidbar. Die Augenlider sind vollständig frei und
beweglich; das Halsband ist gleichfalls frei, die S c h u p p e n des Rückens klein, die Lamellen
auf der Unterseite der Finger und Zehen glatt.
Von den vielen Arten, die das ganze Mittelmeergebiet, Europa, Westasien und Ostafrika
bevölkern und deren Zahl kaum festzustellen ist, weil über den Wert der systematischen
Artcharaktere durchaus keine Einigkeit herrscht, bewohnen acht das Gebiet von
Griechenland; von ihnen sind zwei endemische (L.peloponnesiaca und graeca), eine balka-
nisch-westasiatische (L. major), zwei balkanisch-ägäische (L. taurica, erhardi) und eine westasiatische
(L. anatolica) und schließlich zwei auch in Mitteleuropa lebende (L. viridis und
muralis). Letztere sind vorwiegend auf die Gebirge beschränkt, wohin sie sich vor dem
Andrängen ihrer Gattungsverwandten zurückgezogen haben, und bewohnen daher weitgetrennte
Gebiete.
Die Schwierigkeiten, die Arten der Gattung Lacerta in natürlicher Weise zu gruppieren,
sind sehr groß und B o u l e n g e r , der (in Transact. Zool. Soc. London 1916) die von
B e d r i a g a und mir auf gestellten Versuche dazu kritisiert, ha t selbst in seinem monumentalen
Werke: Monograph of Lacertidae nicht sehr viel zur Klärung der Verhältnisse beigetragen,
um so mehr als er als Unterabteilung der A rt nur die V arietät kennt und die zahlreichen
von ihm unterschiedenen Formen ohne Rücksicht auf wirkliche Verwandtschaft
aneinanderreiht. Von den von ihm aufgestellten Untergattungen: Lacerta, Gallotia, Zoo-
toca, Podarcis, ist die letztere in ihrer Zusammensetzung unhaltbar und es ist ein Verdienst
von M e h e l y , dem M e r t e n s gefolgt ist, daß er aus dieser Zahl die primitiven Archäolacerten,
die eine Anzahl sehr auffälliger Merkmale gemeinsam haben und die auch in ihrer
Lebensweise sehr übereinstimmen, aus der Menge der übrigen herausgehoben haben.
In Griechenland sind Angehörige von drei Untergattungen vertreten: Lacerta durch
L. viridis und strigata major, Podarcis durch taurica, peloponnensiaca, muralis und erhardi,
Archaeolacerta durch graeca und anatolica.
Lacerta viridis L au r.
Smaragdeidechse.
B oulenger, Monograph of Lacertidae, Vol. I, 1920, p. 64 (forma lypicu). — Cyren, Lacertiden der südöstlichen Balkanhalbinsel
(Mitt. kgl. naturw. Inst. Sofia VI, 1933, p. 225, Taf. I). — Werner, Beiträge zur Kenntnis der Reptilien und Amphibien
Griechenlands. Arch. f. Natg., 78. Jahrg., 1912, Abt. A, 5. Heft, p. 1 6 9 .S W erner, Beiträge zur Kenntnis der Fauna
Griechenlands. Zool. Anz., B d .70, 1927, p. 137. Werner, in: Beier, Zool. Forschungsreise nach den Jonischen Inseln und
dem Peloponnes. V. Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien, 138. Bd., 1929, p. 474. — Werner, Reptilien der ägäischen Inseln. Ebenda
144, 1935, p. 91.
Ich weiß nicht, ob vor mir schon jemand auf das Vorkommen der mitteleuropäischen
neben der balkanisch-westasiatischen Form hingewiesen hat. Jedenfalls ist seit meiner Feststellung
diese Art (oder Unterart, wenn man will) auf dem Pelion, Panachaikon, auf Euboea
und Samothraki aufgefunden worden, wo sie entweder
allein oder aber (Kambos im Taygetos, Steni
neben major vorkommt.
Man kann mit B o u l e n g e r die große,
als subsp. von viridis betrachten oder m
M ü l l e r die major (als subsp. von strigata
trennen; sicher ist es, daß beide unvermischt
land wohnen und wir dürfen daher für die
Faunistik des Landes major ebenso als besondere
Form beschreiben, wie dies hier
für Coluber jugularis caspius neben gemo-
nensis geschehen ist. Daß aber eine scharfe
Scheidung weniger als bei den beiden Co-
luber-JPormen möglich ist, zeigt C y r e n
(p. 226) neuerdings.
Lacerta viridis ist mit major durch
die folgenden Charaktere verbunden: Halsband
stark gezähnt, meist zwei Postnasalschilder
übereinander, dahinter zwei vordere
Lorealia. Femoralporen 10—22; Subdigitallamellen
16—31 unter der 4. Zehe. Zähne auf dem Flügelbein; außer diesen der
Untergattung Lacerta zukommenden Merkmalen sind noch weiters für diese beiden Formen
die sechseckigen oder rhombischen, stark gekielten Rückenschuppen, die in 38—58
Längsreihen stehen und die Zahl von 6—8 Bauchschildern-Längsreihen bemerkenswert.
Wir lassen nun die Schilderung der Lacerta viridis nach griechischen Exemplaren folgen:
Länge gering im Verhältnis zu major (cf bis 98, 2 80—105 mm Kopf rümpf länge).
Der Kopf ist dick, die Zügelgegend und Schnauzenkante gerade, die Backengegend wenig
aufgetrieben. Schläfenschilder groß, das Tympanicum und das hinterste Supratemporale
I