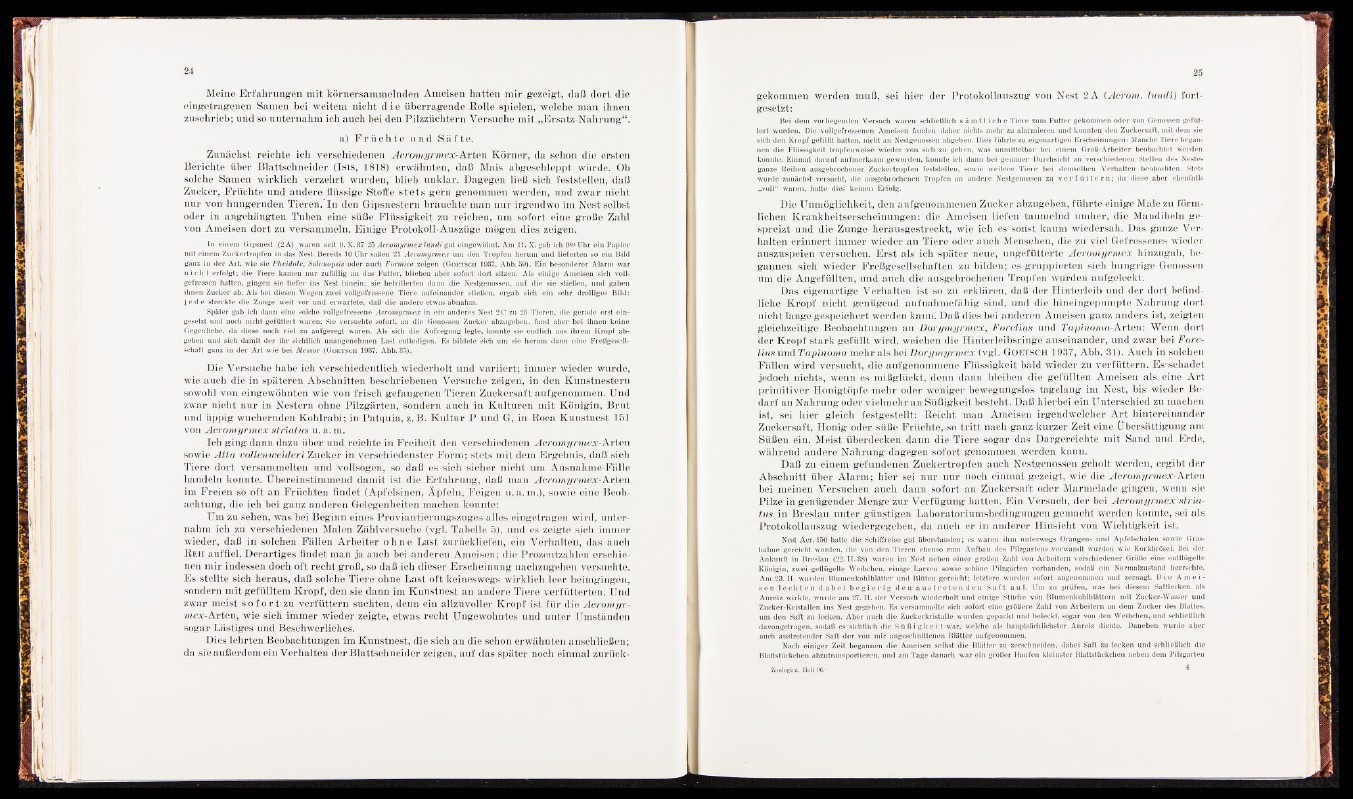
Meine Erfahrungen mit körnersammelnden Ameisen hatten mir gezeigt, daß dort die
eingetragenen Samen bei weitem nicht d i e überragende Rolle spielen, welche man ihnen
zuschrieb; und so unternahm ich auch bei den Pilzzüchtern Versuche mit „Ersatz-Nahrung“.
a) F r ü c h t e u n d Sä f t e .
Zunächst reichte ich verschiedenen Acromyrmex-Arten Körner, da schon die ersten
Berichte über Blattschneider (Isis, 1818) erwähnten, daß Mais abgeschleppt würde. Ob
solche Samen wirklich verzehrt wurden, blieb unklar. Dagegen ließ sich feststellen, daß
Zucker, Früchte und andere flüssige Stoffe st et s gern genommen werden, und zwar nicht
nur von hungernden Tieren. In den Gipsnestern brauchte man nur irgendwo im Nest selbst
oder in angehängten Tuben eine süße Flüssigkeit zu reichen, um sofort eine große Zahl
von Ameisen dort zu versammeln. Einige Protokoll-Auszüge mögen dies zeigen.
In einem Gipsnest (2 A) waren seit 9. X. 37 25 Acromyrmex lundi gut eingewöhnt. Am 11. X. gab ich 950 Uhr ein Papier
mit einem Zuckertropfen in das Nest. Bereits 10 Uhr saßen 21 Acromyrmex um den Tropfen herum und lieferten so ein Bild
ganz in der Art, wie sie Pheidole, Solenopsis oder auch Formica zeigen (G o e t sch 1937, Abb. 59). Ein besonderer Alarm war
n i c h t erfolgt; die Tiere kamen nur zufällig an das Futter, blieben aber sofort dort sitzen. Als einige Ameisen sich vollgefressen
hatten, gingen sie tiefer ins Nest hinein; sie betrillerten dann die Nestgenossen, auf die sie stießen, und gaben
ihnen Zucker ab. Als bei diesen Wegen zwei vollgefressene Tiere aufeinander stießen, ergab sich ein sehr drolliges Bild:
j e d e streckte die Zunge weit vor und erwartete, daß die andere etwas abnahm.
Später gab ich dann eine solche vollgefressene Acromyrmex in ein anderes Nest 2 C zu 25 Tieren, die gerade erst eingesetzt
und noch nicht gefüttert waren. Sie versuchte sofort, an die Genossen Zucker abzugeben, fand aber bei ihnen keine
Gegenliebe, da diese noch viel zu aufgeregt waren. Als sich die Aufregung legte, konnte sie endlich aus ihrem Kropf abgeben
und sich damit der ihr sichtlich unangenehmen Last entledigen. Es bildete sich um sie herum dann eine Freßgesell-
schaft ganz in der Art wie bei Messor (Goetsch 1937, Abb. 35).
Die Versuche habe ich verschiedentlich wiederholt und variiert; immer wieder wurde,
wie auch die in späteren Abschnitten beschriebenen Versuche zeigen, in den Kunstnestern
sowohl von eingewöhnten wie von frisch gefangenen Tieren Zuckersaft aufgenommen. Und
zwar nicht nur in Nestern ohne Pilzgärten, sondern auch in Kulturen mit Königin, Brut
und üppig wuchernden Kohlrabi; in Patquia, z.B. Kultur P und G, in Roca Kunstnest 151
von Acromyrmex striatus u. a. m.
Ich ging dann dazu über und reichte in F reiheit den verschiedenen Acromyrmex-Arten
sowie A tta vollenweideri Zucker in verschiedenster Form; stets mit dem Ergebnis, daß sich
Tiere dort versammelten und vollsogen, so daß es sich sicher nicht um Ausnahme-Fälle
handeln konnte. Übereinstimmend damit ist die Erfahrung, daß man Acromyrmex-Arten
im Freien so oft an Früchten findet (Apfelsinen, Äpfeln, Feigen u.a.m.), sowie eine Beobachtung,
die ich bei ganz anderen Gelegenheiten machen konnte:
Um zu sehen, was bei Beginn eines Proviantierungszuges alles eingetragen wird, unternahm
ich zu verschiedenen Malen Zählversuche (vgl. Tabelle 5), und es zeigte sich immer
wieder, daß in solchen Fällen Arbeiter o h n e Last zurüekliefen, ein Verhalten, das auch
Reh auf fiel. Derartiges findet m an ja auch bei anderen Ameisen; die Prozentzahlen erschienen
mir indessen doch oft recht groß, so daß ich dieser Erscheinung nachzugehen versuchte.
Es stellte sich heraus, daß solche Tiere ohne Last oft keineswegs wirklich leer heimgingen,
sondern mit gefülltem Kropf, den sie dann im Kunstnest an andere Tiere verfütterten. Und
zwar meist s o f o r t zu verfüttern suchten, denn ein allzuvoller Kropf ist für die Acromyr-
mex-Arten, wie sich immer wieder zeigte, etwas recht Ungewohntes und unter Umständen
sogar Lästiges und Beschwerliches.
Dies lehrten Beobachtungen im Kunstnest, die sich an die schon erwähnten anschließen;
da sie außerdem ein Verhalten der Blattschneider zeigen, auf das später noch einmal zurück!
!) I
gekommen werden muß, sei hier der Protokollauszug von Nest 2A (Acrom. lundi) fortgesetzt:
Bei dem vorliegenden Versuch waren schließlich s ä m t l i c h e Tiere zum Futter gekommen oder von Genossen gefüttert
worden. Die vollgefressenen Ameisen fanden daher nichts mehr zu alarmieren und konnten den Zuckersaft, mit dem sie
sich den Kropf gefüllt hatten, nicht an Nestgenossen abgeben. Dies führte zu eigenartigen Erscheinungen: Manche T iere begannen
die Flüssigkeit tropfenweise wieder von sich zu geben, was unmittelbar bei einem Groß-Arbeiter beobachtet werden
konnte. Einmal darauf aufmerksam geworden, konnte ich dann bei genauer Durchsicht an verschiedenen Stellen des Nestes
ganze Reihen ausgebrochener Zuckertropfen feststellen, sowie weitere Tiere bei demselben Verhalten beobachten. Stets
wurde zunächst versucht, die ausgebrochenen Tropfen an andere Nestgenossen zu v e r f ii 11 e r n; da diese aber ebenfalls
„voll“ waren, hatte dies keinen Erfolg.
Die Unmöglichkeit, den aufgenommenen Zucker abzugeben, führte einige Male zu förmlichen
Krankheitserscheinungen: die Ameisen liefen taumelnd umher, die Mandibeln gespreizt
und die Zunge herausgestreckt, wie ich es sonst kaum wiedersah. Das ganze Verhalten
erinnert immer wieder an Tiere oder auch Menschen, die zu viel Gefressenes wieder
auszuspeien versuchen. Erst als ich später neue, ungefütterte Acromyrmex hinzugab, begannen
sich wieder Freßgesellschaften zu bilden; es gruppierten sich hungrige Genossen
um die Angefüllten, und auch die ausgebrochenen Tropfen wurden aufgeleckt.
Das eigenartige Verhalten ist so zu erklären, daß der Hinterleib und der dort befindliche
Kropf nicht genügend aufnahmefähig sind, und die hineingepumpte Nahrung dort
nicht lange gespeichert werden kann. Daß dies bei anderen Ameisen ganz anders ist, zeigten
gleichzeitige Beobachtungen an Dorymyrmex, Forelius und Tapinoma-Arten: Wenn dort
der Kropf stark gefüllt wird, weichen die Hinterleibsringe auseinander, und zwar bei Forelius
und Tapinoma mehr als bei Dorymyrmex (vgl. Goetsch 1937, Abb. 31). Auch in solchen
Fällen wird versucht, die aufgenommene Flüssigkeit bald wieder zu verfüttern. Es1 schadet
jedoch nichts, wenn es mißglückt, denn dann bleiben die gefüllten Ameisen als eine Art
primitiver Honigtöpfe mehr oder weniger bewegungslos tagelang im Nest, bis wieder Bedarf
an Nahrung oder vielmehr an Süßigkeit besteht. Daß hierbei ein Unterschied zu machen
ist, sei hier gleich festgestellt: Reicht man Ameisen irgendwelcher Art hintereinander
Zuckersaft, Honig oder süße Früchte, so tritt nach ganz kurzer Zeit eine Übersä ttigung am
Süßen ein. Meist überdecken dann die Tiere sogar das Dargereichte mit Sand und Erde,
während andere Nahrung dagegen sofort genommen werden kann.
Daß zu einem gefundenen Zuck er tropfen auch Nestgenossen geholt werden, ergibt der
Abschnitt über Alarm; hier sei nur nur noch einmal gezeigt, wie die Acromyrmex-Arten
bei meinen Versuchen auch dann sofort an Zuckersaft oder Marmelade gingen, wenn sie
Pilze in genügender Menge zur Verfügung hatten. Ein Versuch, der bei Acromyrmex striatus
in Breslau unter günstigen Laboratoriumsbedingungen gemacht werden konnte, sei als
Protokollauszug wiedergegeben, da auch er in anderer Hinsicht von Wichtigkeit ist.
Nest Acr. 150 hatte die Schiffreise gut überstanden; es waren ihm unterwegs Orangen- und Apfelschalen sowie Grashalme
gereicht worden, die von den Tieren ebenso zum Aufbau des Pilzgartens verwandt wurden w ie Korkbrösel. Bei der
Ankunft in Breslau (22. II. 38) waren im Nest neben einer großen Zahl von Arbeitern verschiedener Größe eine entflügelte
Königin, zwei geflügelte Weibchen, einige Larven sowie schöne Pilzgärten vorhanden, sodaß ein Normalzustand herrschte.
Am 23.11. wurden Blumenkohlblätter und Blüten gereicht; letztere wurden sofort angenommen und zernagt. D i e A m e i s
e n l e c k t e n d a b e i b e g i e r i g d e n a u s t r e t e n d e n S a f t a u f . Um zu prüfen, was bei diesem Saftlecken als
Anreiz wirkte, wurde am 27. II. der Versuch wiederholt und einige Stücke von Blumenkohlblättern mit Zucker-Wasser und
Zuclcer-Kristallen ins Nest .gegeben. Es versammelte sich sofort eine größere Zahl von Arbeitern an dem Zucker des Blattes,
um den Saft zu lecken. Aber auch die Zuckerkristalle wurden gepackt und beleckt, sogar von den Weibchen, und schließlich
davongetragen, sodaß es sichtlich die S ü ß i g k e i t war, welche als hauptsächlichster Anreiz diente. Daneben wurde aber
auch austretender Saft der von mir angeschnittenen Blätter aufgenommen.
Nach einiger Zeit begannen die Ameisen selbst die Blätter zu zerschneiden, dabei Saft zu lecken und schließlich die
Blattstückchen abzutransportieren, und am Tage danach war ein großer Haufen kleinster Blattstückchen neben dem Pilzgarten