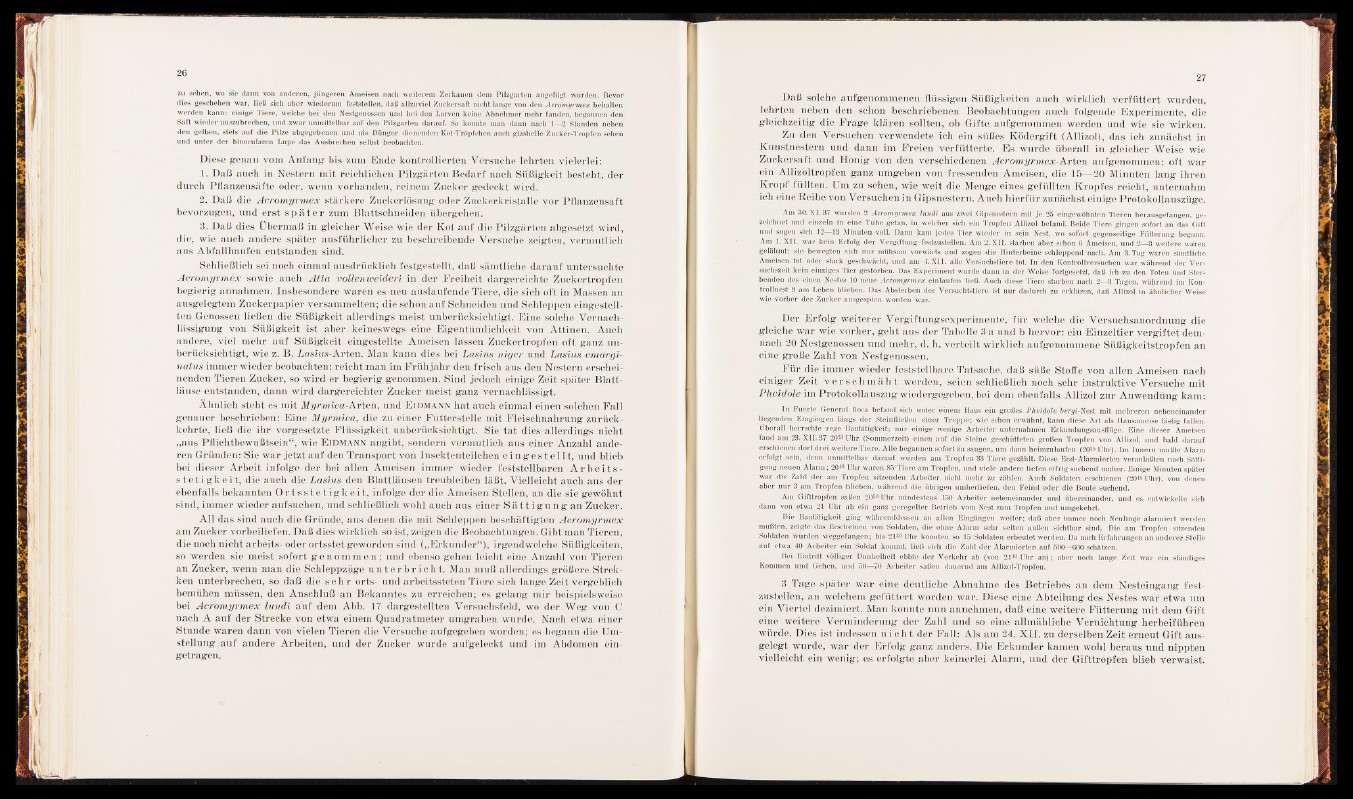
zu sehen, wo sie dann von anderen, jüngeren Ameisen nach weiterem Zerkauen dem Pilzgarteii arigefügt wurden. Bevoi
dies geschehen war, ließ sich aber wiederum feststellen, daß allzuviel Zuckersaft nicht lange von den Acromyrmex behalten
werden kann: einige Tiere, welche bei den Nestgenossen und bei den Larven keine Abnehmer mehr fanden, begannen den
Saft wieder auszubrechen, und zwar unmittelbar auf den Pilzgarten darauf. So konnte man dann nach 1—2 Stunden neben
den gelben, stets auf die Pilze abgegebenen und als Dünger dienenden Kot-Tröpfchen auch glashelle Zucker-Tropfen sehen
und unter der binocularen Lupe das Ausbrechen selbst beobachten.
Diese genau vom Anfang bis zum Ende kontrollierten Versuche lehrten vielerlei:
1. Daß auch in Nestern mit reichlichen Pilzgärten Bedarf nach Süßigkeit besteht, der
durch Pflanzensäfte oder, wenn vorhanden, reinem Zucker gedeckt wird.
2. Daß die Acromyrmex stärkere Zuckerlösung oder Zuckerkristalle vor Pflanzensaft
bevorzugen, und erst s p ä t e r zum Blattschneiden übergehen.
3. Daß dies Übermaß in gleicher Weise wie der Kot auf die Pilzgärten abgesetzt wird,
die, wie auch andere später ausführlicher zu beschreibende Versuche zeigten, vermutlich
aus Abfallhaufen entstanden sind.
Schließlich sei noch einmal ausdrücklich festgestellt, daß sämtliche darauf untersuchte
Acromyrmex sowie auch A tta vollenweideri in der Freiheit dargereichte Zuckertropfen
begierig annahmen. Insbesondere waren es neu auslaufende Tiere, die sich oft in Massen an
ausgelegtem Zuckerpapier versammelten; die schon auf Schneiden und Schleppen eingestellten
Genossen ließen die Süßigkeit allerdings meist unberücksichtigt. Eine solche Vernachlässigung
von Süßigkeit ist aber keineswegs eine Eigentümlichkeit von Attinen. Auch
andere, viel mehr auf Süßigkeit eingestellte Ameisen lassen Zuckertropfen oft ganz unberücksichtigt,
wie z. B. Lasius-Arten. Man kann dies bei Lasius niger und Lasius emargi-
natus immer wieder beobachten: reicht man im F rü h jah r den frisch aus den Nestern erscheinenden
Tieren Zucker, so wird er begierig genommen. Sind jedoch einige Zeit später Blattläuse
entstanden, dann wird dargereichter Zucker meist ganz vernachlässigt.
Ähnlich steht es mit Myrmica-Arten, und E idmann hat auch einmal einen solchen Fall
genauer beschrieben: Eine Myrmica, die zu einer Futterstelle mit Fleischnahrung zurückkehrte,
ließ die ihr Vorgesetzte Flüssigkeit unberücksichtigt. Sie ta t dies allerdings nicht
„aus Pflichtbewußtsein“, wie E idmann angibt, sondern vermutlich aus einer Anzahl anderen
Gründen: Sie war jetzt auf den Transport von Insektenteilchen e i n g e s t e l l t , und blieb
bei dieser Arbeit infolge der bei allen Ameisen immer wieder feststellbaren A r b e i t s s
t e t i g k e i t , die auch die Lasius den Blattläusen treubleiben läßt. Vielleicht auch aus der
ebenfalls bekannten Or t s s t e t i g k e i t , infolge der die Ameisen Stellen, an die sie gewöhnt
sind, immer wieder aufsuchen, und schließlich wohl auch aus einer S ä t t i g u n g a n Zucker.
All das sind auch die Gründe, aus denen die mit Schleppen beschäftigten Acromyrmex
am Zucker vorbeiliefen. Daß dies wirklich so ist, zeigen die Beobachtungen. Gibt man Tieren,
die noch nicht arbeits-oder ortsstet geworden sind („Erkunder“), irgendwelche Süßigkeiten,
so werden sie meist sofort g e n omme n ; und ebenso gehen leicht eine Anzahl von Tieren
an Zucker, wenn man die Schleppzüge u n t e r b r i c h t . Man muß allerdings größere Strek-
ken unterbrechen, so daß die s e h r orts- und arbeitssteten Tiere sich lange Zeit vergeblich
bemühen müssen, den Anschluß an Bekanntes zu erreichen; es gelang mir beispielsweise
bei Acromyrmex lundi auf dem Abb. 17 dargestellten Versuchsfeld, wo der Weg von C
nach A auf der Strecke von etwa einem Quadratmeter umgraben wurde. Nach etwa einer
Stunde waren dann von vielen Tieren die Versuche aufgegeben worden; es begann die Umstellung
auf andere Arbeiten, und der Zucker wurde auf geleckt und im Abdomen eingetragen.
Daß solche auf genommenen flüssigen Süßigkeiten auch wirklich verfüttert wurden,
lehrten neben den schon beschriebenen Beobachtungen auch folgende Experimente, die
gleichzeitig die Frage klären sollten, ob Gifte auf genommen werden und wie sie wirken.
Zu den Versuchen verwendete ich ein süßes Ködergift (Allizol), das ich zunächst in
Kunstnestern und dann im Freien verfütterte. Es wurde überall in gleicher Weise wie
Zuckersaft und Honig von den verschiedenen Acromyrmex- Arten auf genommen; oft war
ein Allizoltropfen ganz umgeben von fressenden Ameisen, die 15—20 Minuten lang ihren
Kropf füllten. Um zu sehen, wie weit die Menge eines gefüllten Kropfes reicht, unternahm
ich eine Reihe von Versuchen in Gipsnestern. Auch hierfür zunächst einige Protokollauszüge.
Am 30. XI. 37 wurden 2 Acromyrmex lundi aus zwei Gipsnestern mit je 25 eingewöhnten Tieren herausgefangen, gezeichnet
und einzeln in eine Tube getan, in welcher sich ein Tropfen Allizol befand. Beide Tiere gingen sofort an das Gift
und sogen sich 12—13 Minuten voll. Dann kam jedes Tier wieder in sein Nest, wo sofort gegenseitige Fütterung begann.
Am 1. XII. war kein Erfolg der Vergiftung festzustellen. Am 2. XII. starben aber schon 6 Ameisen, und 2—3 weitere waren
gelähmt: sie bewegten sich nur mühsam vorwärts und zogen die Hinterbeine schleppend nach. Am 3. Tag waren sämtliche
Ameisen tot oder stark geschwächt, und am 4. XII. alle Versuchstiere tot. In den Kontrollversuchen war während der Versuchszeit
kein einziges Tier gestorben. Das Experiment wurde dann in der Weise fortgesetzt, daß ich zu den Toten und Sterbenden
des einen Nestes 10 neue Acromyrmex einlaufen ließ. Auch diese Tiere starben nach 2—3 Tagen, während im Kon-
trollnest 9 am Leben blieben. Das Absterben der Versuchtstiere ist nur dadurch zu erklären, daß Allizol in ähnlicher Weise
wie vorher der Zucker ausgespien worden war.
Der Erfolg weiterer Vergiftungsexperimente, für welche die Versuchsanordnung die
gleiche war wie vorher, geht aus der Tabelle 3 a und b hervor: ein Einzeltier vergiftet demnach
20 Nestgenossen und mehr, d. h. verteilt wirklich aufgenommene Süßigkeitstropfen an
eine große Zahl von Nestgenossen.
Fü r die immer wieder feststellbare Tatsache, daß süße Stoffe von allen Ameisen nach
einiger Zeit v e r s c hm ä h t werden, seien schließlich noch sehr instruktive Versuche mit
Pheidole im Protokollauszug wiedergegeben, bei dem ebenfalls Allizol zur Anwendung kam:
In Fuerte General Roca befand sich unter einem Haus ein großes Pheidole bergi-Nest mit mehreren nebeneinander
liegenden Eingängen längs der Steinfließen einer Treppe; wie schon erwähnt, kann diese Art als Hausameise lästig fallen.
Überall herrschte rege Bautätigkeit; nur einige wenige Arbeiter unternahmen Erkundungsausflüge. Eine dieser Ameisen
fand am 23. XII. 37 2033 Uhr (Sommerzeit) einen auf die Steine geschütteten großen Tropfen von Allizol, und bald darauf
erschienen dort drei weitere Tiere. Alle begannen sofort zu saugen, um dann heimzulaufen (2035 Uhr). Im Innern mußte Alarm
erfolgt sein, denn unmittelbar darauf wurden am Tropfen 33 Tiere gezählt. Diese Erst-Alarmierten veranlaßten nach Sättigung
neuen Alarm; 2040 Uhr waren 85 Tiere am Tropfen, und viele andere liefen eifrig suchend umher. Einige Minuten später
war die Zahl der am Tropfen sitzenden Arbeiter nicht mehr zu zählen. Auch Soldaten erschienen (20^5 Uhr), von denen
aber nur 3 am Tropfen blieben, während die übrigen umherliefen, den Feind oder die Beute suchend.
Am Gifttropfen saßen 2050 Uhr mindestens 150 Arbeiter nebeneinander und übereinander, und es entwickelte sich
dann von etwa 21 Uhr ab ein ganz geregelter Betrieb vom Nest zum Tropfen und umgekehrt.
Die Bautätigkeit ging währenddessen an allen Eingängen weiter; daß aber immer noch Neulinge alarmiert werden
mußten, zeigte das Erscheinen von Soldaten, die ohne Alarm sehr selten außen sichtbar sind. Die am Tropfen sitzenden
Soldaten wurden weggefangen; bis 2130 Uhr konnten so 15 Soldaten erbeutet werden. Da nach Erfahrungen an anderer Stelle
auf etwa 40 Arbeiter ein Soldat kommt, ließ sich die Zahl der Alarmierten auf 500—600 schätzen.
Bei Eintritt völliger Dunkelheit ebbte der Verkehr ab (von 2130 Uhr an); aber noch lange Zeit war ein ständiges
Kommen und Gehen, und 50—70 Arbeiter saßen dauernd am Allizol-Tropfen.
3 Tage später war eine deutliche Abnahme des Betriebes an dem Nesteingang festzustellen,
an welchem gefüttert worden war. Diese eine Abteilung des Nestes war etwa um
ein Viertel dezimiert. Man konnte nun annehmen, daß eine weitere Fütterung mit.dem Gift
eine weitere Verminderung der Zahl und so eine allmähliche Vernichtung herbeiführen
würde. Dies ist indessen n i c h t der Fall: Als am 24. XII. zu derselben Zeit erneut Gift ausgelegt
wurde, war der Erfolg ganz anders. Die Erkunder kamen wohl heraus und nippten
vielleicht ein wenig; es erfolgte aber keinerlei Alarm, und der Gifttropfen blieb verwaist.