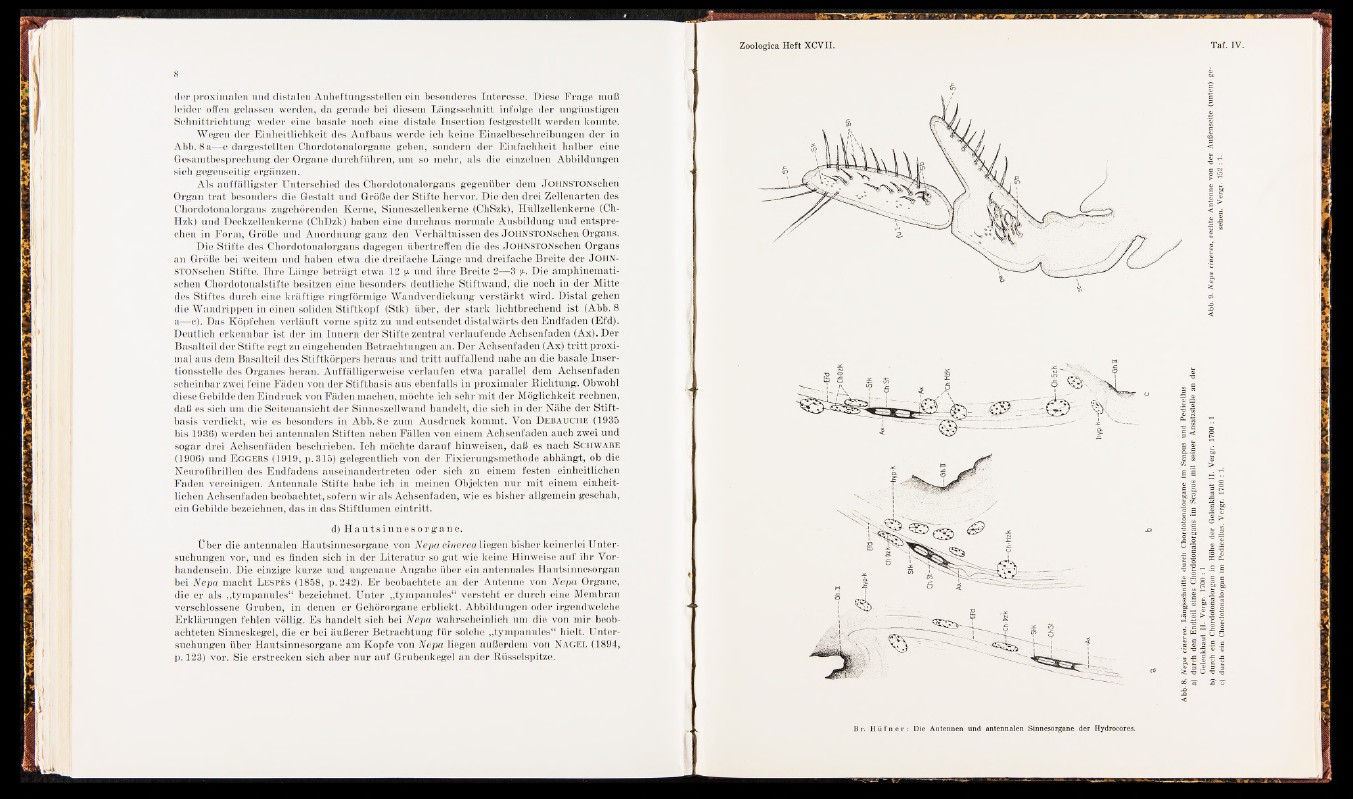
der proximalen lind distalen Anheftungsstellen ein besonderes Interesse. Diese Frage muß
leider offen gelassen werden, da gerade bei diesem Längsschnitt infolge der ungünstigen
Schnittrichtung weder eine basale noch eine distale Insertion festgestellt werden konnte.
Wegen der Einheitlichkeit des Aufbaus werde ich keine Einzelbeschreibungen der in
Abb. 8 a—c dargestellten Chordotonalorgane geben, sondern der Einfachheit halber eine
Gesamtbesprechung der Organe durchführen, um so mehr, als die einzelnen Abbildungen
sich gegenseitig ergänzen.
Als auffälligster Unterschied des Chordotonalorgans gegenüber dem JOHNSTONschen
Organ tra t besonders die Gestalt und Größe der Stifte hervor. Die den drei Zellenarten des
Chordotonalorgans zugehörenden Kerne, Sinneszellenkerne (ChSzk), Hüllzellenkerne (Ch-
Hzk) und Deckzellenkerne (ChDzk) haben eine durchaus normale Ausbildung und entsprechen
in Form, Größe und Anordnung ganz den Verhältnissen des JOHNSTONschen Organs.
Die Stifte des Chordotonalorgans dagegen über treffen die des JOHNSTONschen Organs
an Größe bei weitem und haben etwa die dreifache Länge und dreifache Breite der JOHNSTONschen
Stifte. Ihre Länge beträgt etwa 12 ^ und ihre Breite 2—3 [a. Die amphinemati-
schen Chordotonalstifte besitzen eine besonders deutliche Stiftwand, die noch in der Mitte
des Stiftes durch eine kräftige ringförmige Wandverdickung verstärkt wird. Distal gehen
die Wandrippen in einen soliden Stiftkopf (Stk) über, der stark lichtbrechend ist (Abb. 8
a—c). Das Köpfchen verläuft vorne spitz zu und entsendet distalwärts den Endfaden (Efd).
Deutlich erkennbar ist der im Innern der Stifte zentral verlaufende Achsenfaden (Ax). Der
Basalteil der Stifte regt zu eingehenden Betrachtungen an. Der Achsenfaden (Ax) tritt proximal
aus dem Basalteil des S tiftkörpers heraus und tritt auffallend nahe an die basale Insertionsstelle
des Organes heran. Auffälligerweise verlaufen etwa parallel dem Achsenfaden
scheinbar zwei feine Fäden von der Stiftbasis aus ebenfalls in proximaler Richtung. Obwohl
diese Gebilde den Eindruck von Fäden machen, möchte ich sehr mit der Möglichkeit rechnen,
daß es sich um die Seitenansicht der Sinneszellwand handelt, die sich in der Nähe der Stiftbasis
verdickt, wie es besonders in Abb. 8 c zum Ausdruck kommt. Von Debauche (1935
bis 1936) werden bei antennalen Stiften neben Fällen von einem Achsenfaden auch zwei und
sogar drei Achsenfäden beschrieben. Ich möchte darauf hinweisen, daß es nach Schwabe
(1906) und E ggers (1919, p. 315) gelegentlich von der Fixierungsmethode abhängt, ob die
Neurofibrillen des Endfadens auseinandertreten oder sich zu einem festen einheitlichen
Faden vereinigen. Antennale Stifte habe ich in meinen Objekten nur mit einem einheitlichen
Achsenfaden beobachtet, sofern wir als Achsenfaden, wie es bisher allgemein geschah,
ein Gebilde bezeichnen, das in das Stiftlumen eintritt.
d) H a u t s i n n e s o r g a n e .
Über die antennalen Hautsinnesorgane von Nepa ein erea liegen bisher keinerlei Untersuchungen
vor, und es finden sich in der Literatur so gut wie keine Hinweise auf ihr Vorhandensein.
Die einzige kurze und ungenaue Angabe über ein antennales Hautsinnesorgan
bei Nepa macht Lespes (1858, p. 242). E r beobachtete an der Antenne von Nepa Organe,
die er als „tympanules“ bezeichnet. Unter „tympanules“ versteht er durch eine Membran
verschlossene Gruben, in denen er Gehörorgane erblickt. Abbildungen oder irgendwelche
Erklärungen fehlen völlig. Es handelt sich bei Nepa wahrscheinlich um die von mir beobachteten
Sinneskegel, die er bei äußerer Betrachtung für solche „tympanules“ hielt. Untersuchungen
über Hautsinnesorgane am Kopfe von Nepa liegen außerdem von Nagel (1894,
p. 123) vor. Sie erstrecken sich aber nur auf Grubenkegel an der Rüsselspitze.
B
I■
I
05
N
11
■ i