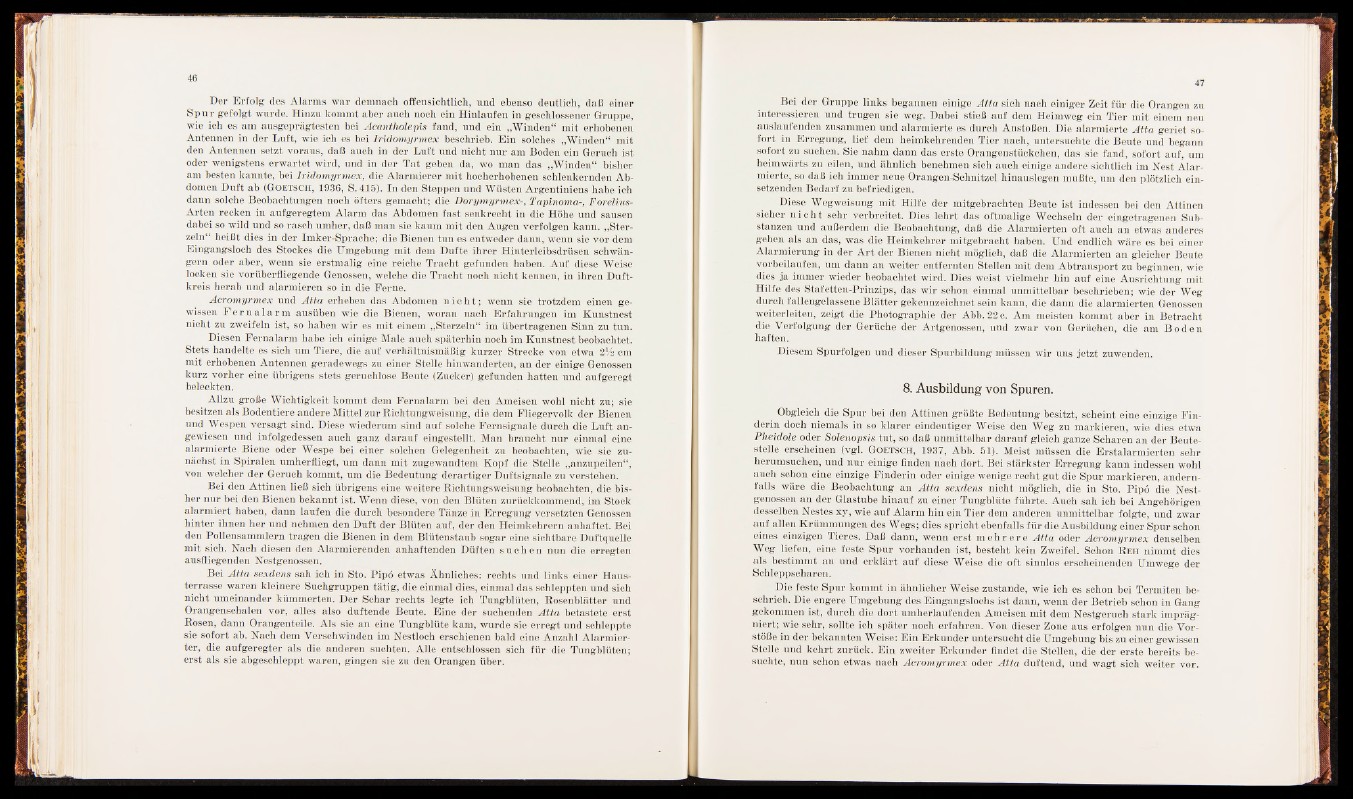
Der Erfolg des Alarms war demnach offensichtlich, und ebenso deutlich, daß einer
Spur gefolgt wurde. Hinzu kommt aber auch noch ein Hinlaufen in geschlossener Gruppe,
wie ich es am ausgeprägtesten bei Acantholepis fand, und ein „Winden“ mit erhobenen
Antennen in der Luft, wie ich es hei Iridömyrmex beschrieb. Ein solches „Winden“ mit
den Antennen setzt voraus, daß auch in der. L uft und nicht nu r am Boden ein Geruch ist
oder wenigstens erwartet wird, und in der Tat geben da, wo man das „Winden“ bisher
am besten kannte, bei Iridömyrmex, die Alarmierer mit hocherhobenen schlenkernden Abdomen
Duft ab (G o e t s c h , 1 9 3 6 , S. 4 1 5 ). In den Steppen und Wüsten Argentiniens habe ich
dann solche Beobachtungen noch öfters gemacht; die Dorymyrmex-, Tapinoma-, Foreliu
Arten recken in aufgeregtem Alarm das Abdomen fast senkrecht in die Höhe und sausen
dabei so wild und so rasch umher, daß man sie kaum mit den Augen verfolgen kann. „Stortelo“
heißt dies in der Imker-Sprache; die Bienen tun es entweder dann, wenn sie vor dem
Eingangsloch des Stockes die Umgebung mit dem Dufte ihrer Hinterleibsdrüsen schwängern
oder aber, wenn sie erstmalig eine reiche Tracht gefunden haben. Auf diese Weise
locken sie vorüberfliegende Genossen, welche die Tracht noch nicht kennen, in ihren Duft-
ltreis herab und alarmieren so in die Ferne.
Acromyrmex und Atta erheben das Abdomen n i c h t ; wenn sie trotzdem einen gewissen
P e r n a l a r m ausüben wie die Bienen, woran nach Erfahrungen im Kunstnest
nicht zu zweifeln ist, so haben wir es mit einem „Sterzein“ im übertragenen Sinn zu tun.
Diesen Fernalarm habe ich einige Male auch späterhin noch im K unstnest beobachtet.
Stets handelte es sich um Tiere, die auf verhältnismäßig kurzer Strecke von etwa 2% cm
mit erhobenen Antennen geradewegs zu einer Stelle hinwanderten, an der einige Genossen
kurz vorher eine übrigens stets geruchlose Beute (Zucker) gefunden hatten und aufgeregt
beleckten.
Allzu große Wichtigkeit kommt dem Fernalarm bei den Ameisen wohl nicht zu; sie
besitzen als Bodentiere andere Mittel zur Biehtungweisuhg, die dem Fliegervolk der Bienen
und Wespen versagt sind. Diese wiederum sind auf solche Fernsignale durch die Luft angewiesen
und infolgedessen auch ganz darauf eingestellt. Man braucht nu r einmal eine
alarmierte Biene oder Wespe bei einer solchen Gelegenheit zu beobachten, wie sie zunächst
in Spiralen umherfliegt, um dann mit zugewandtem Kopf die Stelle „anzupeilen“ ,
von welcher der Geruch kommt, um die Bedeutung derartiger Duftsignale zu verstehen.
Bei den Attinen ließ sieh übrigens eine weitere Kichtungsweisung beobachten, die bisher
nur bei den Bienen bekannt ist. Wenn diese, von den Blüten zurückkommend, im Stock*
alarmiert haben, dann laufen die durch besondere Tänze in Erregung versetzten Genossen
hinter ihnen her und nehmen den Duft der Blüten auf, der den Heimkehrern anhaftet. Bei
den Pollensammlern tragen die Bienen in dem Blütenstaub sogar eine sichtbare Duftquelle
mit sich. Nach diesen den Alarmierenden anhaftenden Düften s u c h e n nun die erregten
ausfliegenden Nestgenossen.
Bei A tta sexdens sah ich in Sto. Pipò etwas Ähnliches: rechts und links einer Hausterrasse
waren kleinere Sachgruppen tätig, die einmal dies, einmal das schleppten und sich
nicht umeinander kümmerten. Der Schar rechts legte ich Tungblüten, Bosenblätter und
Orangenschalen vor, alles also duftende Beute. Eine der suchenden A tta betastete erst
Bosen, dann Orangenteile. Als sie an eine Tungblüte kam, wurde sie erregt und schleppte
sie sofort ab. Nach dem Verschwinden im Nestloch erschienen bald eine Anzahl Alarmierter,
die aufgeregter als die anderen suchten. Alle entschlossen sich für die Tungblüten;
erst als sie abgeschleppt waren, gingen sie zu den Orangen über.
Bei der Gruppe links begannen einige A tta sich nach einiger Zeit für die Orangen zu
interessieren und trugen sie weg. Dabei stieß auf dem Heimweg ein Tier mit einem neu
auslaufenden zusammen und alarmierte es durch Anstoßen. Die alarmierte A tta geriet sofort
in Erregung, lief dem heimkehrenden Tier nach, untersuchte die Beute und begann
sofort zu suchen. Sie nahm dann das erste Orangenstückchen, das sie fand, sofort auf, um
heimwärts zu eilen, und ähnlich benehmen sich auch einige andere sichtlich im Nest Alarmierte,
so daß ich immer neue Orangen-Schnitzel hinauslegen mußte, um den plötzlich einsetzenden
Bedarf zu befriedigen.
Diese Wegweisung mit Hilfe der mitgebraehten Beute ist indessen bei den Attinen
sicher n i c h t sehr verbreitet. Dies, leh rt das oftmalige Wechseln der eingetragenen Substanzen
und außerdem die Beobachtung, daß die Alarmierten oft auch an etwas anderes
gehen als an das, was die Heimkehrer mitgebracht haben. Und endlich wäre es bei einer
Alarmierung in der Art der Bienen nicht möglich, daß die Alarmierten an gleicher Beute
vorbeilaufen, um dann an weiter entfernten Stellen mit dem Abtransport zu beginnen, wie
dies ja immer wieder beobachtet wird. Dies weist vielmehr hin auf eine Ausrichtung mit
Hilfe des Stafetten-Prinzips, das wir Schon einmal unmittelbar beschrieben; wie der Weg
durch fallengelassene B lätter gekennzeichnet sein kann, die dann die alarmierten Genossen
weiterleiten, zeigt die Photographie der Ahbf22e. Am meisten kommt aber in Betracht
die Verfolgung der Gerüche der Artgenossen, und zwar von Gerüchen, die am B o de n
haften.
Diesem Spurfolgen und dieser Spurbildung müssen wir uns jetzt zuwenden.
8. Ausbildung von Spuren.
Obgleich die Spur bei den Attinen größte Bedeutung besitzt, scheint eine einzige Finderin
doch niemals in so klarer eindeutiger Weise den Weg zu markieren, wie dies etwa
Pheidole oder Solenopsis tut, so daß unmittelbar darauf gleich ganze Scharen an der Beutestelle
erscheinen (vgl. G o e t s c h , 1 9 3 7 , Abb. 5 1 ). Meist müssen die Erstalarmierten sehr
herumsuehen, und nur einige finden nach dort. Bei Stärkster Erregung kann indessen wohl
auch schon eine einzige Finderin oder einige wenige recht gut die Spur markieren, andernfalls
wäre die Beobachtung an A tta sexdens nicht möglich, die in Sto. Pipó die Nestgenossen
an der Glastube hinauf zu einer Tungblüte führte. Auch sah ich bei Angehörigen
desselben Nestes xy, wie auf A larm hin ein Tier dem anderen unmittelbar folgte, und zwar
auf allen Krümmungen des Wegs; dies spricht ebenfalls fü r die Ausbildung einer Spur schon
eines einzigen Tieres. Daß dann, wenn erst me h r e r e A tta oder Acromyrmex denselben
Weg liefen, eine feste Spur vorhanden ist, besteht kein Zweifel. Schon B e h nimmt dies
als bestimmt an und erklärt auf diese Weise die oft sinnlos erscheinenden Umwege der
Schleppscharen.
Die feste Spur kommt in ähnlicher Weise zustande, wie ich es schon bei Termiten beschrieb.
Die engere Umgebung des Eingangslochs ist dann, wenn der Betrieb schon in Gang
gekommen ist, durch die dort umherlaufenden Ameisen mit dem Nestgeruch stark imprägniert;
wie sehr, sollte ich später noch erfahren. Von dieser Zone aus erfolgen nun die Vorstöße
in der bekannten Weise: Ein E rkunder untersucht die Umgebung bis zu einer gewissen
Stelle und kehrt zurück. Ein zweiter Erkunder findet die Stellen, die der erste bereits besuchte,
nun schon etwas nach Acromyrmex oder A tta duftend, und wagt sieh weiter vor.