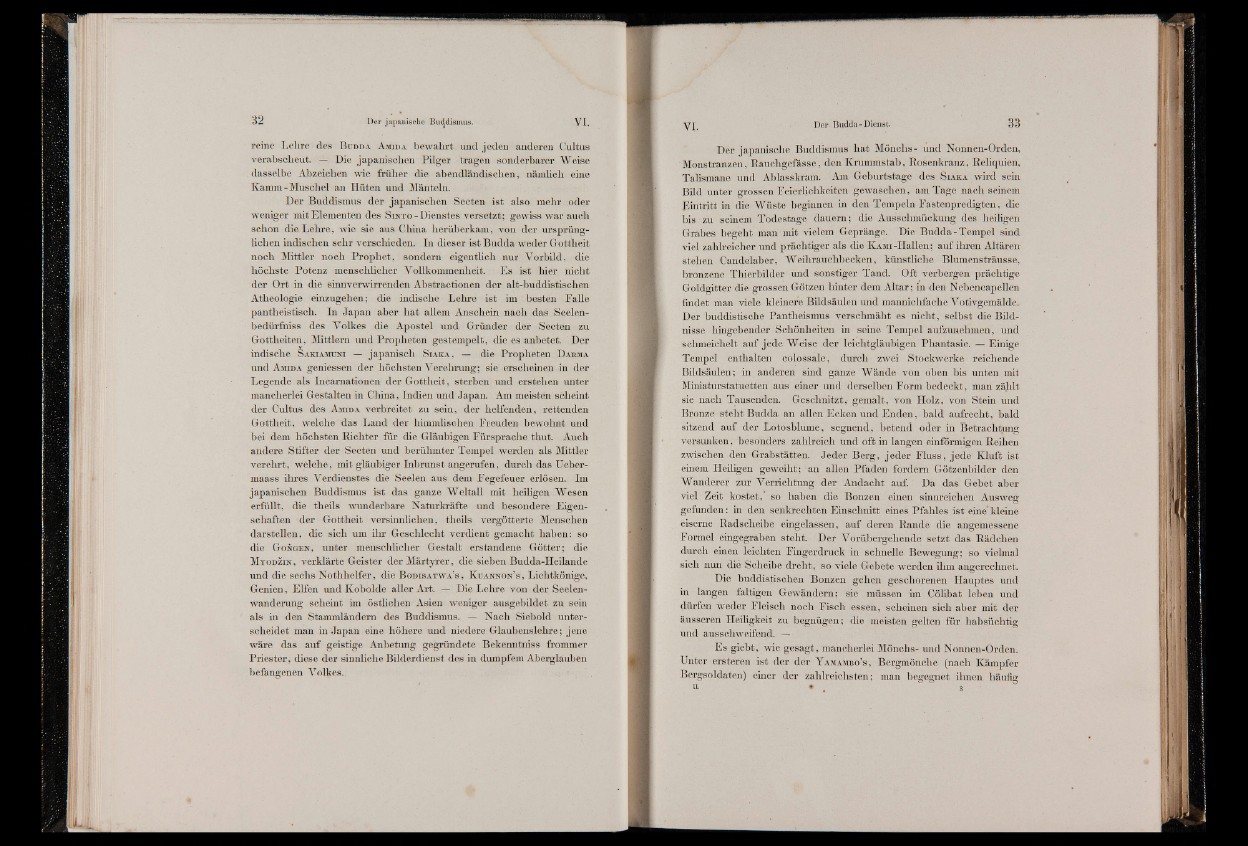
reine Lehre des B u d d a A m id a bewahrt und jeden anderen Cultus
verabscheut. — Die japanischen Pilger tragen sonderbarer Weise
dasselbe Abzeichen wie früher die abendländischen, nämlich eine
Kamm-Muschel an Hüten und Mänteln.
Der Buddismus der japanischen Secten ist also mehr oder
weniger mit Elementen des S i n t o - Dienstes versetzt; gewiss war auch
schon die Lehre, wie sie aus China herüberkam, von der ursprünglichen
indischen sehr verschieden. In dieser ist Budda weder Gottheit
noch Mittler noch Prophet, sondern eigentlich nur Vorbild, die
höchste Potenz menschlicher Vollkommenheit Es ist hier nicht
der Ort in die sinnverwirrenden Abstractionen der alt-buddistischen
Atheologie einzugehen; die indische Lehre ist im besten Falle
pantheistisch. In Japan aber hat allem Anschein nach das Seelen-
hedürfniss des Volkes die Apostel und Gründer der Secten zu
Gottheiten, Mittlern und Propheten gestempelt, die es anbetet. Der
i• ndi• sche & • • • S a k ia m u n i — japanisch S i a k a , — die Propheten ü a r m a
und A m id a gemessen der höchsten Verehrung; sie erscheinen in der
Legende als Incamationen der Gottheit, sterben und erstehen unter
mancherlei Gestalten in China, Indien und Japan. Am meisten scheint
der Cultus des A m id a verbreitet zu sein, der helfenden, rettenden
Gottheit, welche das Land der himmlischen Freuden bewohnt und
bei dem höchsten Richter für die Gläubigen Fürsprache thut. Auch
andere Stifter der Secten und berühmter Tempel werden als Mittler
verehrt, welche, mit gläubiger Inbrunst angerufen, durch das Ueber-
maass ihres Verdienstes die Seelen aus dem Fegefeuer erlösen. Im
japanischen Buddismus ist das ganze Weltall mit heiligen Wesen
erfüllt, die theils wunderbare Naturkräfte und besondere Eigenschaften
der Gottheit versinnlichen, theils vergötterte Menschen
darstellen, die sich um ihr Geschlecht verdient gemacht haben: so
die G o n g e n , unter menschlicher Gestalt erstandene Götter; die
M y o d z in , verklärte Geister der Märtyrer, die sieben Budda-Heilande
und die sechs Nothhelfer, die B o d i s a t w a ’s , K u a n n o n ’s , Lichtkönige,
Genien, Elfen und Kobolde aller Art. — Die Lehre von der Seelenwanderung
scheint im östlichen Asien weniger ausgebildet zu sein
als in den Stammländern des Buddismus. -- Nach Siebold unterscheidet
man in Japan eine höhere und niedere Glaubenslehre; jene
wäre das auf geistige Anbetung gegründete Bekenntniss frommer
Priester, diese der sinnliche Bilderdienst des in dumpfem Aberglauben
befangenen Volkes.
Der japanische Buddismus hat Mönchs- und Nonnen-Orden,
Monstranzen, Rauchgefässe, den Krummstab, Rosenkranz, Reliquien,
Talismane und Ablasskram. Am Geburtstage des S ia k a wird sein
Bild unter grossen Feierlichkeiten gewaschen, am Tage nach seinem
Eintritt in die Wüste beginnen in den Tempeln Fastenpredigten, die
bis zu seinem Todestage dauern; die Ausschmückung des heiligen
Grabes begeht man mit vielem Gepränge. Die Budda-Tempel sind
viel zahlreicher und prächtiger als die K a m i -Hallen; auf ihren Altären
stehen Candelaber, Weihrauchbecken, künstliche Blumensträusse,
bronzene Thierbilder und sonstiger Tand. Oft verbergen prächtige
Goldgitter die grossen Götzen hinter dem Altar; in den Nebencapellen
findet man viele kleinere Bildsäulen und mannichfache Votivgemälde.
Der buddistische Pantheismus verschmäht es nicht, selbst die Bildnisse
hingebender Schönheiten in seine Tempel aufzunehmen, und
schmeichelt auf jede Weise der leichtgläubigen Phantasie. — Einige
Tempel enthalten colossale, durch zwei Stockwerke reichende
Bildsäulen; in anderen sind ganze Wände von oben bis unten mit
Miniaturstatuetten aus einer und derselben Form bedeckt, man zählt
sie nach Tausenden. Geschnitzt, gemalt, von Holz, von Stein und
Bronze steht Budda an allen Ecken und Enden, bald aufrecht, bald
sitzend auf der Lotosblume, se°g nend, betend oder in Betrachttu nog
versunken, besonders zahlreich und oft in langen einförmigen Reihen
zwischen den Grabstätten. Jeder Berg, jeder Fluss, jede Kluft ist
einem Heiligen geweiht; an allen Pfaden fordern Götzenbilder den
Wanderer zur Verrichtung der Andacht auf. Da das Gebet aber
viel Zeit kostet, so haben die Bonzen einen sinnreichen Ausweg
gefunden: in den senkrechten Einschnitt eines Pfahles ist eine"kleine
eiserne Radscheibe eingelassen, auf deren Rande die angemessene
Formel eingegraben steht. Der Vorübergehende setzt das Rädchen
durch einen leichten Fingerdruck in schnelle Bewegung; so vielmal
sich nun die Scheibe dreht, so viele Gebete werden ihm angerechnet.
Die buddistischen Bonzen gehen geschorenen Hauptes und
in langen faltigen Gewändern; sie müssen im Cölibat leben und
dürfen weder Fleisch noch Fisch essen, scheinen sich aber mit der
äusseren Heiligkeit zu begnügen; die meisten gelten für habsüchtig
und ausschweifend. —
Es giebt, wie gesagt, mancherlei Mönchs- und Nonnen-Orden.
Unter ersteren ist der der Y am am b o ’s , Bergmönche (nach Kämpfer
Bergsoldaten) einer der zahlreichsten; man begegnet ihnen häufig
* . 3