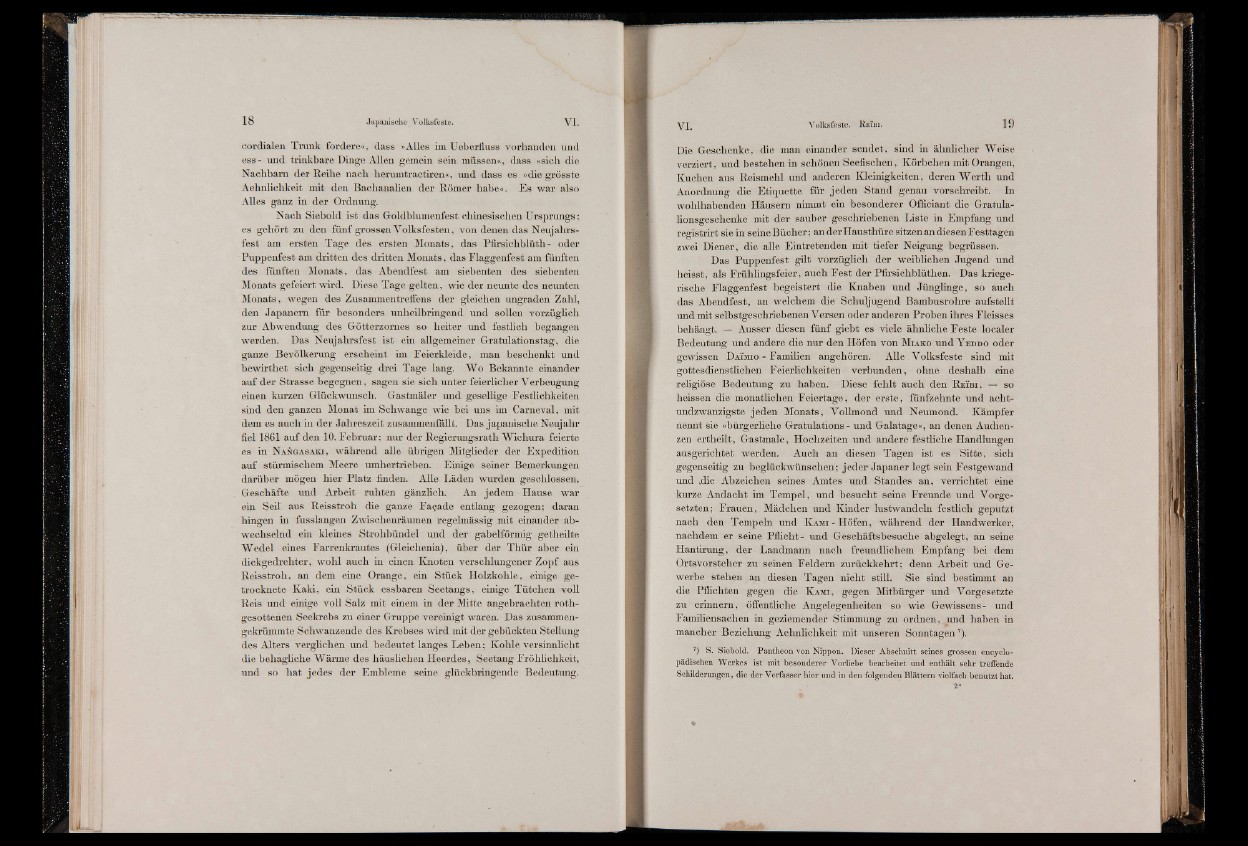
eordialen Trunk fordere«, dass »Alles im Ueberfluss vorhanden und
ess- und trinkbare Dinge Allen gemein sein müssen«, dass »sich die
Nachbarn der Reihe nach herumtractiren«, und dass es »die grösste
Aehnlichkeit mit den Baclianahen der Römer habe«. Es war also
Alles ganz in der Ordnung.
Nach Siebold ist das Goldblumenfest chinesischen Ursprungs;
es gehört zu den fünf grossen Volksfesten, von denen das Neujahrsfest
am ersten Tage des ersten Monats, das Pfirsichblüth- oder
Puppenfest am dritten des dritten Monats, das Plaggenfest am fünften
des fünften Monats, das Abendfest am siebenten des siebenten
Monats gefeiert wird. Diese Tage gelten, wie der neunte des neunten
Monats, wegen des Zusammentreffens der gleichen ungraden Zahl,
den Japanern für besonders unheilbringend und sollen vorzüglich
zur Abwendung des Götterzornes so heiter und festlich begangen
werden. Das Neujahrsfest ist ein allgemeiner Gratulationstag, die
ganze Beyölkerung erscheint im Peierkleide, man beschenkt und
bewirthet sich gegenseitig drei Tage lang. Wo Bekannte einander
auf der Strasse begegnen, sagen sie sich unter feierlicher Verbeugung
einen kurzen Glückwunsch. Gastmäler und gesellige Festlichkeiten
sind den ganzen Monat im Schwange wie bei uns im Carneval, mit
dem es auch in der Jahreszeit zusammenfallt. Das japanische Neujahr
fiel 1861 auf den 10. Februar; nur der Regierungsrath Wichura feierte
es in N a n g a s a k i , während alle übrigen Mitglieder der Expedition
auf stürmischem Meere umhertrieben. Einige seiner Bemerkungen
darüber mögen hier Platz finden. Alle Läden wurden geschlossen,
Geschäfte und Arbeit ruhten gänzlich. An jedem Hause war
ein Seil aus Reisstroh die ganze Façade entlang gezogen; daran
hingen in fusslangen Zwischenräumen regelmässig mit einander abwechselnd
ein kleines Strohbündel und der gabelförmig getheilte
Wedel eines Farrenkrautes (Gleichenia), über der Thür aber ein
dickgedrehter, wohl auch in einen Knoten verschlungener Zopf aus
Reisstroh, an dem eine Orange, ein Stück Holzkohle, einige getrocknete
Kaki, ein Stück essbaren Seetangs, einige Tütchen voll
Reis und einige voll Salz mit einem in der Mitte angebrachten roth-
gesottenen Seekrebs zu einer Gruppe vereinigt waren. Das zusammengekrümmte
Schwanzende des Krebses wird mit der gebückten Stellung
des Alters verglichen und bedeutet langes Leben; Kohle versinnlicht
die behagliche Wärme des häuslichen Heerdes, Seetang Fröhlichkeit,
und so hat jedes der Embleme seine glückbringende Bedeutung.
Die Geschenke, die man einander sendet, sind in ähnlicher Weise
verziert, u n d bestehen in schönen Seefischen, Körbchen mit Orangen,
Kuchen aus Reismehl und anderen Kleinigkeiten, deren Werth und
Anordnung die Etiquette für jeden Stand genau vorschreibt. In
wohlhabenden Häusern nimmt ein besonderer Officiant die Gratula-
lionsgeschenke mit der sauber geschriebenen Liste in Empfang und
registrirt sie in seine Bücher; an der Hausthüre sitzen an diesen Festtagen
zwei Diener, die alle Eintretenden mit tiefer Neigung begrüssen.
Das Puppenfest gilt vorzüglich der weiblichen Jugend und
heisst, als Frühlingsfeier, auch Fest der Pfirsichblüthen. Das kriegerische
Flaggenfest begeistert die Knaben und Jünglinge, so auch
das Abendfest, an welchem die Schuljugend Bambusrohre aufstellt
und mit selbstgeschriebenen Versen oder anderen Proben ihres Fleisses
behängt. Ausser diesen fünf giebt es viele ähnliche Feste localer
Bedeutung und andere die nur den Höfen von M ia k o und Y e d d o oder
gewissen D a 'im io - Familien angehören. Alle Volksfeste sind mit
gottesdienstlichen Feierlichkeiten verbunden, ohne deshalb eine
religiöse Bedeutung zu haben. Diese fehlt auch den R e 'i e i , pnsso
heissen die monatlichen Feiertage, der erste, fünfzehnte und achtundzwanzigste
jeden Monats, Vollmond und Neumond. Kämpfer
nennt sie »bürgerliche Gratulations- und Galatage«, an denen Audienzen
ertheilt, Gastmale , Hochzeiten und andere festliche Handlungen
ausgerichtet werden- Auch an diesen Tagen ist es Sitte, sich
gegenseitig zu beglückwünschen; jeder Japaner legt sein Festgewand
und .die Abzeichen seines Amtes und Standes an, verrichtet eine
kurze Andacht im Tempel, und besucht seine Freunde und Vorgesetzten;
Frauen, Mädchen und Kinder lustwandeln festlich geputzt
nach den Tempeln und K a m i - Höfen, während der Handwerker,
nachdem er seine Pflicht- und Geschäftsbesuche abgelegt, an seine
Hantirung, der Landmann nach freundlichem Empfang bei dem
Ortsvorsteher zu seinen Feldern zurückkehrt; denn Arbeit und Gewerbe
stehen an diesen Tagen nicht still. Sie sind bestimmt an
die Pflichten gegen die K a m i , gegen Mitbürger und Vorgesetzte
zu erinnern, öffentliche Angelegenheiten so wie Gewissens - und
Familiensachen in geziemender Stimmung zu ordnen, und haben in
mancher Beziehung Aehnlichkeit mit unseren Sonntagen7).
7) S, Siebold. Pantheon von Nippon. Dieser Abschnitt seines grossen encyclo-
pädischen Werkes ist mit besonderer Vorliebe bearbeitet und enthält sehr treffende
Schilderungen, die der Verfasser hier und in den folgenden Blattern vielfach benutzt hat.
2 *
«