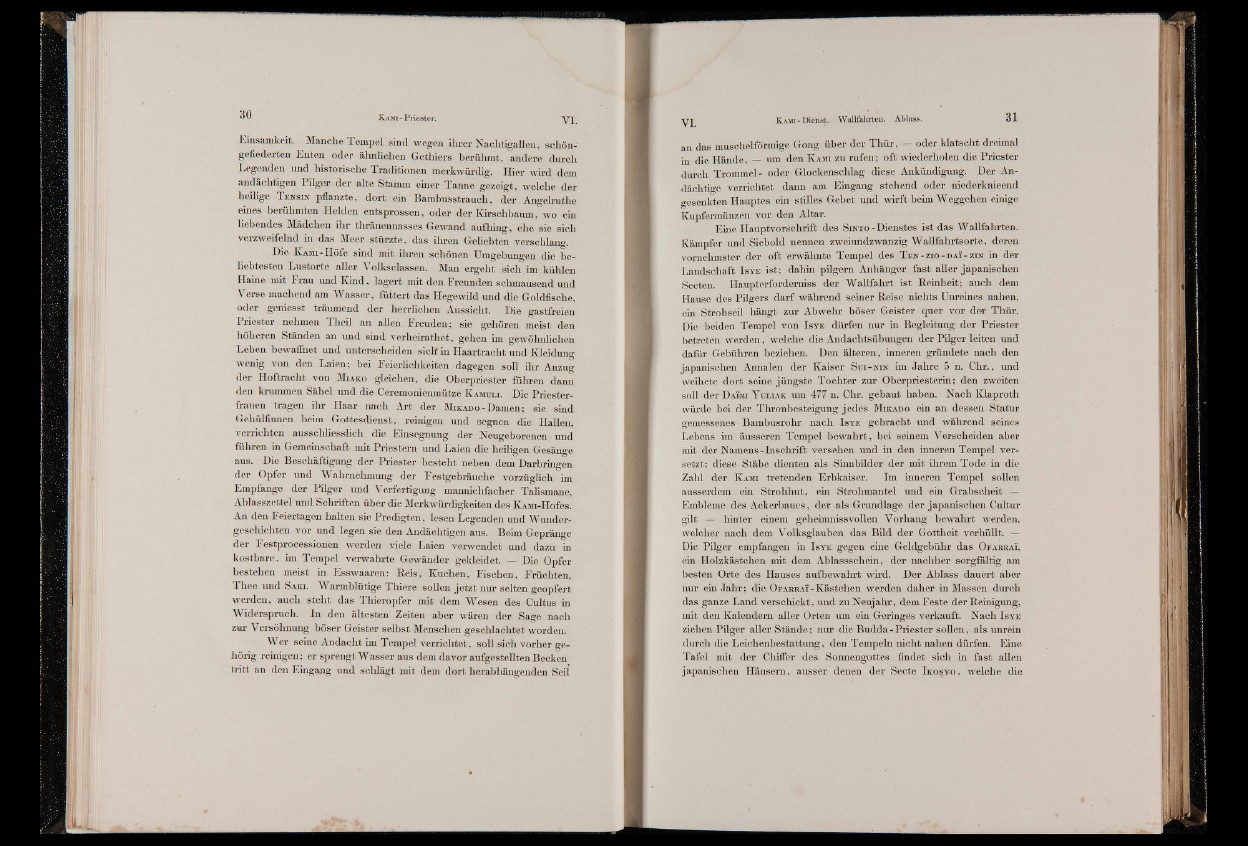
Einsamkeit. Manche Tempel sind wegen ihrer Nachtigallen, schöngefiederten
Enten oder ähnlichen Gethiers berülimt, andere durch
Legenden und historische Traditionen merkwürdig. Hier wird dem
andächtigen Pilger der alte Stamm einer Tanne gezeigt, welche der
heilige T e n s in pflanzte, dort ein Bambüsstrauch, der Angelruthe
eines berühmten Helden entsprossen, oder der Kirschbaum, wo ein
hebendes Mädchen ihr thränennasses Gewand aufhing, ehe sie sich
verzweifelnd in das Meer stürzte, das ihren Gebebten verschlang.
Hie K a m i -Hole sind mit ihren schönen Umgebungen die beliebtesten
Lustorte aller Volksclassen. Man ergeht sich im kühlen
Haine mit Frau und Kind, lagert mit den Freunden schmausend und
Yerse machend am Wasser, füttert das Hegewild und die Goldfische,
oder geniesst träumend der herrlichen Aussicht. Hie gastfreien
Priester nehmen Th eil an allen Freuden; sie gehören meist den
höheren Ständen an und sind verheirathet, gehen im gewöhnlichen
Leben bewaffnet und unterscheiden siclf in Haartracht und Kleidung
wenig von den Laien; bei Feierlichkeiten dagegen soll ihr Anzug
der Hoftracht von M ia k o gleichen, die Oberpriester führen dann
den krummen Sähel und die Ceremonienmütze K a m u l i . Hie Priesterfrauen
tragen ihr Haar nach Art der M ik a d o -Hamen; sie sind
Gehülfinnen beim Gottesdienst, reinigen und segnen die Hallen,
verrichten ausschliesslich die Einsegnung der Neugeborenen und
führen in Gemeinschaft mit Priestern und Laien die heiligen Gesänge
aus. Hie Beschäftigung der Priester besteht neben dem Barbringen
der Opfer und Wahrnehmung der Festgebräuche vorzüglich im
Empfange der Pilger und Verfertigung mannichfacher Talismane,
Ablasszettel und Schriften über die Merkwürdigkeiten des KAMi-Hofes.
An den Feiertagen halten sie Predigten, lesen Legenden und Wundergeschichten
vor und legen sie den Andächtigen aus. Beim Gepränge
der Festprocessionen werden viele Laien verwendet und dazu in
kostbare, im Tempel verwahrte Gewänder gekleidet. — Hie Opfer
bestehen meist in Esswaaren: Reis, Kuchen, Fischen, Früchten,
Thee und S a k i . Warmblütige Thiere sollen jetzt nur selten geopfert
werden, auch steht das Thieropfer mit dem Wesen des Cultus in
Widerspruch. In den ältesten Zeiten aber wären der Sage nach
zur Versöhnung höser Geister selbst Menschen geschlachtet worden.
Wer seine Andacht im Tempel verrichtet, soll sich vorher gehörig
reinigen; er sprengt Wasser aus dem davor aufgestellten Becken
tritt an den Eingang und schlägt mit dem dort herabhängenden Seil
an das muschelförmige Gong über der Tliür,*«- oder klatscht dreimal
in die Hände, — um den K am i z u rufen; oft wiederholen die Priester
durch Trommel- oder Glockenschlag diese Ankündigung. Her Andächtige
verrichtet dann am Eingang stehend oder niederknieend
gesenkten Hauptes ein stilles Gebet und wirft beim Weggehen einige
Kupfermünzen vor den Altar.
Eine Hauptvorschrift des Sraxo - Dienstes ist das Wallfahrten.
Kämpfer und Siebold nennen zweiundzwanzig Wallfahrtsorte, deren
vornehmster der oft erwähnte Tempel des T e n - z io - d a i - z in in der
Landschaft I s y e ist; dahin pilgern Anhänger fast aller japanischen
Secten. Ilaupterfordemiss der Wallfahrt ist Reinheit; auch dem
Hause des Pilgers darf während seiner Reise nichts Unreines nahen,
ein Strohseil hängt zur Abwehr böser Geister quer vor der Thür.
Die -beiden Tempel von I s y e dürfen nur in Begleitung der Priester
betreten werden, welche die Andachtsübungen der Pilger leiten und
dafür Gebühren beziehen. Ben älteren, inneren gründete nach den
japanischen Annalen der Kaiser Sui-nin im Jahre 5 n. Chr., und
weihete dort seine jüngste Tochter zur Oberpriesterin; den zweiten
soll der B a ir i Y u l ia k um 477 n. Chr. gebaut haben. Nach Klaproth
würde bei der Thronbesteigung jedes M ik a d o ein an dessen Statur
gemessenes Bambusrohr nach I s y e gebracht und während seines
Lebens im äusseren Tempel bewahrt, bei seinem Verscheiden aber
mit der Namens-Inschrift versehen und in den inneren Tempel versetzt;
diese Stäbe dienten als Sinnbilder der mit ihrem Tode in die
Zahl der K a m i tretenden Erbkaiser. Im inneren Tempel sollen
ausserdem ein Strohhut, ein Strohmantel und ein Grabscheit —
Embleme des Ackerbaues, der als Grundlage der japanischen Cultur
o-ili «SSI hinter einem geheimnissvollen Vorhang bewahrt werden,
welcher nach dem Volksglauben das Bild der Gottheit verhüllt. $1#
Hie Pilger empfangen in I s y e gegen eine Geldgebühr das OFAKRAi,
ein Holzkästchen mit dem Ablassschein, der nachher sorgfältig am
besten Orte des Hauses aufbewahrt wird. Her Ablass dauert aber
nur ein Jahr; die O f a r r a i -Kästchen werden daher in Massen durch
das ganze Land verschickt, und zu Neujahr, dem Feste der Reinigung,
mit den Kalendern aller Orten um ein Geringes verkauft. Nach I s y e
ziehen Pilger aller Stände; nur die Budda-Priester sollen, als unrein
durch die Leichenbestattung, den Tempeln nicht nahen dürfen. Eine
Tafel mit der Chiffer des Sonnengottes findet sich in fast allen
japanischen Häusern, ausser denen der Secte I k o s y o , welche die