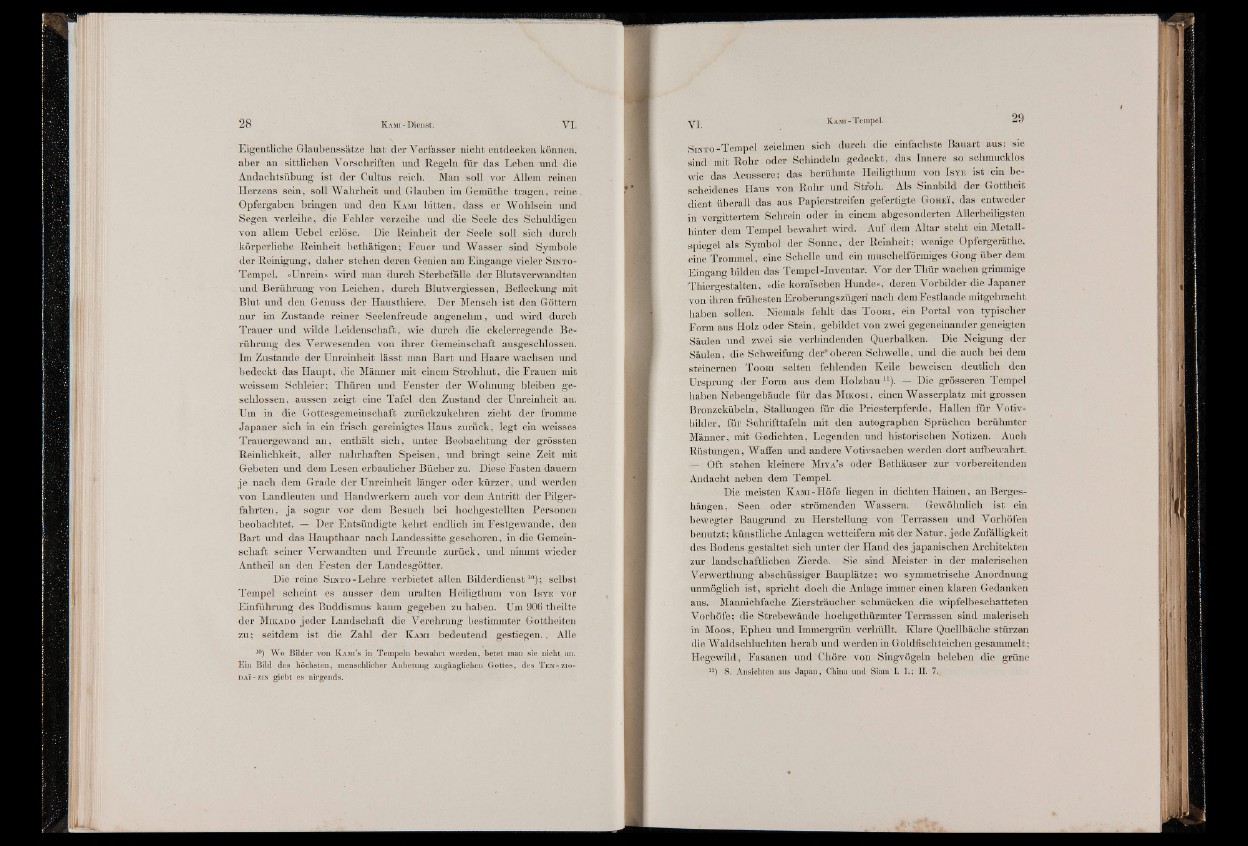
Eigentliche Glaubenssätze hat der Verfasser nicht entdecken können,
aber an sittlichen Vorschriften und Regeln für das Leben und die
Andachtsübung ist der Cultus reich. Man soll vor Allem reinen
Herzens sein, soll Wahrheit und Glauben im Gemüthe tragen, reine
Opfergaben bringen und den K am i bitten, dass er Wohlsein und
Segen verleihe, die Fehler verzeihe und die Seele des Schuldigen
von allem Uebel erlöse. Die Reinheit der Seele soll sich durch
körperliche Reinheit bethätigen; Feuer und Wasser sind Symbole
der Reinigung, daher stehen deren Genien am Eingänge vieler S in t o -
Tempel. »Unrein« wird man durch Sterbefälle der Blutsverwandten
und Berührung von Leichen, durch Blutvergiessen, Befleckung mit
Blut und den Genuss der Hausthiere. Der Mensch ist den Göttern
nur im Zustande reiner Seelenfreude angenehm, und wird durch
Trauer und wilde Leidenschaft, wie durch die ekelerregende Berührung
des Verwesenden von ihrer Gemeinschaft ausgeschlossen.
Im Zustande der Unreinheit lässt man Bart und Haare wachsen und
bedeckt das Haupt, die Männer mit einem Strohhut, die Frauen mit
weissem Schleier; Thüren und Eenster der Wohnung bleiben geschlossen,
aussen zeigt eine Tafel den Zustand der Unreinheit an.
Um in die Gottesgemeinschaft zurückzukehren zieht der fromme
Japaner sich in ein frisch gereinigtes Haus zurück, legt ein weisses
Trauergewand an, enthält sich, unter Beobachtung der grössten
Reinlichkeit, aller nahrhaften Speisen, und bringt seine Zeit mit
Gebeten und dem Lesen erbaulicher Bücher zu. Diese Fasten dauern
je nach dem Grade der Unreinheit länger oder kürzer, und werden
von Landleuten und Handwerkern auch vor dem Antritt der Pilgerfahrten,
ja sogar vor dem Besuch bei hochgestellten Personen
beobachtet. — Der Entsündigte kehrt endlich im Festgewande, den
Bart und das Haupthaar nach Landessitte geschoren, in die Gemeinschaft
seiner Verwandten und Freunde zurück, und nimmt wieder
Antheil an den Festen der Landesgötter.
Die reine S i n t o -Lehre verbietet allen Bilderdienst10); selbst
Tempel scheint es ausser dem uralten Heiligthum von I s y e vor
Einführung des Buddismus kaum gegeben zu haben. Um 906 theilte
der MiKAno jeder Landschaft die Verehrung bestimmter Gottheiten
zu; seitdem ist die Zahl der K am i bedeutend gestiegen.. Alle
10) W o Bild er von Kami’s in T em peln bewahrt w e rd en , b e te t man s ie nicht an.
Ein B ild d es h ö ch sten , menschlicher A n b e tu n g zugänglichen G o tte s, des T e n - z io -
daT - 7.1N g ieb t e s nirgends.
S i n t o -Tempel zeichnen sich durch die einfachste Bauart aus; sie
sind mit Rohr oder Schindeln gedeckt, das Innere so schmucklos
wie das Aeussere; das berühmte Heiligthuin von I s y e ist ein bescheidenes
Haus von Rohr und Stroh. Als Sinnbild der Gottheit
dient überall das aus Papierstreifen gefertigte G o h e ü , das entweder
in vergittertem Schrein oder in einem abgesonderten AllerheiJigsten
hinter dem Tempel bewahrt wird. Auf dem Altar steht ein Metallspiegel
als Symbol der Sonne, der Reinheit; wenige Opfergeräthe,
eine Trommel, eine Schelle und ein muschelförmiges Gong über dem
Klngang bilden das Tempel-Inventar. Vor der Thür wachen grimmige
Thiergestalten, »die koralschen Hunde«, deren Vorbilder die Japaner
von ihren frühesten Eroberungszügen nach dem Festlande mitgebracht
haben sollen. Niemals fehlt das T o o r i , ein Portal von typischer
Form aus Holz oder Stein, gebildet von zwei gegeneinander geneigten
Säulen und zwei sie verbindenden Querbalken. Die Neigung der
Säulen, die Schweifung der*oberen Schwelle, und die auch bei dem
steinernen T o o r i selten fehlenden Keile beweisen deutlich den
Ursprung der Form aus dem Holzbau ll). — Die grösseren Tempel
haben Nebengebäude für das M ik o s i , einen Wasserplatz mit grossen
Bronzekübeln, Stallungen für die Priesterpferde, Hallen für Votivbilder,
für Schrifttafeln mit den autographen Sprüchen berühmter
Männer, mit Gedichten, Legenden und historischen Notizen. Auch
Rüstungen, Waffen und andere Votivsachen werden dort aufbewahrt.
-■ Oft. stehen kleinere M iy a ’s oder Bethäuser zur vorbereitenden
Andacht neben dem Tempel.
Die meisten K am i - Höfe hegen in dichten Hainen, an Bergeshängen,
Seen oder strömenden Wassern. Gewöhnlich ist ein
bewegter Baugrund zu Herstellung von Terrassen und Vorhöfen
benutzt; künstliche Anlagen wetteifern mit der Natur, jede Zufälligkeit
des Bodens gestaltet sich unter der Hand des japanischen Architekten
zur landschaftlichen Zierde. Sie sind Meister in der malerischen
Verwerthung abschüssiger Bauplätze; wo symmetrische Anordnung
unmöglich ist, spricht doch die Anlage immer einen klaren Gedanken
aus. Mannichfache Ziersträucher schmücken die wipfelbeschatteten
Vorhöfe; die Strebewände liochgethürmter Terrassen sind malerisch
in Moos, Epheu und Immergrün verhüllt. Klare Quellbäche stürzen
die Waldschluchten herab und werden in Goldfischteichen gesammelt;
Hegewild, Fasanen und Chöre von Singvögeln beleben die grüne
u ) S . An sichten aus J ap an , China und Siam I. 1.; II. 7.„