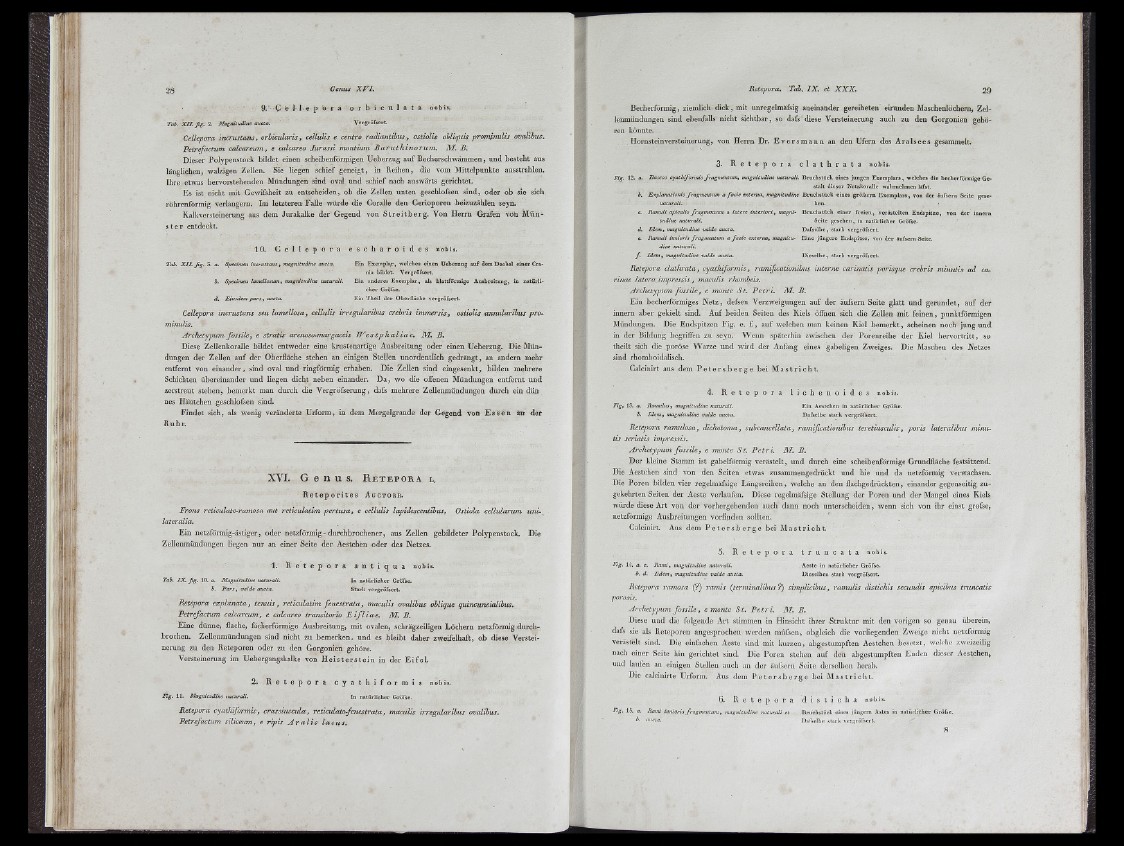
: 9. C e l l e p o r a o r b i c u l a t a
Tab. X I I . f i g . 2. Ma g n itu d in e aueta. V e rg rö fse rt.
Cellepora incnistarts, orbicularis, cellulis e centro radiantihus, ostiolis oUiquis prominulis ovalibus.
Petrefactum calcareum, e calcareo Jurassi montium B a r u th in o r um . M. B.
Dieser Polypenstock bildet einen scheibenförmigen Ueberzug auf Becherschwämmen, und besteht aus
länglichen, walzigen Zellen. Sie liegen schief geneigt, in Reihen, die vom Mittelpunkte ausstrahlen.
Ihre etwas hervorstehenden Mündungen sind oval und schief nach auswärts gerichtet.
Es ist nicht mit Gewifsheit zu entscheiden, ob die Zellen unten geschlofsen sind, oder ob sie sich
röhrenförmig verlängern. Im letzteren Falle würde die Coralle den Cerioporen beizuzählen seyn-
Kalkvevsteinerung aus dem Jurakalke der Gegend von S lr e itb e rg . Von Herrn Grafen voti Müns
t e r entdeckt.
10. C e l l e p o r a e s c l i a r o i d e s
Tab. S i l l . fi g . 3. a. Specimen in c ru sto n s, magnitudine aucta.
b. Specimen lamellosum, magnitudine naturali.
d . E iusdem p a r s , aucta.
n o b i s .
Ein Eseinpl.-ir, welches e in en U e b e rz u g a u f dem Deck el e in e r Crania
b ild e t. V e rg rö fs e rt
Ein an d eres E x em p la r, als b la ttfö rm ig e A u sb re itu n g , in n a tü rli-
cLer Gröfse.
E in T b e il d e r O b erfläch e v e rg rö fs e r t
Cellepora incrustans seu lamellosa, cellulis irregularibus crehris immersis, ostiolis annularihus prominulis.
Archetypum fossile, e stratis arenoso-margaceis W e s tp h a l ia e . M . B.
Diese ZellenkoiiJle bildet entweder eine krustenartige Ausbreitung oder einen Ueberzug. Die Mündungen
der Zellen auf der Oberfläche stehen an einigen Stellen unordentlich gedrängt, an ändern mehr
entfernt von einander, sind oval und ringförmig erhaben. Die Zellen sind eingesenkt, bilden mehrere
Schichten übereinander und liegen dicht neben einander. Da, wo die offenen Mündungen entfernt und
zerstreut stehen, bemerkt man durch die Vergröfserung, dafs mehrere Zellenmündungen durch ein dün
nes Häutchen geschlofsen sind.
Findet sich, als wenig veränderte Urform, in dem Mergelgrande der Gegend von E s s e n àn def
Ruhr.
XVI. Ge n u s . Retepoha l.
R e t e p o r i t e s A u c t o r r .
Frons reticulato-ramosa aut rcticulatim pertusa, e cellulis lapidescentibus. Ostiola cellularum uni-
lateralia.
Ein netzförmig-ästiger, oder netzförmig-durchbrochener, aus Zellen gebildeter Polypenstock. Die
Zellenmündungen liegen nur an einer Seite der Aestchen oder des Netzes.
1. R e t e p o r a a n t i q u a n
In n a tü rlich e r Gröfse.
S ta rk v c rg rö fs e rt.
Tab. I X . f ig . 10. a. Ma g n itu d in e naturali.
b. P a r s , va ld e aueta.
Retepora explanata, tenuis, reticulatim fenestrata, macidis ovalibus oblique quincuncialihus.
Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio E i f l i a e . M. B.
Eine dünne, flache, fächerförmige Ausbreitung, mit ovalen, schrägzeiligen Löchern netzförmig durchbrochen.
Zellenmündungen sind nicht zu bemerken, und cs bleibt daher zweifelhaft, ob diese Versteinerung
zu den Reteporen oder zu den Gorgonieu gehöre.
Versteinerung im Uebergangskalke von H e is te r s t e in in der E ife l.
2. R e t e p o r a c y a t h i f o r m i s n o b i » .
11. Magnitudine naturali. In n a tü rlich e r Gröfse.
Retepora cyathiformis, crassiuscida, reticulatofenestrata, maculis irrcgidarihus ovaLihus.
Petrefactum siliceum, e ripis A r a l i s la e u s.
Becherförmig, ziemlich dick, mit unregelmäfsig aneinander gereiheten’ eirunden Maschenlöchem, Zellenmündungen
sind ebenfalls nicht sichtbar, so dafs diese Versteinerung auch zu den Gorgonien gehören
könnte.
Hornsteinversteinerung, von Herrn Dr. E v e r sm a n n an den Ufern des A ra lse e s gesammelt.
3. R e t e p o r a c l a t h r a t a nobis.
Flg. 12. a. Baseos cjathifiormis fra gm e n tum , m a gmtudine naturali. Bru ch stü ck eines ju n g en E x em p la rs , welches die bc clie rfo rmig e Gesta
lt d ie se r N etzk o ralle wahrnehm cn löTst.
b. Exp la n a tio n is fra gm e n tum a fa c ie extenus, magnitudine Bin ch stü c k e in es g rö fse rn E x em p la rs , von d e r äu fse rn Se ite gese-
naturali. h en.
e. R amu li apicalis fra gm e n tum a latere in te r io r i, magni- B ru c h s tü ck e in e r f re ie n , v e rä s te lten En d spU zc , von d e r in n e rn
tu d in e naturali.
d . Id em , magnitudine va ld e aucta.
t. R amid i iunioris fra gm e n tum a fa c t
dine naturali,
f . I d em , magmtudine va ld e aucta.
Se ite g e se h e n , in n a tü rlich e r Gröfse.
Da fse lb e , sta rk v e rg rö fsert.
■ externa, magnitu- E in e jü n g e re E n d sp itz e , von d e r äufsern Seite.
D ie se lb e , st.irk v e rg rö fs ert.
Retepora clathrata, cyathiformis, ramificationihus interne carinatis porisqne crehris minutis ad ca-
rinae latera impressis, maculis rJwmheis.
Archetypum-fossile, e monte S t. P e tri. M. B.
Ein becherförmiges Netz, defsen Verzweigungen auf der äufsern Seite glatt und gerundet, auf der
innern aber gekielt sind. Auf beiden Seiten des Kiels öffnen sich die Zellen mit feinen, punktförmigen
Mündungen. Die Endspitzen Fig. e. f., auf welchen man keinen Kiel bemerkt, scheinen noch jung und
in der Bildung begrißeu zu seyn. Wenn späterhin zwischen der Porenreihe der Kiel hervoriritt, so
theilt sich die poröse Warze und wird der Anfang eines gabeligen Zweiges. Die Maschen des Netzes
sind rhomboidalisch.
Calcinirt aus dem P e t e r s b e r g e bei M a s t r i c h t .
4. R e t e p o r a l i c h e n o i d e s nobis.
Fig, 13. <7. R amiilu s, magmtudine naturali. E in Aestch en in n a tü rlich e r Gröfse.
b. I d em , magnitudine va ld e aueta. Dafselbe s ta rk v e rg rö fs e rt.
Retepora ranmlosa, dichotoma, suhcajicellata, ramificationihus teretiuscidis, poris lateralibus rninu-
tis seriatis impressis.
Archetypum fossile, e monte S t. P e tr i. M. B.
Der kleine Stamm ist gabelförmig verästelt, und durch eine scheibenförmige Grundfläche festsitzend.
Die Aestchen sind von den Seiten etwas zusammengedrückt und hie und da netzförmig verwachsen.
Die Poren büdeu vier regelmäfsige Längsreihen, welche an den flachgedrückten, einander gegenseitig zugekehrten
Seiten der Aeste verlaufen. Diese regelmäfsige Stellung der Poren und der Mangel eines Kiels
würde diese Art von der vorhergehenden auch dann noch unterscheiden, wenn sich von ihr einst grofse,
netzförmige Ausbreitungen vorfiiiden sollten.
Calcinirt. Aus dem P e t e r s b e r g e bei M a s t r i c h t.
5. R e t e p o r a t r u u c a t a nobis.
Fig . l'i. a. C. R am i, magnitudine naturali.
b. d. lid em , magtàtndine va ld e aucta.
Acstc in n a tü rlich e r Gröfse.
Die selb en sta rk v c rg rö fs ert.
Retepora rtxmosa (?) ramis {terminalihis?) simplicibus, ramulis distichis secundis apicihus truncatis
\3orosis.
Archetypum fossile, e monte S t. P e t r i M. B.
Diese und die folgende Art stimmen in Hinsicht ihrer Struktur mit den vorigen so genau überein,
dals sie als Reteporen angesprochen werden müfsen, obgleich die vorliegenden Zweige nicht netzförmig
verästelt sind. Die einfachen Aeste sind mit kurzen, abgestumpften Aestchen besetzt, welche zweizeilig
nach einer Seite hin gerichtet sind. Die Poren sichen auf den abgestumpften Enden dieser Aestchen,
uud laufen an einigen Stellen auch an der äulseni Seite derselben herab.
Die calcinirte Urform. Aus dem P ie t e r s b e r g e bei Mas t r i ehe.
Fig. 15. a. Rami iunioris fra gm e n ti
b. aucta.
6. R e t e p o r a
, mag n i tudine n a tu ra li e t
d i s t i c h a n o b i 5.
Bru c lislück eines jü n g e rn Asles in iia lü rlic h e r Gröfsc.
Dafselbe stark vc rg rö fsert.