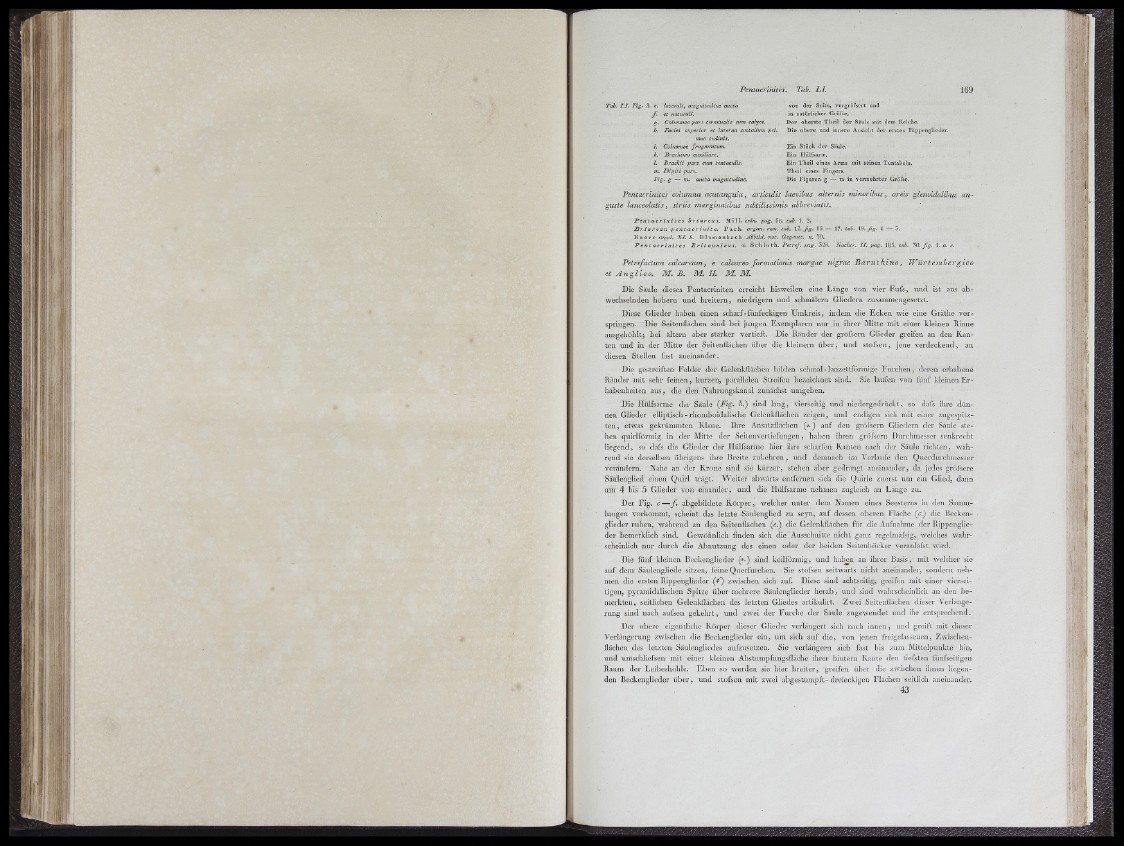
Tab. L L Fig. 3. a. la te ra li, magn itu d in e oncia
f . e t naturali.
g . Columnae p a rs te rminalis cum calyce.
h. Facies superior e t in te rn a costalium p r imae
ordinis.
i. Columnae fra gm e n tum .
k. Bracldnm auxiliare.
l. B ra c h ii p a r s cum tentaculis. '
vu D i g i t i pars.
F ig . g — m. ancta magnitudine.
vo n d e r Se ite , v e rg rö rs e rt und
in n a liirlic h er Gröfsc.
D e r o b e rs te T lie il d e r Säu le in it dem Kelche.
D ie o b e re un d in n e re .Ansicht d e r e rs te n Rip p cn g lied e r.
E in Siü ch d e r Säi ,1c.
E in Hülfsarin.
E in T h e il e ines A
T h e il eines Fin g ers.
Die
m it se in en Tentalteln.
g — m in v e rm e h r te r Gröfse.
Pentacrinites columna aaitangula, articulis laevibus alternis minorihus, areis glenoidalihus anguste
lanceolatis, striis marginalihus suhtilissimis ahhreviatis.
B r i a r e a n p e n t a c r i n i t i
K n o z T suppl. X L b. B l u n
P e n t a c r i n i t e s B r i t a n
M i l ) , crin. p ag. 56. tab. 1. 2. .
P a r l i . Organ, rem. tah. \7. f ig . 15 — 17. ttb . \.8. fig . 1 — 3.
I n b a c h Abbild, n a t. Gegeiist. n. 70.
i c u s . V. S c h l o t h . P e tr e f. /m g . 328. N a e k tr . I L p ag. 105. tab. 30. fig . 1. i
Petrefactum calcareum, e calcareo formationis margae nigrae B a r u th in o , W ü r tem h e r gico
et A n g i ic o . M . B. M. H. M. M.
Die Säule dieses Pentacriuiten erreicht bisweilen eiue Länge von vier Fufs, und ist aus abwechselnden
höheru und breitem, niedrigem und schmälern Gliedern zusammengesetzt.
Diese Glieder haben einen scharf-fiinfeckigeu Umkreis, indem die Ecken wie eine Gräthe vorspringen.
Die Seitenflächen sind, bei jungen Exemplaren nur iu ihrer Mitte mit einer kleinen Rinne
ausgehöhlt; bei altem aber stärker vertieft. Die Ränder der gröfsem Glieder greifen an den Kauten
uud iu der Mitte der Seitenflächen über die klcincru über, und stofsen, jene verdeckend, au
diesen Stellen fast aneinander.
Die gestreiften Felder der Gelenkflächen bilden schmal-lanzettförmige Furchen, deren erhabene
Ränder mit sehr feinen, kurzen, parallelen Streifen bezeichnet sind. Sie laufen von fünf kleinen E rhabenheiten
aus, die den Nahrungskanal zunächst umgeben.
Die Hülfsarme der Säule {Fig. IC) sind lang, vierseitig und niedergedrückt, so dafs ihre dünnen
Glieder elliptisch-rhomboidalische Gelenkflächen zeigen, und endigen sich mit einer zugespitzten,
etwas gekrümmten Klaue. Ihre Ansatzüächen ("•) auf den gröfsern Gliedern der Säule stehen
quirlförmig in der Mitte der Seilenvertiefungen, haben ihren gröfsern Durchmesser senkrecht
liegend, so dafs die Glieder der Hülfsarme hier ihre scharfen Kauten nach dor Säule richten, während
sie derselben übrigens ihre Breite zukehren, und demnach im Verlaufe den Querdurchmesser
verändern. Nahe an der Krone sind sie kürzer, stehen aber gedrängt aneinander, da jedes gröfsere
Säulenglied einen Quirl trägt. Weiter abwärts entfernen sich die Quirle zuerst um ein Glied, dann
um 4 bis 5 Glieder von einander, uud die Hülfsarme nehmen zugleich au Länge zu.
Der Fig. c—f . abgebildete Körper, welcher unter dem Namen eines Seestern.s in den Sammlungen
vorkommt, scheint das letzte Sänlenglied zu seyn, auf dessen oberen Fläche (c.) die Bccken-
glieder ruhen, während an den Seitenflächen (e.) die Gelenkflächen für die Aufnahme der Rippenglie-
der bemerklich sind. Gewöhnlich finden sich die Ausschnitte nicht ganz regelmäfsig, welches wahrscheinlich
nur durch die Abnutzung des einen oder der beiden Seitenhöcker veranlafst iwrd.
Die fünf kleinen Beckenglieder (*•) sind keilförmig, und haben an ihrer Basis, mit welcher sie
auf dem Säulengliede sitzen, feiue Querfurchen. Sie stofsen seitwärts nicht aneinander, sondern nehmen
die ersten Rippengiieder («>') zwischen sich auf. Diese siud achtscitig, greifen mit einer vierseitigen,
pyramidalischcn Spitze über mehrere Säulenglieder herab, und sind wahrscheinlich an den bemerkten,
seitlichen Gelenkflächen des letzten Gliedes artikuUrt. Zwei Seitenflächen dieser Verlängerung
siud nach aufsen gekehrt, und zwei der Furche der Säiüe ziigewcndct und ihr entsprechend.
Der obere eigentliche Körper dieser Glieder verlängert sich nach innen, und greift mit dieser
Verlängerung zwischen die Beckenglieder ein, um sich auf die, von jenen freigelassenen, Zwischen-
flächcn des letzten Sänicngliedcs aufzusetzeu. Sie verlängern sich fast bis zum Mittelpimkte hin,
uud umschliefsen mit einer kleinen Abstumpfungsfläciie ilirer hintern Kaute den tiefsten fünfseitigen
Raum der Leibeshohlc. Eben so werden sie hier breiter, greifen über die zwischen ihnen liegenden
Bcckengiicder über, und stofsen mit zwei abgestumpft-dreieckigen Flächen seitlich aneinander.
43
ii. 1
1 ‘ f
' h
li ll
4 f