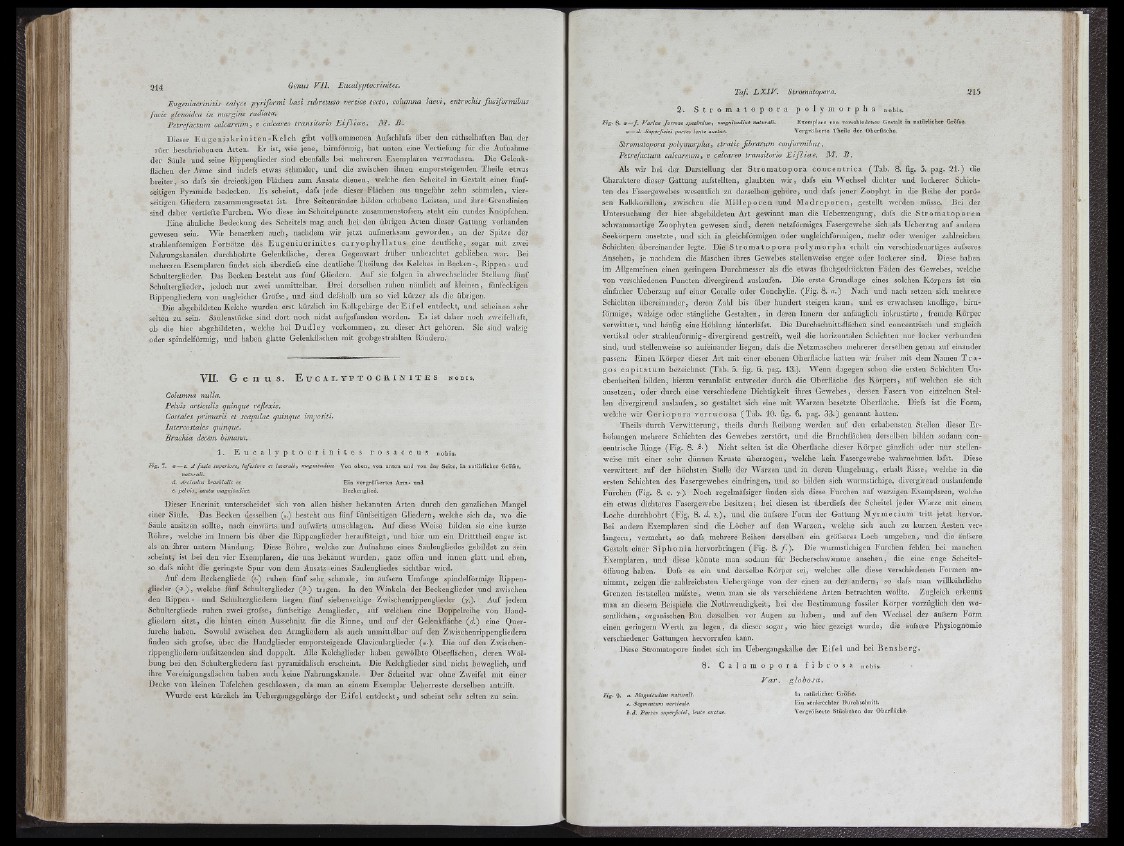
' In i
‘ I I
'SI;;:
i i ä l
Eugeniacrinitis calyce pyriforini hasi suhretuso vertice tecto, columna laevi, entrochis fusifonnihus
faeie glenoidea in margine radiata.
Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio E i flia e . M . B.
Dieser E u g e u ia k r iu i te u -K e l c li gibt vollkommenea Aufsclilufs über den räthselhaften Bau der
rüer beschriebenen Arten. Er ist, wie jene, bimförmig, hat unten eine Vertiefung für die Aufnahme
der Säule uud seine Rippenglieder sind ebenfalls bei mehreren Exemplaren verwachsen. Die Gelenk-
flachen der Arme sind indefs etwas schmäler, und die zwischen ihnen emporsteigenden Theile etwas
breiter, so dafs sie dreieckigen Flächen zum Ansatz dienen, welche den Scheitel in Gestalt einer füuf-
seiligen Pyramide bedecken. Es scheint, dafs jede dieser Flächen aus ungefähr zehn schmalen, vierseitigen
Gliedern zusammengesetzt ist. Ihre Seitenränder bilden erhabene Leisten, und ihre Grenzlinien
sind daher vertiefte Furchen. V\'’o diese im Scheitelpuncte zusammenstofsen, steht ein rundes Knöpfchen.
Eine ähnliche Bedeckung des Scheitels mag auch bei den übrigen Arten dieser Gattung vorhanden
gewesen sein. Wir bemerken auch, nachdem Avir jetzt aufmerksam geworden, an der Spitze der
strahlenförmigen Fortsätze des E u g e n ia c r in ite s c a ry o p h y lla tu s eine deutliche, sogar mit zwei
Nahrungskanälen durchbohrte Geleukfläche, deren Gegenwart früher unbeachtet geblieben Avar. Bei
mehreren Exemplaren findet sich überdiefs eine deutliche Theilung des Kelches in Becken-, Rippen- uud
Schulterglieder. Das Becken besteht aus fünf Gliedern. Auf sie folgen in abAvcchsclndcr StelluDg füuf
Schultcrglieder, jedoch nur zwei unmittelbar. Drei derselben ruhen nämlich auf kleinen, fünfeckigen
Rippengliedern von ungleicher Gröfse, und sind defshalb um so viel kürzer als die übrigen.
Die abgebildeteu Kelche \Amrden erst kürzlich im Kalkgebirge der E i f e l entdeckt, und scheinen sehr
selten zu sein. Säulenstücke sind dort noch nicht aufgefunden Avorden. Es ist daher noch zAveifclliaft,
ob die hier abgebildeten, welche bei D u d le y Vorkommen, zu dieser Art gehören. Sie sind walzig
oder spindelförmig, und haben glatte Gelenliflächen mit grobgcstrahlten Rändern.
VII. G e n u s . E u c a l y p t o c r i í ^ i t e s n o b i s .
Columna nulla.
Pelvis articulis quinque refexis.
Costales primarii et scapulae quinque impositi.
Intercostales quinque.
Brachia decem himana.
1. E u c a l y p t o c r i n i t e s r o s a c e u s nobi*.
Fig. 7. a — e. A fa c ie superiore, in feriore e t lacerali, magnitudine Von o b e n , vo n u n te n und ro n d n r S e ite , in n a tü rlicb e r Gröfse.
naturali.
d. Articu lu s brachialis e t Ein
ä rg rö fs crles Arm* un d
e. p e lv is , aucta magnitudine.
B c cb e i
Dieser Encrinit unterscheidet sich von allen bisher bekannten Arten durch den gänzlichen JMangel
einer Säule. Das Becken desselben (*.) besteht aus fünf fünfseitigen Gliedern, welche sich da, wo die
Säule ansitzen sollte, nach einwärts und aufwärts Umschlägen. Auf diese Weise bilden sie eine kurze
Röhre, welche im Innern bis über die Rippengiieder herauEteigt, und hier um ein Dritttheil enger ist
als an ihrer untern Mündung. Diese Röhre, welche zur Aufnahme eines Sänlengliedes gebildet zu sein
scheint, ist bei den vier Exemplaren, die uns bekannt wurden, ganz offen und innen glatt uud eben,
so dafs nicht die geringste Spur von dem Ansatz eines Säulengliedes sichtbar wird.
Auf dem Beckengliede (*•) ruhen fünf sehr schmale, im äufsern Umfange spindelförmige Rippenglieder
( f .) , welche fünf Schulterglieder (&.) tragen. In den Winkeln der Beckenglieder und zwischen
den Rippen- und Schultergliedern liegen fünf siebenseilige Zwischenrippenglieder (y.). Auf jedem
Schultergliede ruhen zwei grofse, fünfseitige Armglieder, auf welchen eine Doppelreihe von Handgliedern
sitzt, die hinten einen Ausschnitt für die Rinne, und auf der Gelenkfläche (d.) eine Querfurche
haben. Sowohl zwischen den Armgliedern als auch unmittelbar auf den Zwischenrippengliedern
finden sich grofse, über die Handglieder emporsleigende Clavicularglieder (?»•). Die auf den Zwischenrippengliedern
aufsitzenden sind doppelt. Alle Kelchglieder haben gewölbte Oberflächen, deren Wölbung
bei den Schukergliedern fast pyramidalisch erscheint. Die Kelchglieder sind nicht beweglich, und
ihre Vereinigangsflächcn haben auch keine Nahrungskanäle. Der Scheitel war ohne ZAveifcl mit einer
Decke von kleinen Täfelchen geschlossen, da man an einem Exemplar Ueberreste derselben antrifft.
Wurde erst kürzlich im Uebergangsgebirge der E if e l entdeckt, und scheint sehr selten zu sein.
p o l y m o r p h n o b i s .
E s em p la re von v e rsc h ie d en e r G e s ta lt i
VcrgrüTserte T h eile d e r Oberilticbe.
n a tü rlic h e r Gröfsc.
2. S t r o m a t o p o r a
Fig. 8. a —f . Mariae fo rm a e specimina, m a g nitudine naturali.
a— d . S u p e r fc ie i pa rte s len te auctae.
Stromatopora polymorpha, stratis fh rarum cojformihus.
Petrefactum calcareum, e calcareo transitorio E iflia e . M . B.
AIs wir bei der Darstellung der S trom a to p o r a c o n c e n tr ic a (Tab. 8. fig. 5. pag. 21.) die
Charaktere dieser Gattung aufstellten, glaubten wir, dafs ein Wechsel dichter und lockerer Schichten
des Fasergewebes wesentlich zu derselben gehöre, und dafs jener Zoophyt in die Reihe der porösen
Kalkkorollen, zwischen die M ille p o re n und M a d r e p o r e n , gestellt werden müsse. Bei der
Untersuchung der hier abgebildeteu Art gewinnt man die Ueberzeugung, dafs die S tro r a a to p o r e n
schwammartigo Zoophyten gcAvesen sind, deren netzförmiges Fasergewebe sich als Ueberzug auf ändern
Seekörpern ansetzte, und sich in gleichförmigen oder ungleichförmigen, mehr oder weniger zahlreichen
Schichten übereinander legte. Die S tr o m a to p o r a p o lym o rp h a erhält ein verschiedenartiges äufseres
Ansehen, je nachdem die Maschen ihres Gewebes stellenweise enger oder lockerer sind. Diese haben
im Allgemeinen einen geringem Durchmesser als die etwas flachgedrückten Fäden des Gewebes, Avelche
von verschiedenen Puuctcn divergirend auslaufen. Die erste Grundlage eines solchen Körpers ist ein
einfacher Ueberzug auf einer Coralle oder Conchylie. (Fig. 8. ß.) Nach und nach setzen sich mehrere
Schichten übereinander, deren Zahl bis über hundert steigen kann, und es erwachsen knollige, bimförmige,
walzige oder stängliche Gestalten, in deren Innem der anfänglich inkrustirte, fremde Körper
verwittert, und häufig eine Höhlung Inntcrläfst. Die Durchschniltsflächen sind concentrisch und zugleich
vertikal oder strahlenförmig-divergirend gestreift, weil die horizontalen Schichten nur locker verbunden
sind, und stellenweise so aufeinander liegen, dafs die Netzmaschen mehrerer derselben genau auf einander
passen. Einen Körper dieser Art mit einer ebenen Oberfläche hatten wir früher mit dem Namen T r a g
os c a p ita tum bezeichnet (Tab. 5. fig. 6. pag. 13-). Wenn dagegen schon die ersten Schichten Unebenheiten
bilden, hierzu veranlafst entAA'-eder durch die Oberfläche des Körpers, auf welchen sie sich
arisetzen, oder durch eine verschiedene Dichtigkeit ihres Gewebes, dessen Fasern von einzelnen Stellen
divergirend auslaufen, so gestaltet sich eine mit Warzen besetzte Oberiläche. Diefs ist die Form,
welche AA'ir C e r io p o r a v e r ru c o s a (Tab. 10. fig. 6. pag. 33.) genannt hatten.
Theils durch Verwitterung, theiE durch Reibung werden auf den erhabensten Stellen dieser E rhöhungen
mehrere Schichten des Gewebes zerstört, und die Bruchflächen dersellien bilden sodann concentrische
Ringe (Fig. 8. Nicht selten ist die Oberfläche dieser Körper gänzlich oder nur stellenweise
mit einer sehr dünnen Kmste überzogen, welche kein Fasergewebe wahrnehmen läfst. Diese
verwittert auf der höchsten Stelle der Warzen und in deren Umgebung, erhält Risse, welche in die
ersten Schichten des Fasergewebes eindringen, und so bilden sich wurmstichige, divergirend auslaufende
Furchen (Fig. 8. c. y). Noch regelmäfsiger finden sich diese Furchen auf Avarzigen Exemplaren, welche
ein etwas dichteres FasergcAvebe besitzen; bei diesen ist überdiefs der Scheitel jeder Warze mit einem
Loche durchbohrt (Fig. 8. d. 5.), und die äufsere Form der Gattung My rmec ium tritt jetzt hervor.
Bei ändern Exemplaren sind die Löcher auf den Warzen, welche sich auch zu kurzen Aesten verlängern,
vermehrt, so dafs mehrere Reihen derselben eiu gröfseres Loch umgeben, und die äufsere
Gestalt einer S ip h o n ia hervorbringen (Fig. 8. / ) . Die wurmstichigen Furchen fehlen bei manchen
Exemplaren, und diese könnte man sodann für BecherschAvammo ausehen, die eine enge Scheitel-
öffüung haben. Dafs es ein und derselbe Körper sei, welcher alle diese verschiedenen Formen annimmt,
zeigen die zahlreichsten Uebergänge von der eiuen zu der ändern, so dafs man willkührliche
Grenzen feststellen müfste, wenn man sie als verschiedene Arten betrachten wollte. Zugleich erkennt
man an diesem Beispiele, die Nolhwcudigkeit, bei der Bestimmung fossiler Körper vorzüglich den Ave-
sentlicheii, organischen Bau derselben vor Augen zu haben, und auf deu Wechsel der äufsern Form
einen geringem Werth zu legen, da dieser sogar, wie hier gezeigt wurde, die äufsere Physiognomie
verschiedener Gattungen hervorrulen kann.
Diese Stromatopore findet sich im Uebergangskalke der E ife l uud bei B en sb e rg .
8 . C a l a m o p o r a f i b r o s a n o b i s .
V a r . globosa.
Fig. 9. a. ß la g n itu d in e naturali,
e. Segmentum verticale,
h. d. P a r te s su p e r fc ie i, lente auctae.
tn n a tü rlic b e r GrÖfsC.
E in s c n b re ch te r Du ix b ä clin itt.
V e rg rö fse rte S lü ck c b en clor Obcrllficbc.