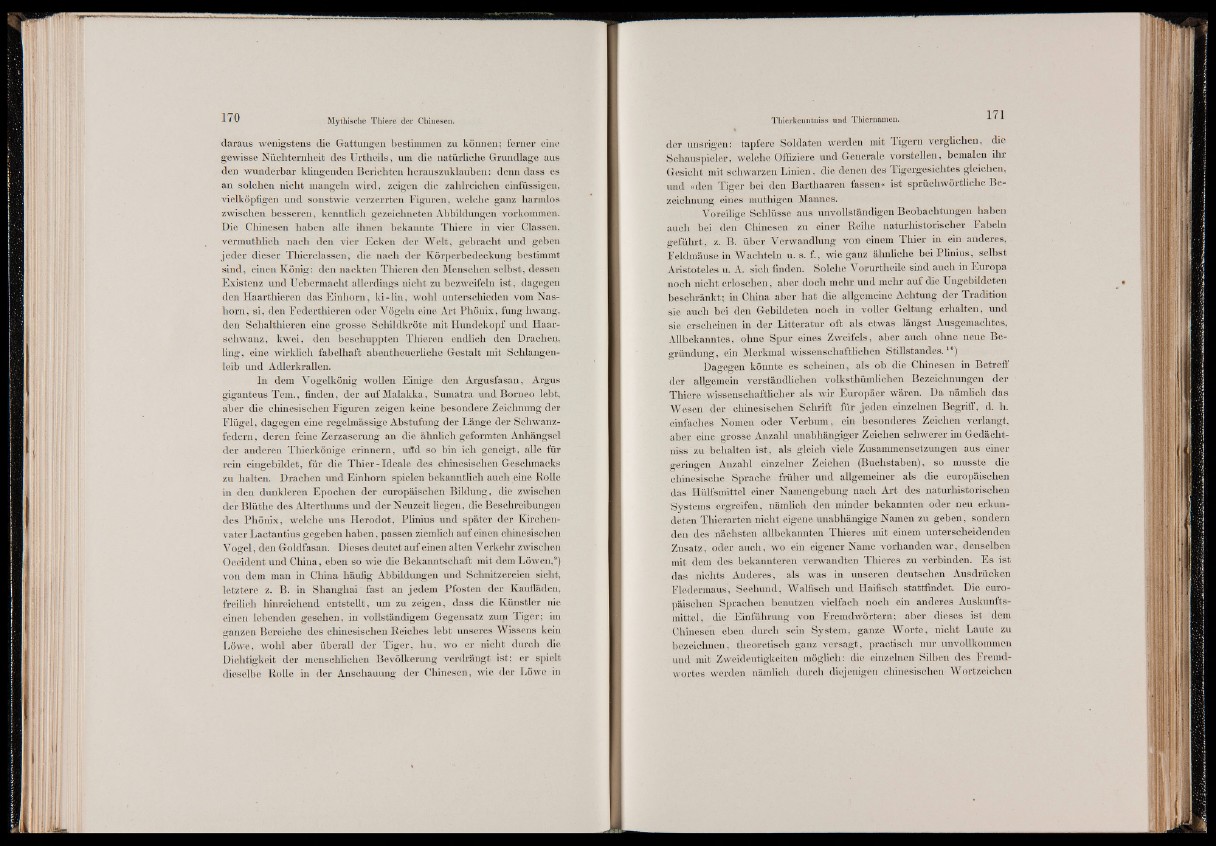
daraus wenigstens die Gattungen bestimmen zu können; ferner eine
gewisse Nüchternheit des Urtheils, um die natürliche Grundlage aus
den wunderbar klingenden Berichten herauszuklauben: denn dass es
an solchen nicht mangeln wird, zeigen die zahlreichen einfüssigen,
vielköpfigen und sonstwie verzerrten Figuren, welche ganz harmlos
zwischen besseren, kenntlich gezeichneten Abbildungen Vorkommen.
Die Chinesen haben alle ihnen bekannte Thiere in vier Classen,
vermuthlich nach den vier Ecken der Welt, gebracht und geben
jeder dieser Thierclassen, die nach der Körperbedeckung bestimmt
sind, einen König: den nackten Thieren den Menschen selbst, dessen
Existenz und Uebermaclit allerdings nicht zu bezweifeln ist, dagegen
den Haarthieren das Einhorn, ki-lin, wohl unterschieden vom Nashorn,
si, den Federthieren oder Vögeln eine Art Phönix, fung hwang,
den Schalthieren eine grosse Schildkröte mit Hundekopf und Haarschwanz,
kwei, den beschuppten Thieren endlich den Drachen,
ling, eine wirklich fabelhaft abentheuerliche Gestalt mit Schlangenleib
und Adlerkrallen.
In dem Vogelkönig wollen Einige den Argusfasan, Argus
giganteus Tem., finden, der auf Malakka, Sumatra und Borneo lebt,
aber die chinesischen Figuren zeigen keine besondere Zeichnung der
Flügel, dagegen eine regelmässige Abstufung der Länge der Schwanzfedern,
deren feine Zerzaserung an die ähnlich geformten Anhängsel
der anderen Thierkönige erinnern, uiTd so bin ich geneigt, alle für
rein eingebildet, für die Thier-Ideale des chinesischen Geschmacks
zu halten. Drachen und Einhorn spielen bekanntlich auch eine Rolle
in den dunkleren Epochen der europäischen Bildung, die zwischen
derBlüthe des Alterthums und der Neuzeit hegen, die Beschreibungen
des Phönix, welche uns Herodot, Plinius und später der Kirchenvater
Lactantius gegeben haben, passen ziemlich auf einen chinesischen
Voeel, den Goldfasan. Dieses deutet auf O ' einen alten Verkehr zwischen
Occident und China, eben so wie die Bekanntschaft mit dem Löwen,9)
von dem man in China häufig Abbildungen und Schnitzereien sieht,
letztere z. B. in Shanghai fast an jedem Pfosten der Kaufläden,
freilich hinreichend entstellt, um zu zeigen, dass die Künstler nie
einen lebenden gesehen, in vollständigem Gegensatz zum Tiger; im
ganzen Bereiche des chinesischen Reiches lebt unseres Wissens kein
Löwe, wohl aber überall der Tiger, hu, wo er nicht durch die
Dichtigkeit der menschlichen Bevölkerung verdrängt ist; er spielt
dieselbe Rolle in der Anschauung der Chinesen, wie der Löwe in
der unsrigen: tapfere Soldaten werden mit Tigern verglichen, die
Schauspieler, welche Offiziere und Generale vorstellen, bemalen ihr
Gesicht mit schwarzen Linien, die denen des Tigergesichtes gleichen,
und »den Tiger bei den Barthaaren fassen« ist sprüchwörtliche Bezeichnung
eines muthigen Mannes.
Voreilige Schlüsse aus unvollständigen Beobachtungen haben
auch bei den Chinesen zu einer Reihe naturhistorischer Fabeln
geführt, z. B. über Verwandlung von einem Thier in ein anderes,
Feldmäuse in Wachteln u. s. f., wie ganz ähnliche bei Plinius, selbst
Aristoteles u. A. sich finden. Solche Vorurtheile sind auch in Europa
noch nicht erloschen, aber doch mehr und mehr auf die Ungebildeten
beschränkt; in China aber hat die allgemeine Achtung der Tradition
sie auch bei den Gebildeten noch in voller Geltung erhalten, und
sie erscheinen in der Litteratur oft als etwas längst Ausgemachtes,
Allbekanntes, ohne Spur eines Zweifels, aber auch ohne neue Begründung,
ein Merkmal wissenschaftlichen Stillstandes.10)
Dagegen könnte es scheinen, als ob die Chinesen in Betreff
der allgemein verständlichen volksthümlichen Bezeichnungen der
Thiere wissenschaftlicher als wir Europäer wären. Da nämlich das
Wesen der chinesischen Schrift für jeden einzelnen Begriff, d. h.
einfaches Nomen oder Verbum, ein besonderes Zeichen verlangt,
aber eine grosse Anzahl unabhängiger Zeichen schwerer im Gedächt-
niss zu behalten ist, als gleich viele Zusammensetzungen aus einer
geringen Anzahl einzelner Zeichen (Buchstaben), so musste die
chinesische Sprache früher und allgemeiner als die europäischen
das Hülfsmittel einer Namengebung nach Art des naturhistorischen
Systems ergreifen, nämlich den minder bekannten oder neu erkundeten
Thierarten nicht eigene unabhängige Namen zu geben, sondern
den des nächsten allbekannten Thieres mit einem unterscheidenden
Zusatz, oder auch, wo ein eigener Name vorhanden war, denselben
mit dem des bekannteren verwandten Thieres zu verbinden. Es ist
das nichts Anderes, als was in unseren deutschen Ausdrücken
Fledermaus, Seehund, Walfisch und Haifisch stattfindet. Die europäischen
Sprachen benutzen vielfach noch ein anderes Auskunftsmittel,
die Einführung von Fremdwörtern; aber dieses ist dem
Chinesen eben durch sein System, ganze Worte, nicht Laute zu
bezeichnen, theoretisch ganz versagt, practisch nur unvollkommen
und mit Zweideutigkeiten möglich: die einzelnen Silben des Fremdwortes
werden nämlich durch diejenigen chinesischen Wortzeichen