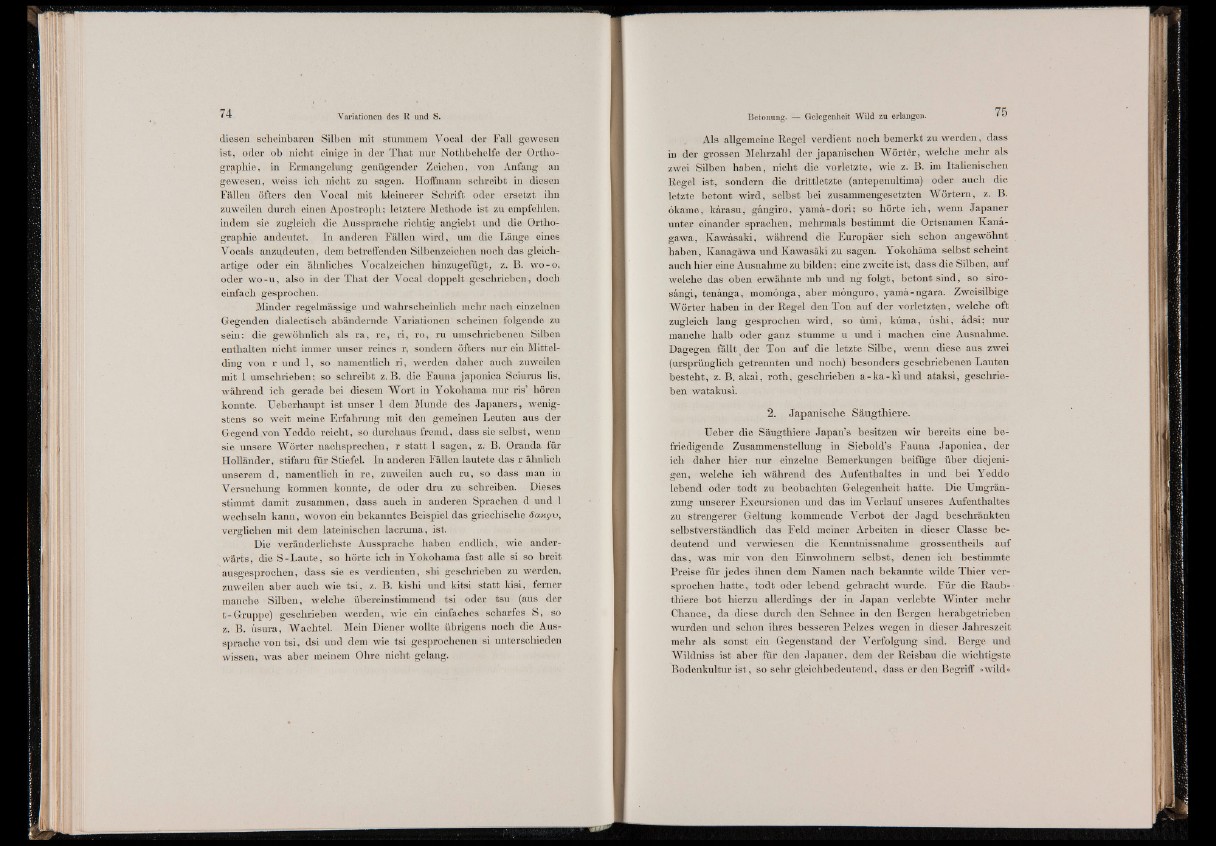
diesen scheinbaren Silben mit stummem Vocal der Fall gewesen
ist, oder ob nicht einige in der That nur Nothbehelfe der Orthographie
, in Ermangelung genügender Zeichen, von Anfang an
gewesen, weiss ich nicht zu sagen. Hoffmann schreibt in diesen
Fällen öfters den Vocal mit kleinerer Schrift oder ersetzt ihn
zuweilen durch einen Apostroph; letztere Methode ist zu empfehlen,
indem sie zugleich die Aussprache richtig angiebt und die Orthographie
andeutet. In anderen Fällen wird,, um die Länge eines
Vocals anzudeuten, dem betreffenden Silbenzeichen noch das gleichartige
oder ein ähnliches Vocalzeichen hinzugefügt, z. B. wo-o,
oder wo-u, also in der That der Vocal doppelt geschrieben, doch
einfach gesprochen.
Minder regelmässige und wahrscheinlich mehr nach einzelnen
Gegenden dialectisch abändernde Variationen scheinen folgende zu
sein: die gewöhnlich als ra, re, ri, ro, ru umschriebenen Silben
enthalten nicht immer unser reines r, sondern öfters nur ein Mittelding
von r und 1, so namentlich ri, werden daher auch zuweilen
mit 1 umschrieben; so schreibt z.B. die Fauna japónica Sciurus lis,
während ich gerade bei diesem Wort in Yokohama nur ris’ hören
konnte. Ueberhaupt ist unser 1 dem Munde des Japaners, wenigstens
so weit meine Erfahrung mit den gemeinen Leuten aus der
Gegend von Yeddo reicht, so durchaus fremd, dass sie selbst, wenn
sie unsere Wörter nachsprechen, r statt 1 sagen, z. B. Oranda für
Holländer, stifaru für Stiefel. In anderen Fällen lautete das r ähnlich
unserem d, namentlich in re, zuweilen auch ru, so dass man in
Versuchung kommen konnte, de oder dru zu schreiben. Dieses
stimmt damit zusammen, dass auch in anderen Sprachen d und l
wechseln kann, wovon ein bekanntes Beispiel das griechische d'oocp'u,
verglichen mit dem lateinischen lacruma, ist.
Die veränderlichste Aussprache haben endlich, wie anderwärts,
die S-Laute, so hörte ich in Yokohama fast alle si so breit
ausgesprochen, dass sie es verdienten, shi geschrieben zu werden,
zuweilen aber auch wie tsi, z. B. kishi und kitsi statt kisi, ferner
manche Silben, welche übereinstimmend tsi oder tsu (aus der
t-Gruppe) geschrieben werden, wie ein einfaches scharfes S, so
z. B. usura, Wachtel. Mein Diener wollte übrigens noch die Aussprache
von tsi, dsi und dem wie tsi gesprochenen si unterschieden
wissen, was aber meinem Ohre nicht gelang.
Als allgemeine Regel verdient noch bemerkt zu werden, dass
in der grossen Mehrzahl der japanischen Wortér, welche mehr als
zwei Silben haben, nicht die vorletzte, wie z. B. im Italienischen
Regel ist, sondern die drittletzte (antepenúltima) oder auch die
letzte betont wird, selbst bei zusammengesetzten Wörtern, z. B.
ókame, kárasu, gángiro, yamá-dori; so hörte ich, wenn Japaner
unter einander sprachen, mehrmals bestimmt die Ortsnamen Kaná-
gawa, Kawasaki, während die Europäer sich schon angewöhnt
haben, Kanagäwa und Kawasaki zu sagen. Yokohama selbst scheint
auch hier eine Ausnahme zu bilden; eine zweite ist, dass die Silben, auf
welche das oben erwähnte mb und ng folgt, betont sind, so siro-
sángi, tenánga, momónga, aber mónguro, yamá-ngara. Zweisilbige
Wörter haben in der Regel den Ton auf der vorletzten, welche oft
zugleich lang gesprochen wird, so úmi, küma, úshi, ádsi; nur
manche halb oder ganz stumme u und i machen eine Ausnahme.
Dagegen fällt der Ton auf die letzte Silbe, wenn diese aus zwei
(u rs p rü n g lic h getrennten und noch) besonders geschriebenen Lauten
besteht, z. B. akai, roth, geschrieben a -ka -kiund ataksi, geschrieben
watakusi.
2. Japanische Säugthiere.
Ueber die Säugthiere Japan’s besitzen wir bereits eine befriedigende
Zusammenstellung in Siebold’s Fauna Japónica, der
ich daher hier nur einzelne Bemerkungen beifüge über diejenigen,
welche ich während des Aufenthaltes in und bei Yeddo
lebend oder todt zu beobachten Gelegenheit hatte. Die Umgrän-
zung unserer Excursión en und das im Verlauf unseres Aufenthaltes
zu strengerer Geltung kommende Verbot der Jagd beschränkten
selbstverständlich das Feld meiner Arbeiten in dieser Classe bedeutend
und verwiesen die Kenntnissnahme grossentheils auf
das, was mir von den Einwohnern selbst, denen ich bestimmte
Preise für jedes ihnen dem Namen nach bekannte wilde Thier versprochen
hatte, todt oder lebend gebracht wurde. Für die Raub-
thiere bot hierzu allerdings der in Japan verlebte Winter mehr
Chance, da diese durch den Schnee in den Bergen herabgetrieben
wurden und schon ihres besseren Pelzes wegen in dieser Jahreszeit
mehr als sonst ein Gegenstand der Verfolgung sind. Berge und
Wildniss ist aber für den Japaner, dem der Reisbau die wichtigste
Bodenkultur is t, so sehr gleichbedeutend, dass er den Begriff »wild«