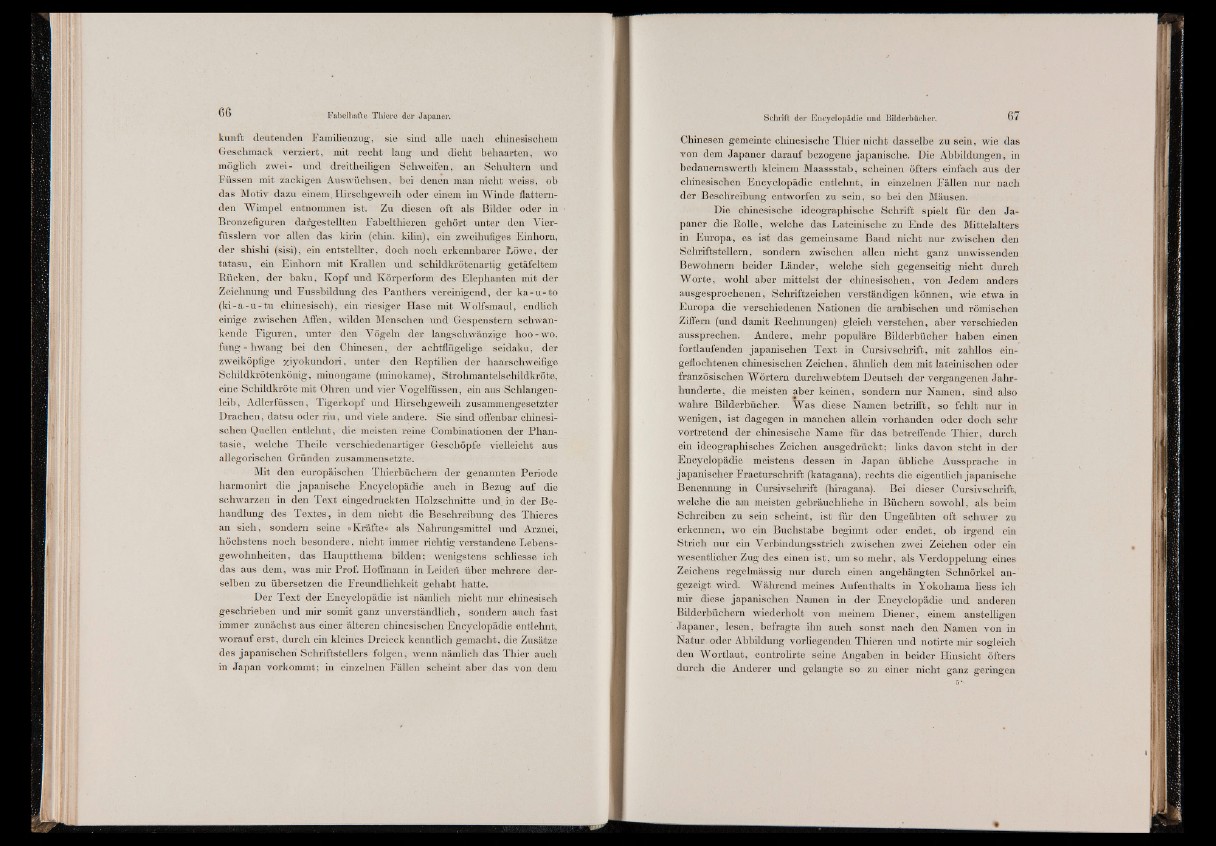
kunft deutenden Familienzug, sie sind alle nach chinesischem
Geschmack verziert, mit recht lang und dicht behaarten, wo
möglich zwei- und dreitheiligen Schweifen, an Schultern und
Füssen mit zackigen Auswüchsen, hei denen man nicht weiss, ob
das Motiv dazu einem. Hirschgeweih oder einem im "Winde flatternden
Wimpel entnommen ist. Zu diesen oft als Bilder oder in
Bronzefiguren dargestellten Fabelthieren gehört unter den Vier-
füsslern vor allen das kirin (chin. kilin), ein zweihufiges Einhorn,
der shishi (sisi), ein entstellter, doch noch erkennbarer Löwe, der
tatasu, ein Einhorn mit Krallen und schildkrötenartig getäfeltem
Rücken, der baku, Kopf und Körperform des Elephanten mit der
Zeichnung und Fussbildung des Panthers vereinigend, der ka-u-to
(k i-a -u -tu chinesisch), ein riesiger Hase mit Wolfsmaul, endlich
einige zwischen Affen, wilden Menschen und Gespenstern schwankende
Figuren, unter den Vögeln der langschwänzige hoo-wo,
fung - liwans bei den Chinesen, der achtflügehge seidaku, der O O z. O O '
zweiköpfige y.iyokundori, unter den Reptilien der haarschweifige
Schildkrötenkönig, minongame (minokame), Strohmantelschildkröte,
eine Schildkröte mit Ohren und vier Vogelfüssen, ein aus Schlangenleib,
Adlerfüssen, Tigerkopf und Hirschgeweih zusammengesetzter
Drachen, datsu oder riu, und viele andere. Sie sind offenbar chinesischen
Quellen entlehnt, die meisten reine Combinationen der Phantasie,
, welche Theile verschiedenartiger Geschöpfe vielleicht aus
allegorischen Gründen zusammensetzte.
Mil den europäischen Thierbüehem der genannten Periode
harmonirt die japanische Encyclopädie auch in Bezug auf die
schwarzen in den Text eingedruckten Holzschnitte und. in der Behandlung
des Textes, in dem nicht die Beschreibung des Thieres
an sich, sondern seine »Kräfte« als Nahrungsmittel und Arznei,
höchstens noch besondere, nicht immer richtig verstandene Lebensgewohnheiten,
das Hauptthema bilden; wenigstens schliesse ich
das aus dem, was mir Prof. Hoflmann in Leideü über mehrere derselben
zu übersetzen die Freundlichkeit gehabt hatte.
Der Text der Encyclopädie ist nämlich nicht nur chinesisch
geschrieben und mir somit ganz unverständlich, sondern auch fast
immer zunächst aus einer älteren chinesischen Encyclopädie entlehnt,
worauf erst, durch ein kleines Dreieck kenntlich gemacht, die Zusätze
des japanischen Schriftstellers folgen, wenn nämlich das Thier auch
in Japan vorkommt; in einzelnen Fällen scheint aber das von dem
Chinesen gemeinte chinesische Thier nicht dasselbe zu sein, wie das
von dem Japaner darauf bezogene japanische. Die Abbildungen, in
bedauernswerth kleinem Maassstab, scheinen öfters einfach aus der
chinesischen Encyclopädie entlehnt, in einzelnen Fällen nur nach
der Beschreibung entworfen zu sein, so bei den Mäusen.
Die chinesische ideographische Schrift spielt für den Japaner
die Rolle, welche das Lateinische zu Ende des Mittelalters
in Europa, es ist das gemeinsame Band nicht nur zwischen den
Schriftstellern, sondern zwischen allen nicht ganz unwissenden
Bewohnern beider Länder, welche sich gegenseitig nicht durch
Worte, wohl aber mittelst der chinesischen, von Jedem anders
ausgesprochenen, Schriftzeichen verständigen können, wie etwa in
Europa die verschiedenen Nationen die arabischen und römischen
Ziffern (und damit Rechnungen) gleich verstehen, aber verschieden
aussprechen. Andere, mehr populäre Bilderbücher haben einen
fortlaufenden japanischen Text in Cursivschrift, mit zahllos eingeflochtenen
chinesischen Zeichen, ähnlich dem mit lateinischen oder
französischen Wörtern durchwehtem Deutsch der vergangenen Jahrhunderte,
die meisten aber keinen, sondern nur Namen, sind also
wahre Bilderbücher. Was diese Namen betrifft, so fehlt nur in
wenigen, ist dagegen in manchen allein vorhanden oder doch sehr
vortretend der chinesische Name für das betreffende Thier, durch
ein ideographisches Zeichen ausgedrückt; links davon steht in der
Encyclopädie meistens dessen in Japan übliche Aussprache in
japanischer Fracturscbrift (katagana), rechts die eigentlich japanische
Benennung in Cursivschrift (hiragana). Bei dieser Cursivschrift,
welche die am meisten gebräuchliche in Büchern sowohl, als beim
Schreiben zu sein scheint, ist für den Ungeübten oft schwer zu
erkennen, wo ein Buchstabe beginnt oder endet, ob irgend ein
Strich nur ein Verbindungsstrich zwischen zwei Zeichen oder ein
wesentlicher Zug des einen ist, um so mehr, als Verdoppelung eines
Zeichens regelmässig nur durch einen angehängten Schnörkel angezeigt
wird. Während meines Aufenthalts in Yokohama liess ich
mir diese japanischen Namen in der Encyclopädie und anderen
Bilderbüchern wiederholt von meinem Diener, einem anstelligen
Japaner, lesen, befragte ihn auch sonst nach den Namen von in
Natur oder Abbildung vorhegenden Thieren und notirte mir sogleich
den Wortlaut, controlirte seine Angaben in beider Hinsicht öfters
durch die Anderer und gelangte so zu einer nicht ganz geringen