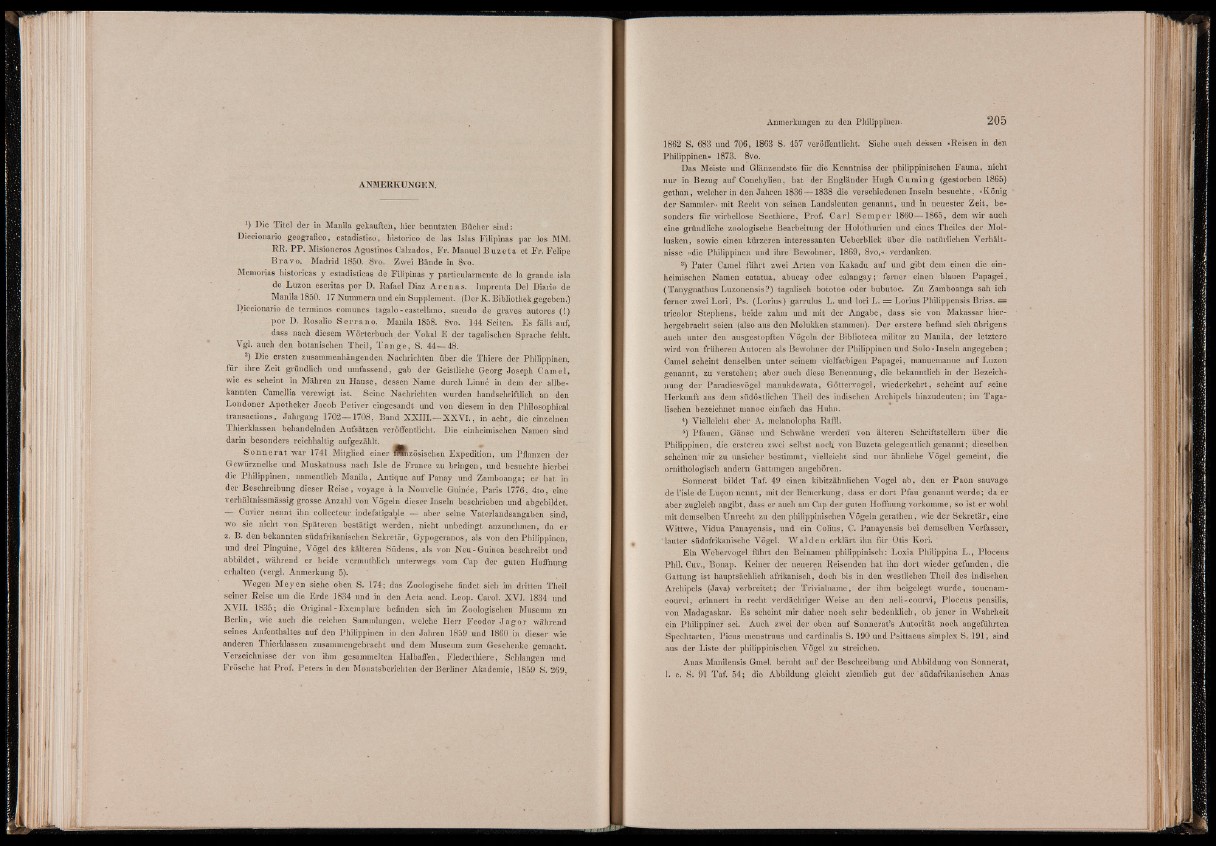
ANMERKUNGEN.
*) Die Titel der in Manila gekauften, hier benutzten Bücher sind:
Diccionario geográfico, estadistico, histórico de las Islas Filipinas par los MM.
RR. P P . Misioneros Agustinos Calzados, Fr. Manuel B u z e t a et Fr. Felipe
B r a v o . Madrid 1850. 8vo. Zwei Bände in 8vo.
Memorias históricas y estadisticas de Filipinas y particularmente de la grande isla
de Luzon escritas por D. Rafael Diaz A r e n a s . Imprenta Del Diario de
Manila 1850. 17 Nummern und ein Supplement. (Der K. Bibliothek gegeben.)
Diccionario de términos comunes tagalo - castellano, sacado de graves autores (!)
p o r D. Rosalio S e r r a n o . Manila 1858. 8vo. 144 Seiten. Es fällt auf,
dass nach diesem Wörterbuch, der Vokal E der tagalischen Sprache fehlt.
Vgl. auch den botanischen The il, T a n g e , S. 44— 48.
2) Die ersten zusammenhängenden Nachrichten über die Thiere der Philippinen,
fiir ihre Zeit gründlich und umfassend, gab der Geistliche Georg Joseph C am e l,
wie es scheint in Mähren zu Hause, dessen Name durch Linné in dem der allbekannten
Camellia verewigt ist. Seine Nachrichten wurden handschriftlich an den
Londoner Apotheker Jacob Petiver eingesandt und von diesem in den Philosophical
transactions, Jahrgang Í702— 1708, Band X X III.— X X V I., in acht, die einzelnen
Thierklassen behandelnden Aufsätzen veröffentlicht. Die einheimischen Namen sind
darin besonders reichhaltig aufgezählt.
S o n n e r a t war 1741 Mitglied einer IPfezösischen Expedition, um Pflanzen der
Gewürznelke und Muskatnuss nach Isle de France zu bringen, und besuchte hierbei
die Philippinen, namentlich Manila, Antique auf Panay und Zamboanga; er hat in
der Beschreibung dieser Reise, voyage á la Nouvelle Guinée, Paris 1776, 4 to, eine
verhältnissmässig grosse Anzahl von Vögeln dieser Inseln beschrieben und abgebildet.
: Cuvier nennt ihn collecteur indefatigable — aber seine Vaterlandsangaben sind,
wo sie nicht von Späteren bestätigt werden, nicht unbedingt anzunehmen, da er
z. B. den bekannten südafrikanischen Sekretär, Gypogeranos, als von den Philippinen,
und drei Pinguine, Vögel des kälteren Südens, als von Neu-Guinea beschreibt und
abbildet^ während er beide vermuthlich unterwegs • vom Cap der guten Hoffnung
erhalten (vergl. Anmerkung 5).
Wegen M e y e n siehe oben S. 174; das Zoologische findet sich im dritten Theil
seiner Reise um die Erde 1834 und in den Acta acad. Leop. Carol. XVI. 1834 und
XVII. 1835; die Original - Exemplare befinden sich im Zoologischen Museum zu
Berlin, wie auch die reichen Sammlungen, welche Herr Feodor J a g o r während
seines Aufenthaltes auf den Philippinen in den Jahren 1859 und 1860 in dieser wie
anderen Thierklassen zusammengebracht und dem Museum zuin Geschenke gemacht.
Verzeichnisse der von ihm gesammelten Halbaffen, Fledertliiere, Schlangen und
Frösche hat Prof. Peters in den Monatsberichten der Berliner Akademie, 1859 S. 269,
1862 S. 683 und 706, 1863 S. 457 veröffentlicht. Siehe auch dessen »Reisen in den
Philippinen« 1873. 8vo.
Das Meiste und Glänzendste für die Kenntniss der philippinischen Fauna, nicht
nur in Bezug auf Conchylien, hat der Engländer Hugh C um in g (gestorben 1865)
gethan, welcher in den Jahren 1836— 1838 die verschiedenen Inseln besuchte, »König
der Sammler« mit Recht von seinen Landsleuten genannt, und in neuester Ze it, besonders
für wirbellose Seethiere, Prof. C a r l S em p e r 1860— 1865, dem wir auch
eine gründliche zoologische Bearbeitung der Holothurien und eines Theiles der Mollusken,
sowie einen kürzeren interessanten Ueberblick über die natürlichen Verhältnisse
»die Philippinen und ihre Bewohner, 1869, 8vo,« verdanken.
3) P a te r Camel führt zwei Arten von Kakadu auf und gibt dem einen die einheimischen
Namen catatua, abucay oder calangay;- ferner einen blauen Papagei,
(Tanygnathus Luzonensis?) tagalisch bototoe oder bubutoc. Zu Zamboanga sah ich
ferner zwei Lori, P s. (Lorius) garrulus L. und lori L. = Lorius Philippensis Briss. =
tricolor Stephens, beide zahm und mit der Angabe, dass sie von Makassar hierhergebracht
seien (also aus den Molukken stammen). Der erstere befand sich übrigens
auch unter den ausgestopften Vögeln der Biblioteca militar zu Manila, der letztere
wird von früheren Autoren als Bewohner der Philippinen und Solo-Inseln angegeben;
Camel scheint denselben unter seinem vielfarbigen Papagei, manucmanuc auf Luzon
genannt, zu verstehen; aber auch diese Benennung, die bekanntlich in der Bezeichnung
der Paradiesvögel manukdewata, Göttervogel, wiederkehrt, scheint auf seine
Herkunft aus dem südöstlichen Theil des indischen Archipels hinzudeuten; im Tagalischen
bezeichnet manoc einfach das Huhn.
4) Vielleicht eher A. melanolopha Raffl.
5) Pfauen, Gänse und Schwäne werden von älteren Schriftstellern über die
Philippinen, die ersteren zwei selbst noch von Buzeta gelegentlich genannt; dieselben
scheinen'mir zu unsicher bestimmt, vielleicht sind nur ähnliche Vögel gemeint, die
ornithologisch ändern Gattungen angehören.
Sonnerat. bildet Taf. 49 einen kibitzähnlichen Vogel ab , den er Paon sauvage
de l’isle de Lugon nennt, mit der Bemerkung, dass er dort Pfau genannt werde; da er
aber zugleich angibt, dass er auch am Cap der guten Hoffnung vorkomme, so ist e r wohl
mit demselben Unrecht zu den philippinischen Vögeln gerathen, wie der Sekretär, eine
Wittwe, Vidua Panayensis, und ein Colius, C. Panayensis bei demselben Verfasser,
'lau te r südafrikanische Vögel. W a i d e n erklärt ihn für Otis Kori. '
Ein Webervögel führt den Beinamen philippinisch: Loxia Philippina L ., Ploceus
Phil. Cuv., Bonap. Keiner der neueren Reisenden hat ihn dort wieder gefunden, die
Gattung ist hauptsächlich afrikanisch, doch bis in den westlichen Theil des indischen
Archipels (Java) verbreitet; der Trivialname, der ihm beigelegt w urde, toucnam-
courvi, erinnert in recht verdächtiger Weise an den neli-courvi, Ploceus pensilis,
von Madagaskar. Es scheint mir daher noch sehr bedenklich, ob jen e r in Wahrheit
ein Philippiner sei. Auch zwei der oben auf Sonnerat’s Autorität noch angeführten
Spechtarten, Picus menstruus und cardinalis S. 190 und Psittaeus simplex S. 191, sind
aus der Liste der philippinischen Vögel zu streichen.
Anas Manilensis Gmel. beruht auf der Beschreibung und Abbildung von Sonnerat,
1'. c. S. 91 Taf. 54; die Abbildung gleicht ziemlich gut der südafrikanischen Anas