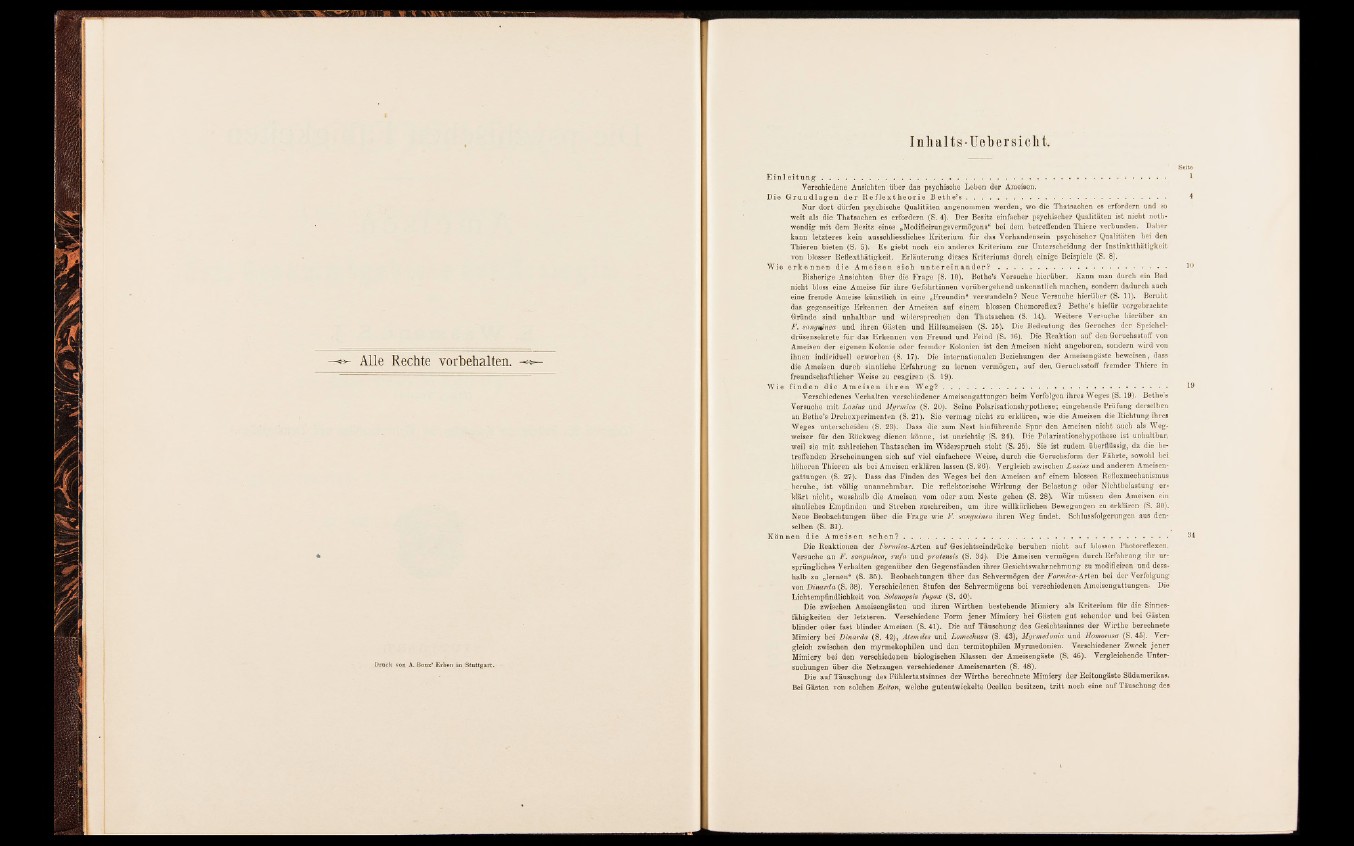
Inhal t s-Ueb ersieht.
E i n l e i t u n g ....................................................................................................................................................................................
Verschiedene Ansichten über das psychische Leben der Ameisen.
D ie G ru n d la g e n d e r R e f l e x t h e o r i e B e th e ’s .........................................................................................................
Nur dort dürfen psychische Qualitäten angenommen werden, wo die Thatsachen es erfordern und so
weit als die Thatsachen es erfordern (S. 4). Der Besitz einfacher psychischer Qualitäten ist nicht noth-
wendig mit dem Besitz eines „Modificirungsvermögens“ bei dem betreffenden Thicre verbunden. Daher
kann letzteres kein ausschliessliches Kriterium für das Vorhandensein psychischer Qualitäten bei den
Thieren bieten (S. 5). Es giebt noch ein anderes Kriterium zur Unterscheidung der Instinktthätigkeit
von blosser Reflexthätigkeit. Erläuterung dieses Kriteriums durch einige Beispiele (S. 8).
Wie e r k e n n e n d ie A m e is e n s ic h u n t e r e in a n d e r ? • ...................................................... .........................
Bisherige Ansichten über die Frage (S. 10). Bethe’s Versuche hierüber. Kann man durch ein Bad
nicht bloss eine Ameise für ihre Gefährtinnen vorübergehend unkenntlich machen, sondern dadurch auch
eine fremde Ameise künstlich in eine „Freundin“ verwandeln? Neue Versuche hierüber (S. 11). Beruht
das gegenseitige Erkennen der Ameisen auf einem blossen Chemoreflex? Bethe’s hiefür vorgebrachte
Gründe sind unhaltbar und widersprechen den Thatsachen (S. 14). Weitere Versuche hierüber an
F. sangmnea und ihren Gästen und Hilfsameisen (S. 15). Die Bedeutung des Geruches der Speicheldrüsensekrete
für das Erkennen von Freund und Feind (S. 16). Die Reaktion auf den Geruchsstoff von
Ameisen der eigenen Kolonie oder fremder Kolonien ist den Ameisen nicht angeboren, sondern wird von
ihnen individuell erworben (S. 17). Die internationalen Beziehungen der Ameisengäste beweisen, dass
die Ameisen durch sinnliche Erfahrung zu lernen vermögen, auf den Geruchsstoff fremder Thiere in
freundschaftlicher Weise zu reagiren (S. 19).
W ie f in d e n d ie A m e is e n ih r e n W e g ? .....................................................................................................................
Verschiedenes Verhalten verschiedener Ameisengattungen beim Verfolgen ihres Weges (S. 19). Bethe s
Versuche mit Lasius und Myrmica (S. 20). Seine Polarisationshypothese; eingehende Prüfung derselben
an Bethe’s Drehexperimenten (S. 21). Sie vermag nicht zu erklären, wie die Ameisen die Richtung ihres
Weges unterscheiden (S. 23). Dass die zum Nest hinführende Spur den Ameisen nicht auch als Wegweiser
für den Rückweg dienen könne, ist unrichtig (S. 24). Die Polarisationshypothese ist unhaltbar,
weil sie mit zahlreichen Thatsachen im Widerspruch steht (S. 25). Sie ist zudem überflüssig, da die betreffenden
Erscheinungen sich auf viel einfachere Weise, durch die Geruchsform der Fährte, sowohl bei
höheren Thieren als bei Ameisen erklären lassen (S. 26). Vergleich zwischen Lasius und anderen Ameisengattungen
(S. 27). Dass das Finden des Weges bei den Ameisen auf einem blossen Reflexmechanismus
beruhe, ist völlig unannehmbar. Die reflektorische Wirkung der Belastung oder Nichtbelastung erklärt
nicht, wesshalb die Ameisen vom oder.zum Neste gehen (S. 28). Wir müssen den Ameisen ein
sinnliches Empfinden und Streben zuschreiben, um ihre willkürlichen Bewegungen zu erklären (S. 30).
Neue Beobachtungen über die Frage wie F. semguinea ihren Weg findet. Schlussfolgerungen aus denselben
(S. 31).
K önnen d ie A m e is e n s e h e n ? . . ..............................................................................................................................
Die Reaktionen der Formica-Arten auf Gesichtseindrücke beruhen nicht auf blossen Photoreflexen.
Versuche an F. sangmnea, rufa und pratensis (S. 34). Die Ameisen vermögen durch Erfahrung ihr ursprüngliches
Verhalten gegenüber den Gegenständen ihrer Gesichtswahrnehmung zu modificiren und dess-
halb zu „lernen“ (S. 35). Beobachtungen über das Sehvermögen der Formica-Arten bei der Verfolgung
von Dinarda (S. 38). Verschiedenen Stufen des Sehvermögens bei verschiedenen Ameisengattungen. Die
Lichtempfindlichkeit von Solenopsis fugax (S. 40).
Die zwischen Ameisengästen und ihren Wirthen bestehende Mimicry als Kriterium für die Sinnesfähigkeiten
der letzteren. Verschiedene Form jener Mimicry bei Gästen gut sehender und bei Gästen
blinder oder fast blinder Ameisen (S. 41). Die auf Täuschung des Gesichtssinnes der Wirthe berechnete
Mimicry bei Dinarda (S, 42), Atemeies und Lomechusa (S. 43), Myrmedonia und Homoeusa (S. 45). Vergleich
zwischen den myrmekophilen und den termitophilen Mynnedonien. Verschiedener Zweck jener
Mimicry bei den verschiedenen biologischen Klassen der Ameisengäste (S. 46). Vergleichende Untersuchungen
über die Netzaugen verschiedener Ameisenarten (S. 48).
Die auf Täuschung des Fühlertastsinnes der Wirthe berechnete Mimicry der Ecitongäste Südamerikas.
Bei Gästen von solchen Eciton, welche gutentwickelte Ocellen besitzen, tritt noch eine auf Täuschung des