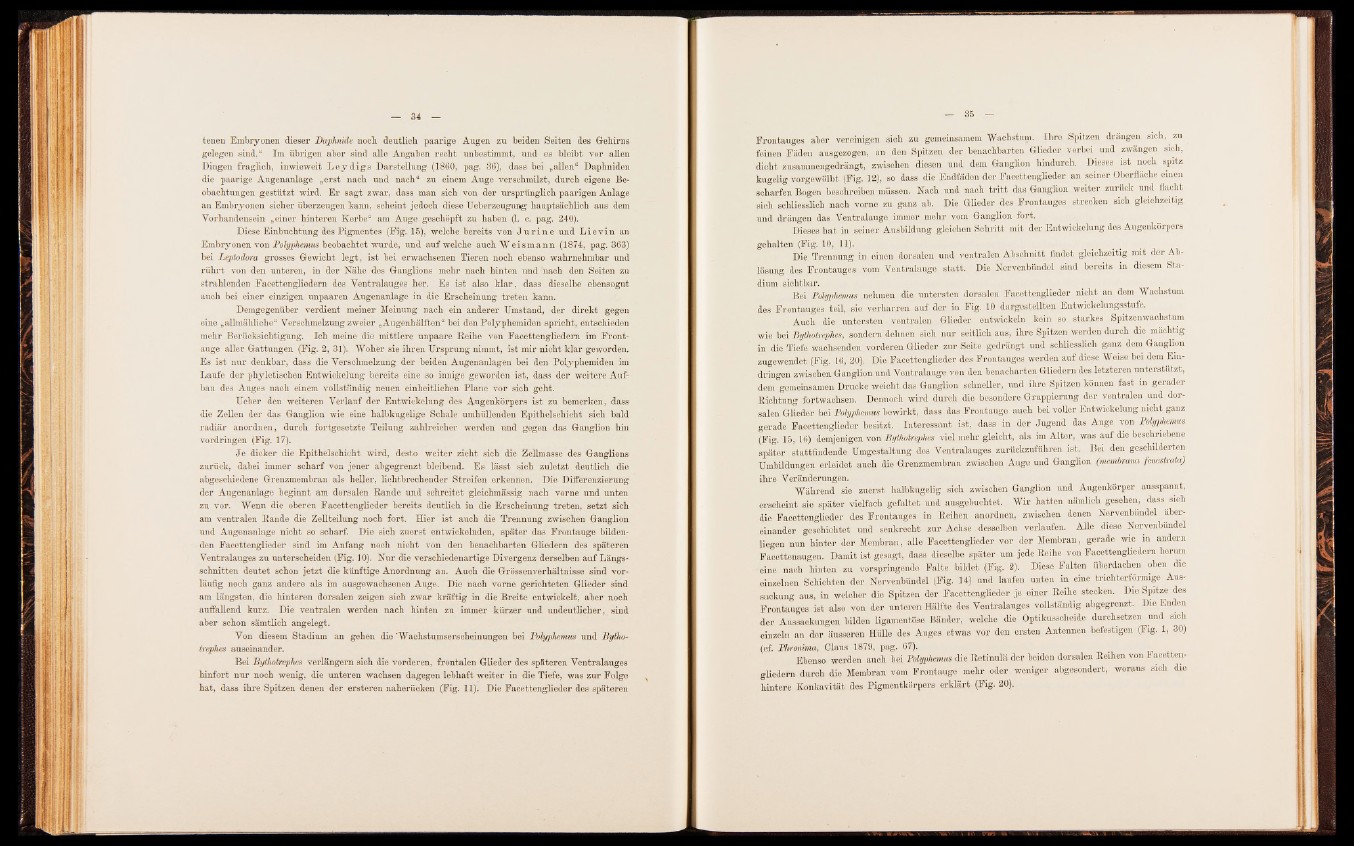
tenen Embryonen dieser JDaphnide noch deutlich paarige Augen zu beiden Seiten des Gehirns
gelegen sind.“ Im übrigen aber sind alle Angaben recht unbestimmt, und es bleibt vor allen
Dingen fraglich, inwieweit L e y d i g s Darstellung (1860, pag. 36), dass bei „allen“ Daphniden
die paarige Augenanlage „erst nach und nach“ zu einem Auge verschmilzt, durch eigene Beobachtungen
gestü tzt wird. E r sa g t zwar, dass man sich von der ursprünglich paarigen Anlage
an Embryonen sicher überzeugen kann, scheint jedoch diese Ueberzeugung hauptsächlich aus dem
Vorhandensein „einer hinteren Kerbe“ am Auge geschöpft zu haben (1. c. pag. 240).
Diese Einbuchtung des Pigmentes (Fig. 15), welche bereits von J u r i n e und L i e v i n an
Embryonen von Polyphemus beobachtet wurde, und auf welche auch W e i sm a n n (1874, pag. 363)
bei Leptodora grosses Gewicht le g t, is t bei erwachsenen Tieren noch ebenso wahrnehmbar und
rührt von den unteren, in der Nähe des Ganglions mehr nach hinten und hach den Seiten zu
strahlenden Facettengliedern des Ventralauges her. Es is t also kla r, dass dieselbe ebensogut
auch bei einer einzigen unpaaren Augenanlage in die Erscheinung treten kann.
Demgegenüber verdient meiner Meinung nach ein anderer Umstand, der direkt gegen
eine „allmähliche“ Verschmelzung zweier „Augenhälften“ bei den Polyphemiden spricht, entschieden
mehr Berücksichtigung. Ich meine die mittlere unpaare Reihe von Facettengliedern im Frontauge
aller Gattungen (Fig. 2, 31). Woher sie ihren Ursprung nimmt, is t mir nicht klar geworden.
E s is t nur denkbar, dass die Verschmelzung der. beiden Augenanlagen bei den Polyphemiden im
Laufe der phyletischen Entwickelung bereits eine so innige geworden ist, dass der weitere Aufbau
des Auges nach einem vollständig neuen einheitlichen Plane vor sich geht.
Ueber den weiteren Verlauf der Entwickelung des Augenkörpers is t zu bemerken, dass
die Zellen der das Ganglion wie eine halbkugelige Schale umhüllenden Epithelschicht sich bald
radiär anordnen, durch fortgesetzte Teilung zahlreicher werden und gegen das Ganglion hin
Vordringen (Fig. 17).
Je dicker die Epithelschicht wird, desto weiter zieht sich die Zellmasse des Ganglions
zurück, dabei immer scharf von jener abgegrenzt bleibend. Es lä sst sich zuletzt deutlich die
abgeschiedene Grenzmembran als heller, lichtbrechender Streifen erkennen. Die Differenzierung
der Augenanlage beginnt am dorsalen Rande und schreitet gleichmässig nach vorne und unten
zu vor. Wenn die oberen Facettenglieder bereits deutlich in die Erscheinung treten, setzt sich
am ventralen Rande die Zellteilung noch fort. Hier is t auch die Trennung zwischen Ganglion
und Augenanlage nicht so scharf. D ie sich zuerst entwickelnden, später das Frontauge bildenden
Facettenglieder sind im Anfang noch nicht von den benachbarten Gliedern des späteren
Ventralauges zu unterscheiden (Fig. 10). Nur die verschiedenartige Divergenz derselben auf Längsschnitten
deutet schon jetzt die künftige Anordnung an. Auch die Grössenverhältnisse sind vorläufig
noch ganz andere als im ausgewachsenen Auge. Die nach vorne gerichteten Glieder sind
am längsten, die hinteren dorsalen zeigen sich zwar kräftig in die Breite entwickelt, aber noch
auffallend kurz. D ie ventralen werden nach hinten zu immer kürzer und undeutlicher, sind
aber schon sämtlich angelegt.
Von diesem Stadium an gehen die 'Wachstumserscheinungen bei Polyphemus und Bytho-
trephes auseinander.
Bei Bythotrephes verlängern sich die vorderen, frontalen Glieder des späteren Ventralauges
hinfort nur noch wenig, die unteren wachsen dagegen lebhaft w eiter in die Tiefe, was zur Folge
hat, dass ihre Spitzen denen der ersteren naherücken (Fig. 11). Die Facettenglieder des späteren
Frontauges aber vereinigen sich zu gemeinsamem Wachstum. Ihre Spitzen drängen sich, zu
feinen Fäden ausgezpgen, an den Spitzen der benachbarten Glieder vorbei und zwängen sieh,
dicht z u s a m m e n g e d r ä n g t , zwischen diesen und dem Ganglion hindurch. Dieses is t noch spitz
kugelig vorgewölbt (Fig. 12), so dass die Endfäden der Facettenglieder an seiner Oberfläche einen
scharfen Bogen beschreiben müssen. Nach und nach tritik das Ganglion weiter zurück und flacht
sich schliesslich nach vorne zu ganz ab. Die GKeder des Frontauges strecken sich gleichzeitig
und drängen das Ventralauge immer mehr vom Ganglion fort.
Dieses hat in seiner Ausbildung gleichen Schritt mit der Entwickelung des Augenkörpers
gehalten (Fig. IQ, 11).
Die Trennung in einen dorsalen und ventralen Abschnitt findet gleichzeitig mit der Ab-
lösung des Frontauges v«m Ventralauge sta tt. D ie Nervenbündel sind bereits in diesem Stadium
sichtbar.
Bei Polyphemus nehmen die untersten dorsalen Facettenglieder nicht an dem Wachstum
des Frontauges teil, sie. verharren auf der in Fig. 10 dargestellten Entwickelungsstufe.
Auch die untersten ventralen Glieder entwickeln kein so starkes Spitzenwachstum
wie bei Bythotrephes, sondern dehnen sich nur seitlich aus, ihre Spitzen werden durch die mächtig
in die Tiefe wachsenden vorderen Glieder zur Seite gedrängt und schliesslich ganz dem Ganglion
zugewendet (Fig. 1 * 2 0 ) , Die Facettenglieder des Frontauges werden auf diese Weise bei dem Eindringen
zwischen Ganglion und Ventralauge von den benacharten Gliedern des letzteren unterstützt,
dem gemeinsamen Drucke weicht das Ganglion schneller, und ihre Spitzen können fast in gerader
Richtung fortwachsen. Dennoch wird durch die besondere Gruppierung der ventralen und dorsalen
Glieder bei Polyphemus bewirkt, dass das Frontauge auch bei voller Entwickelung nicht ganz
gerade Facettenglieder b e sitzt.^ Inte ressant i s t , . dass in der Jugend das Auge von Polyphemus
(Fig. 15, 16) demjenigen von Bythotrephes viel mehr gleicht, als im Alter, was auf die beschriebene
später stattfindende Umgestaltung des Ventralauges zurückzuführen ist. . Bei den geschilderten
Umbildungen erleidet auch die Grenzmembran zwischen Auge und Ganglion, (membnma fmestratu)
ihre Veränderungen.
Während sie zuerst halbkugelig sich zwischen Ganglion und Augenkörper ausspannt,
erscheint sie später vielfach gefaltet und ausgebuchtet. Wir hatten nämlich gesehen, dass sich
die Facettenglieder des Frontauges in R e ih e n anordnen, zwischen denen Nervenbündel übereinander
geschichtet und senkrecht zur Achse . desselben verlaufen. Alle diese Nervenbündel
liegen nun hinter der Membran, alle Facettenglieder vor der Membran, gerade wie m ändern
Facettenaugen. Damit ist g e sa g t, dass dieselbe später um jede Reihe von Facettengliedem herum
eine nach hinten .zu vorspringende F a lte bildet (Fig. 2). Diese Falten überdachen oben die
einzelnen Schichten der Nervenbündel (Fig. 14) und laufen unten in eine trichterförmige Aussackung
aus, in welcher die Spitzen der Facettenglieder je einer Reihe stecken. D ie Spitze des
Frontauges is t also von der unteren Hälfte des Ventralauges vollständig abgegrenzt. D ie Enden
der Aussackungen bilden ligamentöse Bänder, welche die Optikusscheide durchsetzen und sich
an der äusseren Hülle des Auges etwas vor den ersten Antennen befestigen (Fig. 1, 30)
(cf. Phronima, Claus 1879, pag. 67).
Ebenso werden auch hei Polyphemus die Retinulä der beiden dorsalen Reihen von Facettengliedem
durch die Membran vom Frontauge mehr oder weniger abgesondert,- woraus sich die
hintere Konkavität des Pigmentkörpers erklärt (Fig. 20).