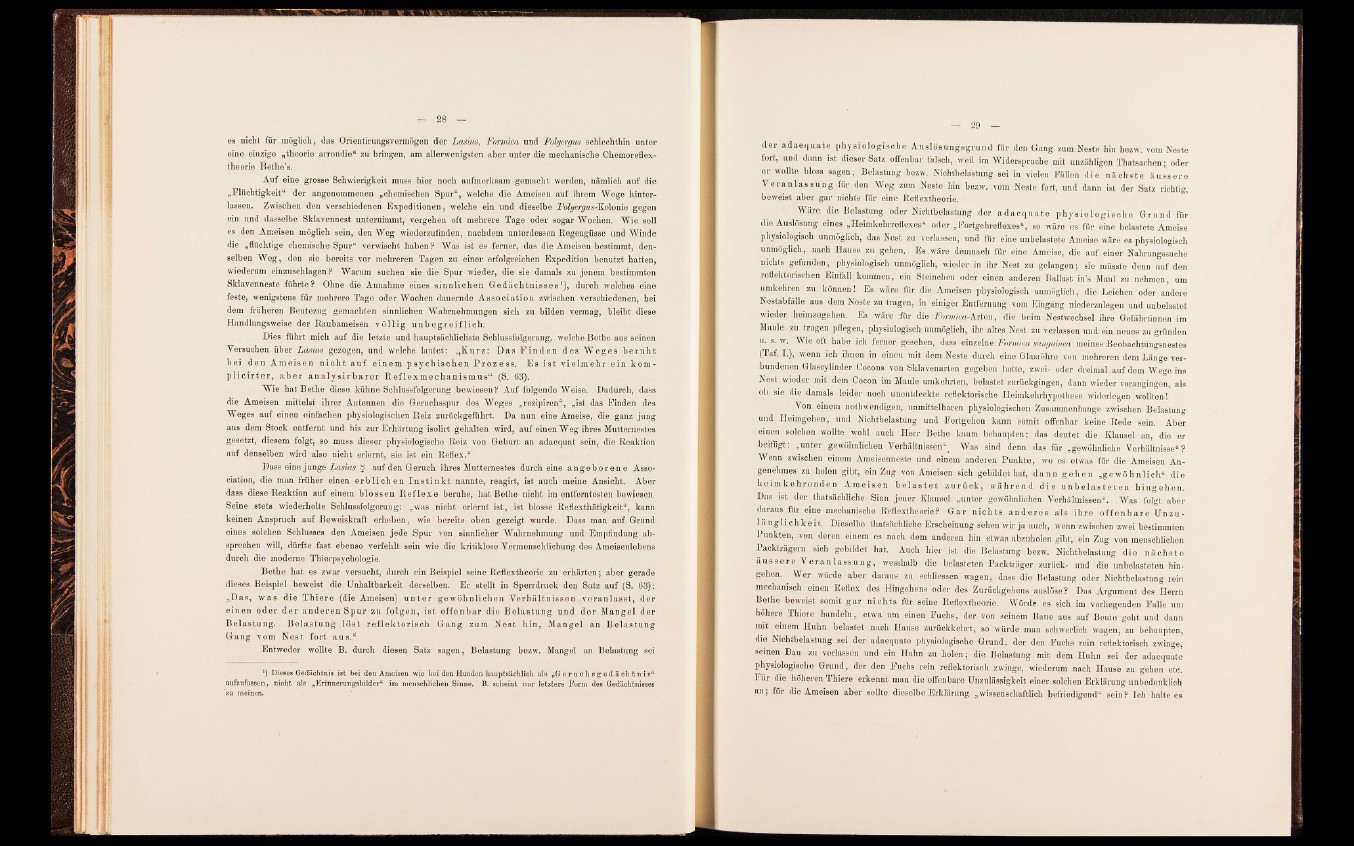
es nicht für möglich i das Orientirungsvermögen der Lasius, Formica und Polyergus schlechthin unter
eine einzige „theorie arrondie“ zu bringen, am allerwenigsten aber unter die mechanische Chemoreflex-
theorie Bethe’s.
Auf eine grosse Schwierigkeit muss hier noch aufmerksam gemacht werden, nämlich auf die
„Flüchtigkeit“ der angenommenen „chemischen Spur“, welche die Ameisen auf ihrem Wege hinterlassen.
Zwischen den verschiedenen Expeditionen, welche ein und dieselbe Polyergus-Kolonie gegen
ein und dasselbe Sklavennest unternimmt, vergehen oft mehrere Tage oder sogar Wochen. Wie soll
es den Ameisen möglich sein, den Weg wiederzufinden, nachdem unterdessen Regengüsse und Winde
die „flüchtige chemische Spur" verwischt haben? Was ist es ferner, das die Ameisen bestimmt, denselben
W eg , den sie bereits vor mehreren Tagen zu einer erfolgreichen Expedition benutzt hatten,
wiederum einzuschlagen? Warum suchen sie die Spur wieder, die sie damals zu jenem bestimmten
Sklavenneste führte? Ohne die Annahme eines s in n lic h e n G e d ä c h tn is s e s 1), durch welches eine
feste, wenigstens für mehrere Tage oder Wochen dauernde A s s o c ia t io n zwischen verschiedenen, bei
dem früheren Beutezug gemachten sinnlichen Wahrnehmungen sich zu bilden vermag, bleibt diese
Handlungsweise der Raubameisen v ö l l i g u n b e g r e i f l i c h .
Dies führt mich auf die letzte und hauptsächlichste Schlussfolgerung, welche Bethe aus seinen
Versuchen über Lasius gezogen, und welche lautet: „K u r z : D a s F in d e n d e s W e g e s b e r u h t
b e i d en A m e is e n n i c h t a u f e in em p s y c h i s c h e n P r o z e s s . E s i s t v ie lm e h r e in k om -
p l i c i r t e r , a b e r a n a ly s i r b a r e r R e f l e x m e c h a n i sm u s “ (S. 63).
Wie hat Bethe diese kühne Schlussfolgerung bewiesen? Auf folgende Weise. Dadurch, dass
die Ameisen mittelst ihrer Antennen die Geruchsspur des Weges „rezipiren“, „ist das Finden des
Weges auf einen einfachen physiologischen Reiz zurückgeführt. Da nun eine Ameise, die ganz jung
aus dem Stock entfernt und bis zur Erhärtung isolirt gehalten wird, auf einen Weg ihres Mutternestes
gesetzt, diesem folgt, so muss dieser physiologische Reiz von Geburt an adaequat sein, die Reaktion
auf denselben wird also nicht erlernt, sie ist ein Reflex.“
Dass eine junge Lasius $ auf den Geruch ihres Mutternestes durch eine a n g e b o r e n e Association,
die man früher einen e r b l i c h e n I n s t in k t nannte, reagirt, ist auch meine Ansicht. Aber
dass diese Reaktion auf einem b lo s s e n R e f l e x e beruhe, hat Bethe nicht im entferntesten bewiesen.
Seine stets wiederholte Schlussfolgerung: „was nicht erlernt ist, ist blosse Reflexthätigkeit“, kann
keinen Anspruch auf Beweiskraft erheben, wie bereits oben gezeigt wurde. Dass man auf Grund
eines solchen Schlusses den Ameisen jede Spur von sinnlicher Wahrnehmung und Empfindung absprechen
will, dürfte fast ebenso verfehlt sein wie die kritiklose Vermenschlichung des Ameisenlebens
durch die moderne Thierpsychologie.
Bethe hat es zwar versucht, durch ein Beispiel seine Reflextheorie zu erhärten; aber gerade
dieses Beispiel beweist die Unhaltbarkeit derselben. Er stellt in Sperrdruck den Satz auf (S. 63):
„Das, w a s d ie T h ie r e (die Ameisen) u n t e r g ew ö h n lic h e n V e r h ä ltn is s e n v e r a n la s s t , der
e in e n od e r d er an d e r en S pu r zu f o lg e n , is t o ffen b a r d ie B e la s tu n g und d er M än g e l der
B e la stu n g . B e la s tu n g lö s t r e fle k to r is c h G an g zum N e s t h in , M an g e l an B e la s tu n g
G an g vom N e s t fort a u s .“
Entweder wollte B. durch diesen Satz sagen, Belastung bezw. Mangel an Belastung sei
l) Dieses Gedächtnis ist bei den Ameisen wie bei den Hunden hauptsächlich als „G e r u c h s g e d ä c h t n i s “
aufzufassen, nicht als „Erinnerungsbilder“ im menschlichen Sinne. B. scheint nur letztere Form des Gedächtnisses
zu meinen.
d er a d a eq u a te p h y s io lo g is c h e A u s lö su n g sg ru n d für den Gang zum Neste hin bezw. vom Neste
fort, und dann ist dieser Satz offenbar falsch, weil im Widerspruche mit unzähligen Thatsachen; oder
er wollte bloss sagen, Belastung bezw. Nichtbelastung sei in fielen Fällen d ie n ä c h s t e ä u s s e r e
V e r a n la s s u n g für den Weg zum Neste hin bezw. vom Neste fort, und dann ist der Satz richtig,
beweist aber gar nichts für eine Reflextheorie.
Wäre die Belastung oder Nichtbelastung der a d a e q u a t e p h y s i o l o g i s c h e G ru n d für
die Auslösung eines „Heimkehrreflexes“ oder „l'orfgehrefloxes“, so wäre es für eine belastete Ameise
physiologisch unmöglich, das Nest zu verlassen, und für eine unbelastete Ameise wäre es physiologisch
unmöglich, nach Hause zu gehen. Es wäre demnach für eine Ameise, die auf einer Nahrungssuche
nichts gefunden, physiologisch unmöglich, wieder in ihr Nest zu gelangen; sie müsste denn auf den
reflektorischen Einfall kommen, ein Steinchen öder einen anderen Ballast in’s Maul zu nehmen, um
umkehren zu können! Es wäre für die Ameisen physiologisch unmöglich, die Leichen oder andere
Nestabfälle aus dem Neste zu tragen, in einiger Entfernung vom Eingang niederzulegen und unbelastet
wieder heimzugehen. Es wäre für die Formica-Arten, die beim Nestwechsel ihre Gefährtinnen im
Maule zu tragen pflegen, physiologisch unmöglich, ihr altes Nest zu verlassen und ein. neues zu gründen
u. s. w. Wie oft habe ich ferner gesehen, dass einzelne Formica sanguinea meines Beobachtungsnestes
(Taf. I.), wenn ich ihnen in einen mit dem Neste durch eine Glasröhre von mehreren dem Länge verbundenen
Glascylinder Cöcons von Sklavenarten gegeben hatte, zwei- oder dreimal auf dem Wege ins
Nest wieder mit dem Cocon im Maule umkehrten, belastet zurückgingen, dann wieder vorangingen, als
ob sie die damals leider noch unentdeckte reflektorische Heimkehrhypothese widerlegen wnlltenl lH
Von einem nothwendigen, unmittelbaren physiologischen. Zusammenhänge zwischen Belastung
(Sind Heinigehen ,jg§nd Nichtbelastung und Fortgehen kann somit offenbar keine Rede sein. Aber
einen solchen wollte wohl auch Herr Bethe kaum behaupten; das deutet die Klausel an, die er
beifügt: „unter gewöhnlichen Verhältnissen^ Was sind denn das für „gewöhnliche Verhältnisse“ ?
Wenn zwischen einem Ameisenneste und einem anderen Punkte, wo es etwas für die Ameisen Angenehmes
zu holen gibt, ein Zug von Ameisen sich gebildet hat, d a n n g e h e n „ g ew ö h n l ic h “ d ie
h e im k e h r e n d e n A m e i s e n b e la s t e t 'z u r ü c k , w ä h r e n d d i e u n b e l a s t e t e n h in g e h e n .
Das ist der thatsächliche Sinn jener Klausel „unter gewöhnlichen Verhältnissen“. Was folgt aber
daraus für eine mechanische Reflextheorie? G a r n-ichts a n d e r e s a ls ih r e ö f f e n b a r e U n z u lä
n g l i c h k e i t . Dieselbe thatsächliohe Erscheinung sehen wir ja auch, wenn zwischen zwei bestimmten
Punkten, von deren einem „es nach dem anderen hin etwas abzuholen gibt, ein Zug von menschlichen
Packträgern sich gebildet hat. Auch hier ist die.Belastung bezw. Nichtbelastung d ie n ä c h s t e
ä u s s e r e V e r a n la s s u n g , wesshalb die belasteten Packträger zurück- und die unbelasteten hingehen.
Wer würde aber daraus zu sohliessen wagen, dass die Belastung oder Nichtbelastung rein
mechanisoh einen Reflex des Hingehens oder des Zurüokgehens auBlöse? Das Argument des Herrn
Bethe beweist somit gar n ic h t s für seine Reflextheorie. Würde es sich im vorliegenden Falle um
höhere Thiere handeln, etwa um einen Fuchs, der von seinem Baue aus auf Beute geht und dann
mit einem Huhn belastet nach Hause zurückkehrt, so würde man schwerlich wagen, zu behaupten,
die Nichtbelastung sei der adaequate; physiologische Grünender den Fuchs rein reflektorisch zwinge,
seinen Bau zu verlassen und ein Huhn zu holen; die Belastung mit dem Huhn sei der adaequate
physiologische Grund, der den Fuohs rein reflektorisch zwinge, wiederum nach Hause zu gehen etc.
Für die höheren Thiere erkennt man die offenbare Unzulässigkeit einer solchen Erklärung unbedenklich
an; für die Ameisen aber sollte dieselbe Erklärung „wissenschaftlich befriedigend“ sein? Ich halte es