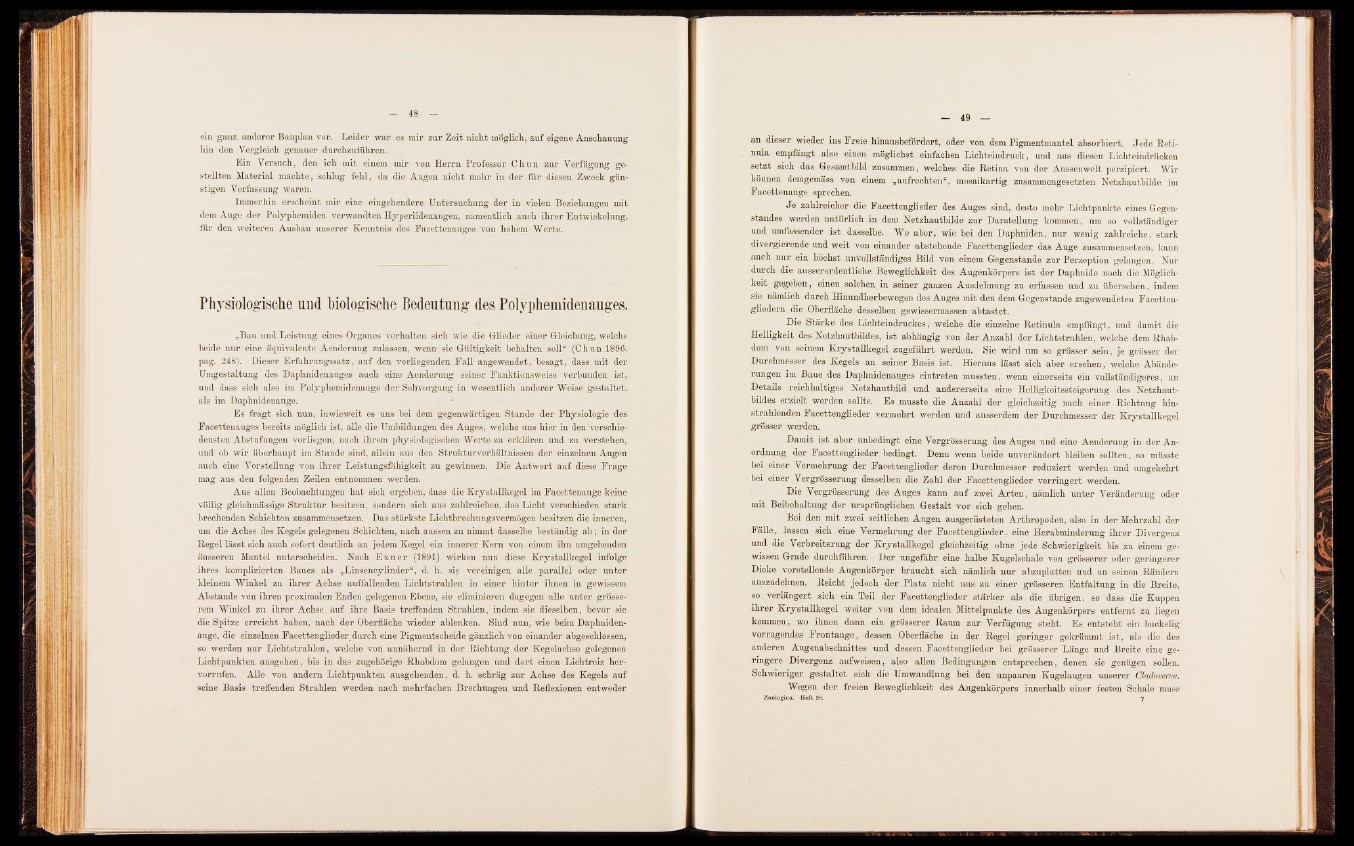
ein ganz anderer Bauplan vor. Leider war es mir zur Zeit nicht möglich, auf eigene Anschauung
hin den Vergleich genauer durchzuführen.
Ein Versuch, den ich mit einem mir von Herrn Professor C h u n zur Verfügung gestellten
Material machte, schlug feh l, da die Augen nicht mehr in der für diesen Zweck günstigen
Verfassung waren.
Immerhin erscheint mir eine eingehendere Untersuchung der in vielen Beziehungen mit
dem Auge der Polyphemiden verwandten Hyperiidenaugen, namentlich auch ihrer Entwickelung,
für den weiteren Ausbau unserer Kenntnis des Facettenauges von hohem Werte.
Physiologische und biologische Bedeutung des Polyphemidenauges.
„Bau und Leistung eines Organes verhalten sich wie die Glieder einer Gleichung, welche
beide nur eine äquivalente Aenderung zulassen, wenn sie Gültigkeit behalten so ll“ (C h u n 1896,
pag. 248). Dieser Erfahrungssatz, auf den vorliegenden F a ll angewendet, besagt, dass mit der
Umgestaltung des Daphnidenauges auch eine Aenderung seiner Funktionsweise verbunden ist,
und dass sich also im Polyphemidenauge der SehVorgang in wesentlich anderer Weise gestaltet,
als im Daphnidenauge. ■ :
Es fra g t sich nun, inwieweit es uns bei dem gegenwärtigen Stande der Physiologie des
Facettenauges bereits möglich ist, alle die Umbildungen des Auges, welche uns hier in den verschiedensten
Abstufungen vorliegen, nach ihrem physiologischen Wer te zu erklären und zu verstehen,
und ob w ir überhaupt im Stande sind, allein aus den Strukturverhältnissen der einzelnen Augen
auch eine Vorstellung von ihrer Leistungsfähigkeit zu gewinnen. D ie Antwort auf diese Frage
mag aus den folgenden Zeilen entnommen werden.
Aus allen Beobachtungen hat sich ergeben, dass die Kry sta llk eg el im Facettenauge keine
völlig gleichmässige Struktur besitzen, sondern sich aus zahlreichen, das L icht verschieden stark
brechenden Schichten zusammensetzen. Das stärkste Lichtbrechungsvermögen besitzen die inneren,
um die Achse des Kegels gelegenen Schichten, nach aussen zu nimmt dasselbe beständig a b ; in der
Regel lä sst sich auch sofort deutlich an jedem Kegel ein innerer Kern von einem ihn umgebenden
äusseren Mantel unterscheiden. Nach E x n e r (1891) wirken nun diese Krystallkegel infolge
ihres komplizierten Baues als „Linsencylinder“, d. h. sie vereinigen alle parallel oder unter
kleinem Winkel zu ihrer Achse auffallenden Lichtstrahlen in einer hinter ihnen in gewissem
Abstande von ihren proximalen Enden gelegenen Ebene, sie eliminieren dagegen alle unter grösserem
Winkel zu ihrer Achse auf ihre Basis treffenden Strahlen, indem sie dieselben, bevor sie
die Spitze erreicht haben, nach der Oberfläche wieder ablenken. Sind nun, wie beim Daphnidenauge,
die einzelnen Facettenglieder durch eine Pigmentscheide gänzlich von einander abgeschlossen,
so werden nur Lichtstrahlen, welche von annähernd in der Richtung der Kegelachse gelegenen
Lichtpunkten ausgehen, bis in das zugehörige Rhabdom gelangen und dort einen Lichtreiz hervorrufen.
A lle von ändern Lichtpunkten ausgehenden, d. h. schräg zur Achse des Kegels auf
seine Basis treffenden Strahlen werden nach mehrfachen Brechungen und Reflexionen entweder
an dieser wieder ins Freie hinausbefördert, oder von dem Pigmentmantel absorbiert. Jede Reti-
nula empfängt also einen möglichst einfachen Lichteindruck, und aus diesen Lichteindrücken
se tz t sich das Gesamtbild zusammen, welches die Retina von der Aussenwelt perzipiert. Wir
können demgemäss von einem „aufrechten“, mosaikartig zusammengesetzten Netzhautbilde im
Facettenauge sprechen.
J e zahlreicher die Facettenglieder des Auges sind, desto mehr Lichtpunkte eines Gegenstandes
werden natürlich in dem Netzhautbilde zur Darstellung kommen, um so vollständiger
und umfassender ist dasselbe. Wo aber, wie bei den Daphniden, nur wenig zahlreiche, stark
divergierende und w e it von einander abstehende Facettenglieder das Auge zusammensetzen, kann
auch nur ein höchst unvollständiges Bild von einem Gegenstände zur Perzeption gelangen. Nur
durch die ausserordentliche Beweglichkeit des Augenkörpers is t der Daphnide noch die Möglichk
e it gegeben, einen solchen in seiner ganzen Ausdehnung zu erfassen und zu übersehen, indem
sie nämlich durch Hinundherbewegen des Auges mit den dem Gegenstände zugewendeten Facettengliedern
die Oberfläche desselben gewissermassen abtastet.
D ie Stärke des Lichteindruckes, welche die einzelne Retinula empfängt, und damit die
Helligkeit des Netzhautbildes, is t abhängig von der Anzahl der Lichtstrahlen, welche dem Rhabdom
von seinem Krystallkegel zugeführt werden. Sie wird um so grösser sein, je grösser der
Durchmesser des Kegels an seiner Basis ist. Hieraus lässt sich aber ersehen, welche Abänderungen
im Baue des Daphnidenauges ein treten mussten, wenn einerseits ein vollständigeres, an
Details reichhaltiges Netzhautbild und andererseits eine Helligkeitssteigerung des Netzhautbildes
erzielt werden sollte. E s musste die Anzahl der gleichzeitig nach einer Richtung hinstrahlenden
Facettenglieder vermehrt werden und ausserdem der Durchmesser der Krystallkegel
grösser werden.
Damit is t aber unbedingt eine Vergrösserung des Auges und eine Aenderung in der Anordnung
der Facettenglieder bedingt. Denn wenn beide unverändert bleiben sollten, so müsste
bei einer Vermehrung der Facettenglieder deren Durchmesser reduziert werden und umgekehrt
bei einer Vergrösserung desselben die Zahl der Facettenglieder verringert werden.
Die Vergrösserung des Auges kann au f zwei A rten , nämlich unter Veränderung oder
mit Beibehaltung der ursprünglichen Gestalt vor sich gehen.
B e i den mit zwei seitlichen Augen ausgerüsteten Arthropoden, also in der Mehrzahl der
F ä lle , lassen sich eine Vermehrung der Facettenglieder, eine Herabminderung ihrer Divergenz
und die Verbreiterung der Krystallkegel gleichzeitig ohne jede Schwierigkeit bis zu einem g e wissen
Grade durchführen. Der ungefähr eine halbe Kugelschale von grösserer oder geringerer
Dicke vorstellende Augenkörper braucht sich nämlich nur abzuplatten und an seinen Rändern
auszudehnen. Reicht jedoch der P la tz nicht aus zu einer grösseren Entfaltung in die Breite,
so verlängert sich ein Teil der Facettenglieder stärker als die übrigen, so dass die Kuppen
ihrer Krystallkegel weiter von dem idealen Mittelpunkte des Augenkörpers entfernt zu liegen
kommen, wo ihnen dann ein grösserer Raum zur Verfügung steht. Es entsteht ein buckelig
vorragendes Frontauge, dessen Oberfläche in der Regel geringer gekrümmt is t , als die des
anderen Augenabschnittes und dessen Facettenglieder bei grösserer Länge und Breite eine geringere
Divergenz aufweisen, also allen Bedingungen entsprechen, denen sie genügen sollen.
Schwieriger g esta ltet sich die Umwandlung bei den unpaaren Kugelaugen unserer Gladoceren.
W e g e n der freien Beweglichkeit des Augenkörpers innerhalb einer festen Schale muss
Zo o lo g ic a. H e f t 28. 7