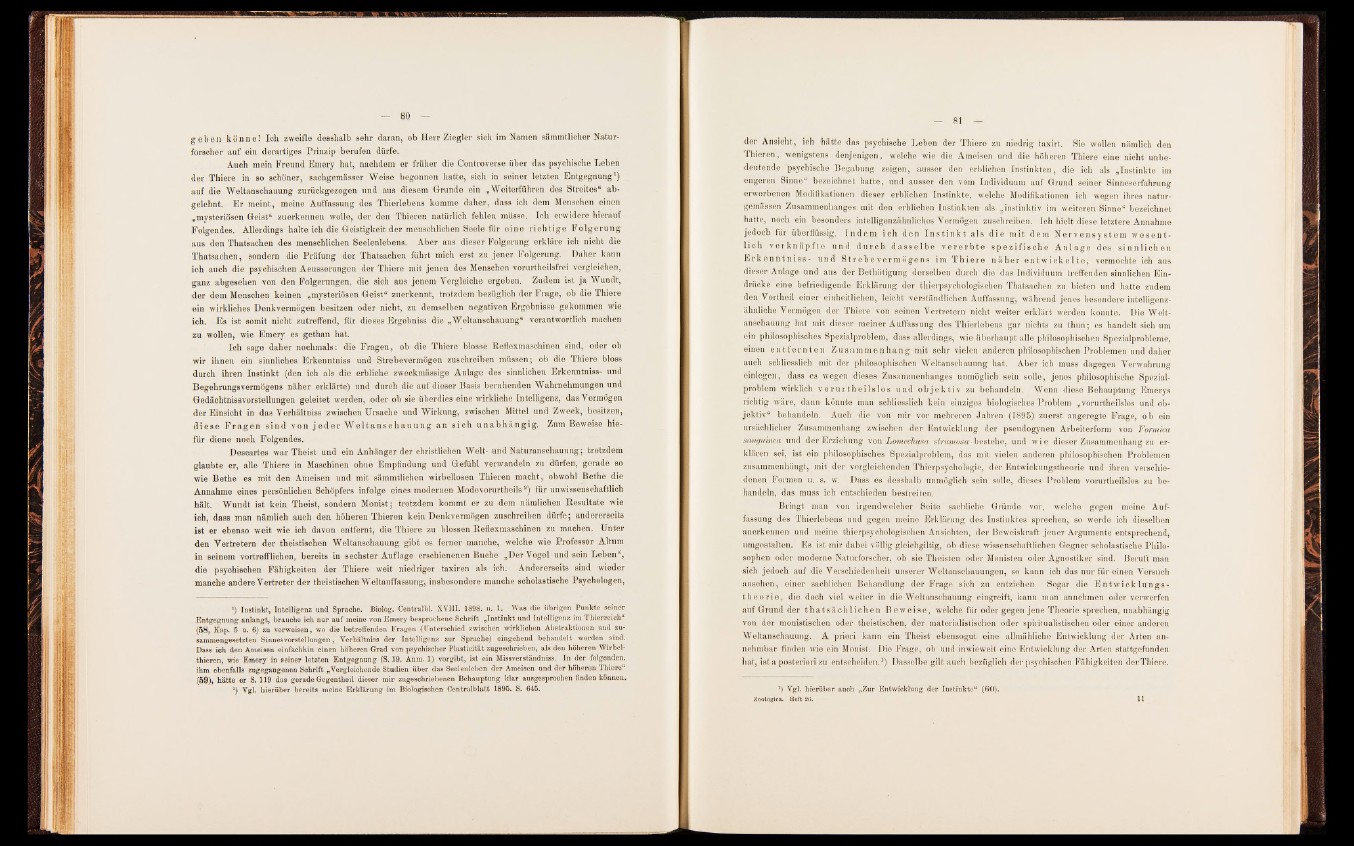
g e b e n k ö n n e ! Ich zweifle desshalb sehr daran, ob Herr Ziegler sieh im Namen sämmtlicher Naturforscher
auf ein derartiges Prinzip berufen dürfe.
Auch mein Freund Emery hat, nachdem er früher die Controverse über das psychische Leben
der Thiere in so schöner, sachgemässer Weise begonnen hatte, sich in seiner letzten Entgegnung1)
auf die Weltanschauung zurückgezogen und aus diesem Grunde ein „Weiterführen des Streites“ abgelehnt.
Er meint, meine Auffassung des Thierlebens komme daher, dass ich dem Menschen einen
„mysteriösen Geist“ zuerkennen wolle, der den Thieren natürlich fehlen müsse. Ich erwidere hierauf
Folgendes. Allerdings halte ich die Geistigkeit der menschlichen Seele für e in e r ic h t ig e F o lg e r u n g
aus den Thatsachen des menschlichen Seelenlebens. Aber aus dieser Folgerung erkläre ich nicht die
Thatsachen, sondern die Prüfung der Thatsachen führt mich erst zu jener Folgerung. Daher kann
ich auch die psychischen Aeusserungen der Thiere mit jenen des Menschen vorurtheilsfrei vergleichen,
ganz abgesehen von den Folgerungen, die sich aus jenem Yergleiche ergeben. Zudem ist ja Wundt,
der dem Menschen keinen „mysteriösen Geist" zuerkennt, trotzdem bezüglich der Frage, ob die Thiere
ein wirkliches Denkvermögen besitzen oder nicht, zu demselben negativen Ergebnisse gekommen wie
ich. Es ist somit nicht zutreffend, für dieses Ergebniss die „Weltanschauung“ verantwortlich machen
zu wollen, wie Emery es gethan hat.
Ich sage daher nochmals: die Fragen, ob die Thiere blosse Reflexmaschinen sind, oder ob
wir ihnen ein sinnliches Erkenntniss und Strebevermögen zuschreiben müssen; ob die Thiere bloss
durch ihren Instinkt (den ich als die erbliche zweckmässige Anlage des sinnlichen Erkenntniss- und
Begehrungsvermögens näher erklärte) und durch die auf dieser Basis beruhenden Wahrnehmungen und
Gedächtnissvorstellungen geleitet werden, oder ob sie überdies eine wirkliche Intelligenz, das Yermögen
der Einsicht in das Yerhältniss zwischen Ursache und Wirkung, zwischen Mittel und Zweck, besitzen,
d i e s e F r a g e n s in d v o n j e d e r W e l t a n s c h a u u n g an s ic h u n a b h ä n g ig . Zum Beweise hie-
für diene nocli Folgendes.
Descartes war Theist und ein Anhänger der christlichen Welt- und Naturanschauung; trotzdem
glaubte er, alle Thiere in Maschinen ohne Empfindung und Gefühl verwandeln zu dürfen, gerade so
wie Bethe es mit den Ameisen und mit sämmtlichen wirbellosen Thieren macht, obwohl Bethe die
Annahme eines persönlichen Schöpfers infolge eines modernen Modevorurtheils2) für unwissenschaftlich
hält. Wundt ist kein Theist, sondern Monist; trotzdem kommt er zu dem nämlichen Resultate wie
ich, dass man nämlich auch den höheren Thieren kein Denkvermögen zuschreiben dürfe; andererseits
ist er ebenso weit wie ich davon entfernt, die Thiere zu blossen Reflexmaschinen zu machen. Unter
den Yertretern der theistischen Weltanschauung gibt es ferner manche, welche wie Professor Altum
in seinem vortrefflichen, bereits in sechster Auflage erschienenen Buche „Der Vogel und sein Leben“,
die psychischen Fähigkeiten der Thiere weit niedriger taxiren als ich. Andererseits sind wieder
manche andere Vertreter der theistischen Weltauffassung, insbesondere manche scholastische Psychologen,
1) Instinkt, Intelligenz und Sprache. Biolog. Centralbl. XVIII. 1898. n. 1. Was die übrigen Punkte seiner
Entgegnung anlangt, brauche ich nur auf meine von Emery besprochene Schrift „Instinkt und Intelligenz im Thierreich“
(58, Kap. 5 u. 6) zu verweisen, wo die betreffenden Fragen (Unterschied zwischen wirklichen Abstraktionen und zusammengesetzten
Sinnesvorstellungen, Verhältniss der Intelligenz zur Sprache) eingehend behandelt worden sind.
Dass ich den Ameisen einfachhin einen höheren Grad von psychischer Plasticität zugeschrieben, als den höheren Wirbel-
thieren, wie Emery in seiner letzten Entgegnung (S. 19. Anm. 1) vorgibt, ist ein Missverständniss. In der folgenden,
ihm ebenfalls zugegangenen Schrift „Vergleichende Studien über das Seelenleben der Ameisen und der höheren Thiere“
(59), hätte er S. 119 das gerade Gegentheil dieser mir zugeschriebenen Behauptung klar ausgesprochen finden können.
2) Vgl. hierüber bereits meine Erklärung im Biologischen Centralblatt 1895. S. 645.
H 81 —
der Ansicht, ich hätte das psychische Leben der Thiere zu niedrig taxirt. Sie wollen nämlich den
Thieren, wenigstens denjenigen, welche wie die Ameisen und die höheren Thiere eine nicht unbedeutende
'psychische Begabung zeigen, ausser den erblichen Instinkten, die ich als „Instinkte im
engeren Sinne“ bezeichnet hatte, und ausser den vom Individuum auf Grund seiner Sinneserfahrung
erworbenen Modifikationen dieser erblichen Instinkte, welche Modifikationen ich wegen ihres natur-
gemässen Zusammenhanges mit den erblichen Instinkten als „instinktiv im weiteren Sinne“ bezeichnet
hatte, noch ein besonders intelligenzähnliches Vermögen zuschreiben. Ich hielt diese letztere Annahme
jedoch für überflüssig. In d em ic h d en I n s t in k t a ls d i e m it dem N e r v e n s y s t em w e s e n t l
i c h v e r k n ü p f t e und d u r ch d a s s e lb e v e r e r b t e s p e z i f i s c h e A n la g e des s in n l i c h e n
E r k e n n t n i s s - und S t r e b e v e rm ö g e n s im T h ie r e n ä h e r e n tw i c k e l t e , vermochte ich aus
dieser Anlage und aus der Bethätigung derselben durch die das Individuum treffenden sinnlichen Eindrücke
eine befriedigende Erklärung der thierpsychologischen Thatsachen zu bieten und hatte zudem
den Vorth eil einer einheitlichen, leicht verständlichen Auffassung, während jenes besondere intelligenzähnliche
Vermögen der Thiere von seinen Vertretern nicht weiter erklärt werden konnte. Die Weltanschauung
hat mit dieser meiner Auffassung des Thierlebens gar nichts zu thun; es handelt sich um
ein philosophisches Spezialproblem, dass allerdings, wie überhaupt alle philosophischen Spezialprobleme,
einen e n t f e r n t e n Z u s am m e n h a n g mit sehr vielen anderen philosophischen Problemen und daher
auch schliesslich mit der philosophischen Weltanschauung hat. Aber ich muss dagegen Verwahrung
einlegen, dass es wegen dieses Zusammenhanges unmöglich sein solle, jenes philosophische Spezialproblem
wirklich v o r u r t h e i l s lo s u nd o b j e k t iv zu behandeln. Wenn diese Behauptung Emerys
richtig wäre, dann könnte man schliesslich kein einziges biologisches Problem „vorurtheilslos und objektiv“
behandeln. Auch die von mir vor mehreren Jahren (1895) zuerst angeregte Frage, ob ein
ursächlicher Zusammenhang zwischen der Entwicklung der pseudogynen Arbeiterform von Formica
sanguinea und der Erziehung von Lomechusa stmmosa.'bestehe, und w ie dieser Zusammenhang zu erklären
sei, ist ein philosophisches Spezialproblem,, das mit vielen anderen philosophischen Problemen
zusammenhängt, mit der vergleichenden Thierpsychologie, der Entwickungstheorie und ihren verschiedenen
Formen u. s. w. Dass es desshalb unmöglich sein solle, dieses Problem vorurtheilslos zu behandeln,
das muss ich entschieden bestreiten.
Bringt man von irgendwelcher Seite sachliche Gründe vor, welche gegen meine Auffassung
des Thierlebens und gegen meine Erklärung des Instinktes sprechen, so werde ich dieselben
anerkennen und meine thierpsychologischen Ansichten, der Beweiskraft jener Argumente entsprechend,
umgestalten. Es ist mir dabei völlig gleichgiltig, ob diese wissenschaftlichen Gegner scholastische Philosophen
oder moderne Naturforscher, ob sie Theisten oder Monisten oder Agnostiker sind. Beruft man
sich jedoch auf die Verschiedenheit unserer Weltanschauungen, so kann ich das nur für einen Versuch
ansehen, einer sachlichen Behandlung der Frage sich zu entziehen. Sogar die E n tw i c k lu n g s t
h e o r i e , die doch viel weiter in die Weltanschauung eingreift, kann man annehmen oder verwerfen
auf Grund der t h a t s ä c h l i c h e n B e w e i s e , welche für oder gegen jene Theorie sprechen, unabhängig
von der monistischen oder theistischen, der materialistischen oder spiritualistischen oder einer anderen
Weltanschauung. A priori kann ein Theist ebensogut eine allmähliche Entwicklung der Arten annehmbar
finden wie ein Monist. Die Frage, ob und inwieweit eine Entwicklung der Arten stattgefunden
hat, ist a posteriori zu entscheiden.1) Dasselbe gilt auch bezüglich der psychischen Fähigkeiten derThiere.
■ Vgl- hierüber auch „Zur Entwicklung der Instinkte“ ((50).
Zo o lo g ic a. H e ft 26.