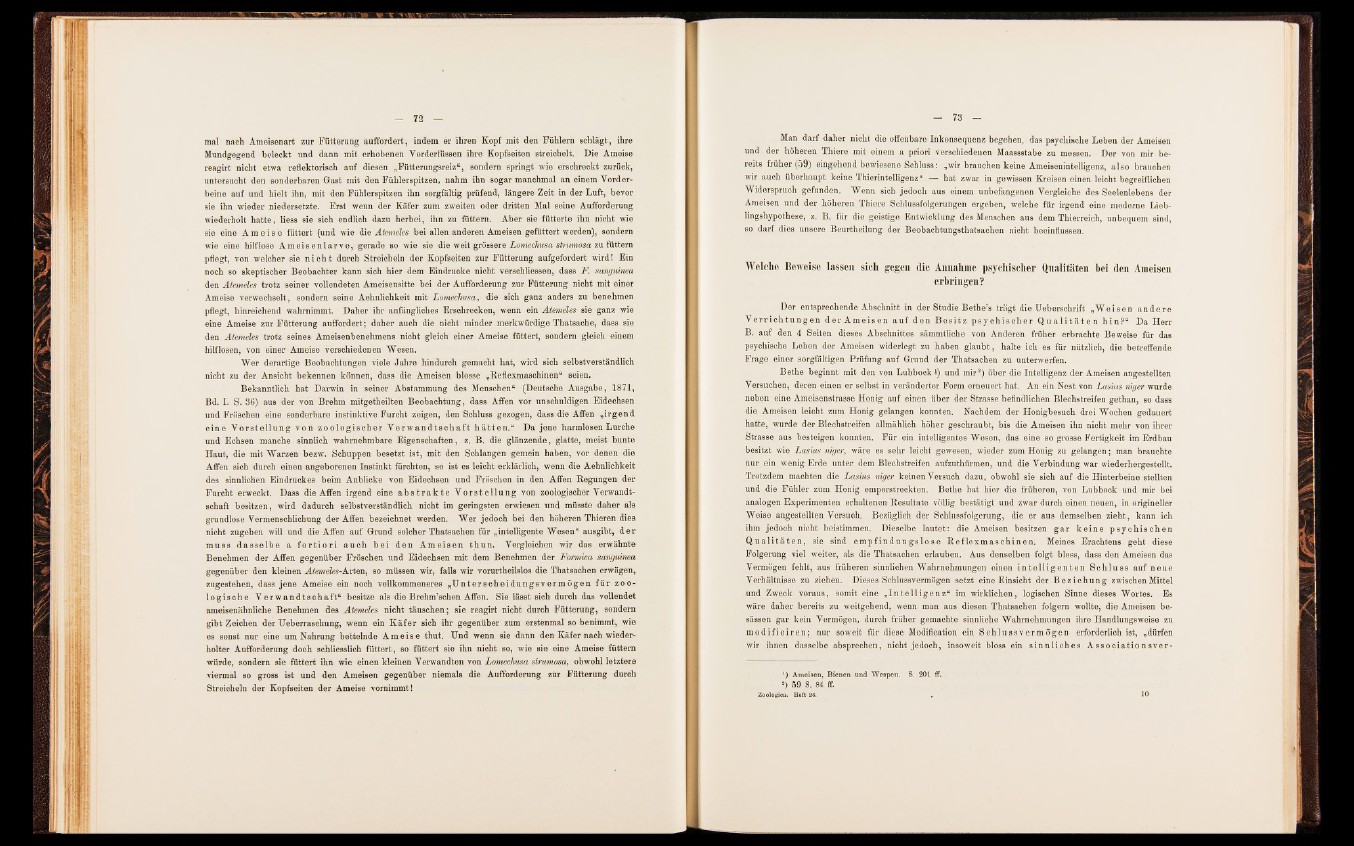
mal nach Ameisenart zur Fütterung auffordert, indem er ihren Kopf mit den Fühlern schlägt, ihre
Mundgegend beleckt und dann mit erhobenen Vorderfüssen ihre Kopfseiten streichelt. Die Ameise
reagirt nicht etwa reflektorisch auf diesen „Fütterungsreiz“, sondern springt wie erschreckt zurück,
untersucht den sonderbaren Gast mit den Fühlerspitzen, nahm ihn sogar manchmal an einem Vorderbeine
auf und hielt ihn, mit den Fühlerspitzen ihn sorgfältig prüfend, längere Zeit in der Luft, bevor
sie ihn wieder niedersetzte. Erst wenn der Käfer zum zweiten oder dritten Mal seine Aufforderung
wiederholt hatte, liess sie sich endlich dazu herbei, ihn zu füttern. Aber sie fütterte ihn nicht wie
sie eine A m e i s e füttert (und wie die Atemeies bei allen anderen Ameisen gefüttert werden), sondern
wie eine hilflose A m e i s e n la r v e , gerade so wie sie die weit grössere Lomechusa strumosa zu füttern
pflegt, von welcher sie n i c h t durch Streicheln der Kopfseiten zur Fütterung aufgefordert wird! Ein
noch so skeptischer Beobachter kann sich hier dem Eindrücke nicht verschliessen, dass F . sanguinea
den Atemeies trotz seiner vollendeten Ameisensitte bei der Aufforderung zur Fütterung nicht mit einer
Ameise verwechselt, sondern seine Aehnlichkeit mit Lomechusa, die sich ganz anders zu benehmen
pflegt, hinreichend wahrnimmt. Daher ihr anfängliches Erschrecken, wenn ein Atemeies sie ganz wie
eine Ameise zur Fütterung auffordert; daher auch die nicht minder merkwürdige Thatsache, dass sie
den Atemeies trotz seines Ameisenbenehmens nicht gleich einer Ameise füttert, sondern gleich einem
hilflosen, von einer Ameise verschiedenen Wesen.
Wer derartige Beobachtungen viele Jahre hindurch gemacht hat, wird sich selbstverständlich
nicht zu der Ansicht bekennen können, dass die Ameisen blosse „Reflexmaschinen“ seien.
Bekanntlich hat Darwin in seiner Abstammung des Menschen“ (Deutsche Ausgabe, 1871,
Bd. I. S. 36) aus der von Brehm mitgetheilten Beobachtung, dass Affen vor unschuldigen Eidechsen
und Fröschen eine sonderbare instinktive Furcht zeigen, den Schluss gezogen, dass die Affen „ irgend
e in e V o r s t e llu n g v o n z o o l o g i s c h e r V e r w a n d t s c h a f t h ä t t e n .“ Da jene harmlosen Lurche
und Echsen manche sinnlich wahrnehmbare Eigenschaften, z. B. die glänzende, glatte, meist bunte
Haut, die mit Warzen bezw. Schuppen besetzt ist, mit den Schlangen gemein haben, vor denen die
Affen sich durch einen angeborenen Instinkt fürchten, so ist es leicht erklärlich, wenn die Aehnlichkeit
des sinnlichen Eindruckes beim Anblicke von Eidechsen und Fröschen in den Affen Regungen der
Furcht erweckt. Dass die Affen irgend eine a b s t r a k t e V o r s t e l l u n g von zoologischer Verwandtschaft
besitzen, wird dadurch selbstverständlich nicht im geringsten erwiesen und müsste daher als
grundlose Vermenschlichung der Affen bezeichnet werden. Wer jedoch bei den höheren Thieren dies
nicht zugeben will und die Affen auf Grund solcher Thatsachen für „intelligente Wesen“ ausgibt, d e r
m u s s d a s s e lb e a f o r t i o r i a u c h b e i d e n A m e i s e n th u n . Vergleichen wir das erwähnte
Benehmen der Affen gegenüber Fröschen und Eidechsen mit dem Benehmen der Formica sanguinea
gegenüber den kleinen Atemeles-Axten, so müssen wir, falls wir vorurtheilslos die Thatsachen erwägen,
zugestehen, dass jene Ameise ein noch vollkommeneres „ U n t e r s c h e id u n g s v e rm ö g e n fü r z o o l
o g i s c h e V e r w a n d t s c h a f t “ besitze als die Brehm’schen Affen. Sie lässt sich durch das vollendet
ameisenähnliche Benehmen des Atemeies nicht täuschen; sie reagirt nicht durch Fütterung, sondern
gibt Zeichen der Ueberraschung, wenn ein K ä fe r sich ihr gegenüber zum erstenmal so benimmt, wie
es sonst nur eine um Nahrung bettelnde A m e i s e thut. Und wenn sie dann den Käfer nach wiederholter
Aufforderung doch schliesslich füttert, so füttert sie ihn nicht so, wie sie eine Ameise füttern
würde, sondern sie füttert ihn wie einen kleinen Verwandten von Lomechusa strumosa, obwohl letztere
viermal so gross ist und den Ameisen gegenüber niemals die Aufforderung zur Fütterung durch
Streicheln der Kopfseiten der Ameise vornimmt!
Man darf daher nicht die offenbare Inkonsequenz begehen, das psychische Leben der Ameisen
und der höheren Thiere mit einem a priori verschiedenen Maassstabe zu messen. Der von mir bereits
früher (59) eingehend bewiesene Schluss: „wir brauchen keine Ameisenintelligenz, a lso brauchen
wir auch überhaupt keine Thierintelligenz“ — hat zwar in gewissen Kreisen einen leicht begreiflichen
Widerspruch gefunden. Wenn sich jedoch aus einem unbefangenen Vergleiche des Seelenlebens der
Ameisen und der höheren Thiere Schlussfolgerungen ergeben, welche für irgend eine moderne Lieb-
lingshypothese, z. B. für die geistige Entwicklung des Menschen aus dem Thierreich, unbequem sind,
so darf dies unsere Beurtheilung der Beobachtungsthatsachen nicht beeinflussen.
Welche Beweise lassen sich gegen die Annahme psychischer Qualitäten bei den Ameisen
erbringen?
Der entsprechende Abschnitt in der Studie Bethe’s trägt die Ueberschrift „W e is e n a n d e r e
V e r r i c h t u n g e n d e r A m e is e n a u f d en B e s i t z p s y c h i s c h e r Q u a l i t ä t e n h in ? “ Da Herr
B. auf den 4 Seiten dieses Abschnittes sämmtliche von Anderen früher erbrachte Beweise für das
psychische Leben der Ameisen widerlegt zu haben glaubt, halte ich es für nützlich, die betreffende
Frage einer sorgfältigen Prüfung auf Grund der Thatsachen zu unterwerfen.
Bethe beginnt mit den von LubbockJ) und mir2) über die Intelligenz der Ameisen angestellten
Versuchen, deren einen er selbst in veränderter Form erneuert hat. An ein Nest von Lasius niger wurde
neben eine Ameisenstrasse Honig auf einen über der Strasse befindlichen Blechstreifen gethan, so dass
die Ameisen leicht zum Honig gelangen konnten. Nachdem der Honigbesuch drei Wochen gedauert
hatte, wurde der Blechstreifen allmählich höher geschraubt, bis die Ameisen ihn nicht mehr von ihrer
Strasse, aus besteigen konnten. Für ein intelligentes Wesen, das eine so grosse Fertigkeit im Erdbau
besitzt wie Lasius niger, wäre es sehr leicht gewesen, wieder zum Honig zu gelangen; man brauchte
nur ein wenig Erde unter dem Blechstreifen aufzuthürmen, und die Verbindung war wiederhergestellt.
Trotzdem machten die Lasius niger keinen Versuch dazu, obwohl sie sich auf die Hinterbeine stellten
und die Fühler zum Honig emporstreckten. Bethe hat hier die früheren, von Lubbock und mir bei
analogen Experimenten erhaltenen Resultate völlig bestätigt und zwar durch einen neuen, in origineller
Weise angestellten Versuch. Bezüglich der Schlussfolgerung, die er aus demselben zieht, kann ich
ihm jedoch nicht beistimmen. Dieselbe lautet: die Ameisen besitzen g a r k e in e p s y c h i s c h e n
Q u a l i t ä t e n , sie sind em p f in d u n g s lo s e R e f le xm a s c h in e n . Meines Erachtens geht diese
Folgerung viel weiter, als die Thatsachen erlauben. Aus denselben folgt bloss, dass den Ameisen das
Vermögen fehlt, aus früheren sinnlichen Wahrnehmungen einen i n t e l l i g e n t e n S c h lu s s auf n eu e
Verhältnisse zu ziehen. Dieses Schlussvermögen setzt eine Einsicht der B e z i e h u n g zwischen Mittel
und Zweck voraus, somit eine „ I n t e l l i g e n z “ im wirklichen, logischen Sinne dieses Wortes. Es
wäre daher bereits zu weitgehend, wenn man aus diesen Thatsachen folgern wollte, die Ameisen be-
sässen gar kein Vermögen, durch früher gemachte sinnliche Wahrnehmungen ihre Handlungsweise zu
m o d i f i c i r e n ; nur soweit für diese Modification ein S c h lu s s v e rm ö g e n erforderlich ist, „dürfen
wir ihnen dasselbe absprechen, nicht jedoch, insoweit bloss ein s in n l i c h e s A s s o c i a t io n s v e r -
l) Ameisen, Bienen und Wespen. S. 201 ff.
a) 59 S. 84 ff.
Zo o lo g ic a. H e ft 26. .