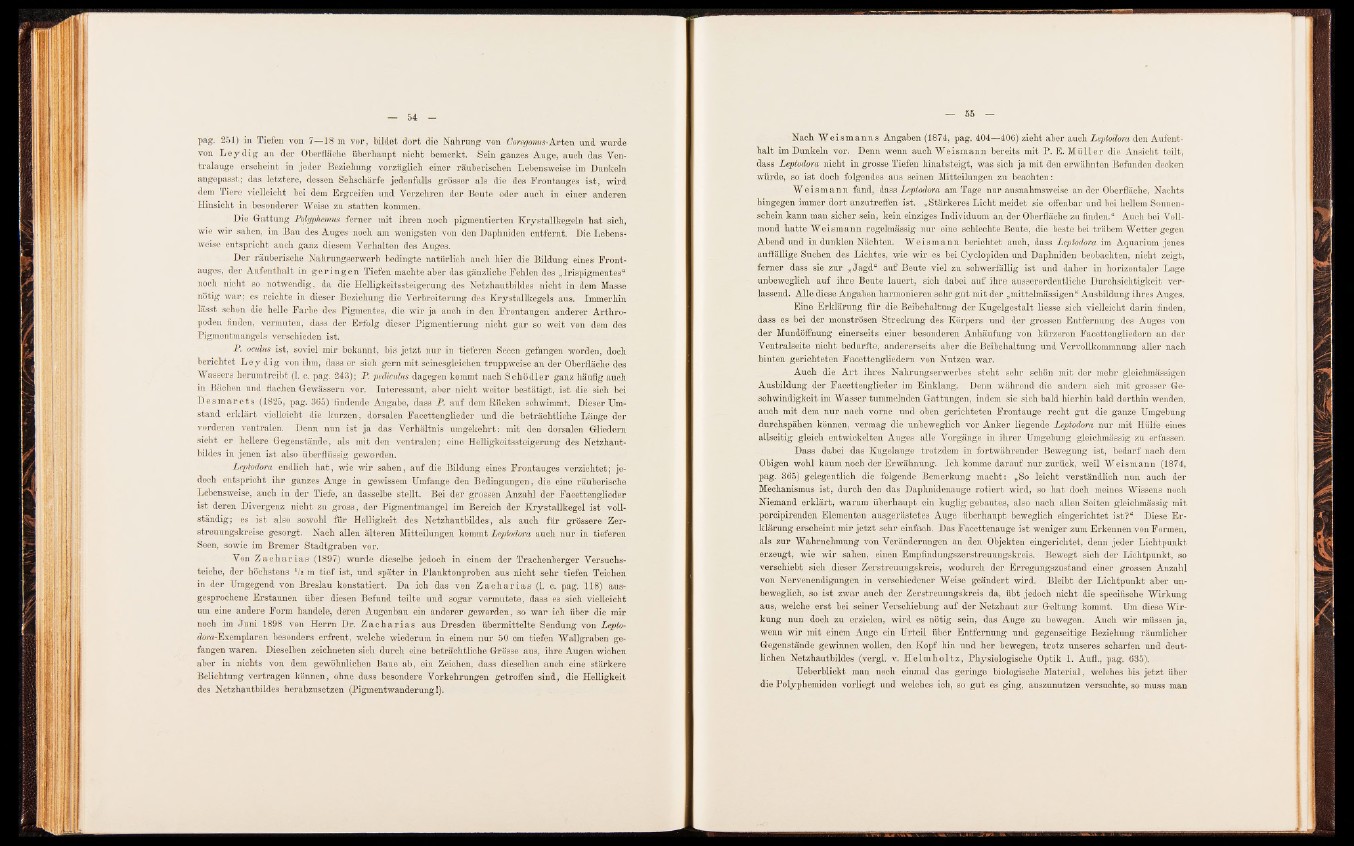
pag. 251) in Tiefen von 7—18 m v o r , bildet dort die Nahrung von Coregoms-A rten und wurde
von L e y d i g an der Oberfläche überhaupt nicht bemerkt. Sein ganzes Auge, auch das Ventralauge
erscheint in jeder Beziehung vorzüglich einer räuberischen Lebensweise im Dunkeln
angepasst; das letztere, dessen Sehschärfe jedenfalls grösser als die des Frontauges is t , wird
dem Tiere vielleicht bei dem Ergreifen und Verzehren der Beute oder auch in einer anderen
Hinsicht in besonderer Weise zu sta tten kommen.
Die Gattung Polyphemm ferner mit ihren noch pigmentierten Krystallkegeln hat sich,
wie wir sahen, im Bau des Auges noch am wenigsten von den Daphniden entfernt. D ie Lebensweise
entspricht auch ganz diesem Verhalten des Auges.
Der räuberische Nahrungserwerb bedingte natürlich auch hier die Bildung eines Frontauges,
der Aufenthalt in g e r i n g e n Tiefen machte aber das gänzliche Fehlen des „Irispigmentes“
noch nicht so notwendig, da die Helligkeitssteigerung des Netzhautbildes nicht in dem Masse
nötig war; es reichte in dieser Beziehung die Verbreiterung des Krystallkegels aus. Immerhin
lä sst schon die helle Farbe des Pigmentes, die wir ja auch in den Frontaugen anderer Arthropoden
finden, vermuten, dass der Erfolg dieser Pigmentierung nicht gar so w e it von dem des
Pigmentmangels verschieden ist.
P. ocuhts ist, soviel mir bekannt, bis je tz t nur in tieferen Seeen gefangen worden, doch
berichtet L e y d i g von ihm, dass er sich gern mit seinesgleichen truppweise an der Oberfläche des
Wassers herumtreibt (1. c. pag. 243); P. pediculus dagegen kommt nach S c h ö d l e r ganz häufig auch
in Bächen und flachen Gewässern vor. Interessant, aber nicht weiter bestätigt, is t die sich bei
D e sm a r e t s (1825, pag. 365) findende Angabe, dass P. auf dem Bücken schwimmt. Dieser Umstand
erklärt vielleicht die kurzen, dorsalen Facettenglieder und die beträchtliche Länge der
vorderen ventralen. Denn nun ist ja das Verhältnis umgekehrt: mit den dorsalen Gliedern
sieht er hellere Gegenstände, als mit den ventralen; eine Helligkeitssteigerung des Netzhautbildes
in jenen is t also überflüssig geworden.
Leptodora endlich h a t, wie wir sahen, auf die Bildung eines Frontauges verzichtet; jedoch
entspricht ih r ganzes Auge in gewissem Umfange den Bedingungen, die eine räuberische
Lebensweise, auch in der Tiefe, an dasselbe stellt. B ei der grossen Anzahl der Facettenglieder
is t deren Divergenz nicht zu g ro s s , der Pigmentmangel im Bereich der Kry sta llkeg el is t vo llständig
; es is t also sowohl für Helligkeit des Netzhautbildes, als auch für g rö s s e r e ' Zerstreuungskreise
gesorgt. Nach allen älteren Mitteilungen kommt Leptodora auch nur in tieferen
Seen, sowie im Bremer Stadtgraben vor.
Von Z a c h a r i a s (1897) wurde dieselbe jedoch in einem der Trachenberger Versuchsteiche,
der höchstens 1I% m tie f ist, und später in Planktonproben aus nicht sehr tiefen Teichen
in der Umgegend von Breslau konstatiert. Da ich das von Z a c h a r i a s (1. c. pag. 118) ausgesprochene
Erstaunen über diesen Befund te ilte und sogar vermutete, dass es sich vielleicht
um eine andere Form handele, deren Augenbau ein anderer geworden, so war ich über die mir
noch im Juni 1898 von Herrn Dr. Z a c h a r i a s aus Dresden übermittelte Sendung von Lepto-
dora-Exemplaren besonders erfreut, welche wiederum in einem nur 50 cm tiefen Wallgraben gefangen
waren. Dieselben zeichneten sich durch eine beträchtliche Grösse aus, ihre Augen wichen
aber in nichts von dem gewöhnlichen Baue ab, ein Zeichen, dass dieselben auch eine stärkere
Belichtung vertragen können, ohne dass besondere Vorkehrungen getroffen sind, die Helligkeit
des Netzhautbildes herabzusetzen (Pigmentwanderung!).
Nach W e i sm a n n s Angaben (1874, pag. 404—406) zieht aber auch Leptodora den Aufenthalt
im Dunkeln vor. Denn wenn auch W e ism a n n bereits mit P. E. M ü l l e r die Ansicht teilt,
dass Leptodora nicht in grosse Tiefen hinabsteigt, was sich ja mit den erwähnten Befunden decken
würde, so is t doch folgendes aus seinen Mitteilungen zu beachten:
W e i sm a n n fand, dass Leptodora am Tage nur ausnahmsweise an der Oberfläche, Nachts
hingegen immer dort anzutreffen ist. „Stärkeres Licht meidet sie offenbar und bei hellem Sonnenschein
kann man sicher sein, kein einziges Individuum an der Oberfläche zu finden.“ Auch bei Vollmond
hatte W e i s mann regelmässig nur eine schlechte Beute, die beste bei trübem Wetter gegen
Abend und in dunklen Nächten. W e i sm a n n berichtet auch, dass Leptodora im Aquarium jenes
auffällige Suchen des Lichtes, wie wir es bei Cyclopiden und Daphniden beobachten, nicht zeigt,
ferner dass sie zur „Jagd“ auf Beute viel zu schwerfällig is t und daher in horizontaler Lage
unbeweglich auf ihre Beute lauert, sich dabei auf ihre ausserordentliche Durchsichtigkeit verlassend.
A lle diese Angaben harmonieren sehr gut mit der „mittelmässigen“ Ausbildung ihres Auges.
Eine Erklärung für die Beibehaltung der Kugelgestalt liesse sich vielleicht darin finden,
dass es bei der monströsen Streckung des Körpers und der grossen Entfernung des Auges von
der Mundöffnung einerseits einer besonderen Anhäufung von kürzeren Facettengliedern an der
Ventralseite nicht bedurfte, andererseits aber die Beibehaltung und Vervollkommnung aller nach
hinten gerichteten Facettengliedern von Nutzen war.
Auch die A r t ihres Nahrungserwerbes steht sehr schön mit der mehr gleichmässigen
Ausbildung der Facettenglieder im Einklang. Denn während die ändern sich mit grösser Geschwindigkeit
im Wasser tummelnden Gattungen, indem sie sich bald hierhin bald dorthin wenden,
auch mit dem nur nach vorne und oben gerichteten Frontauge recht gut die ganze Umgebung
durchspähen können, vermag die unbeweglich vor Anker liegende Leptodora nur mit Hülfe eines
allse itig gleich entwickelten Auges alle Vorgänge in ihrer Umgebung gleichmässig zu erfassen.
Dass dabei das Kugelauge trotzdem in fortwährender Bewegung ist, bedarf nach dem
Obigen wohl kaum noch der Erwähnung. Ich komme darauf nur zurück, weil W e ism a n n (1874,
pag. 365) gelegentlich die folgende Bemerkung macht: „So leicht verständlich nun auch der
Mechanismus ist, durch den das Daphnidenauge rotiert wird, so hat doch meines Wissens noch
Niemand erklärt, warum überhaupt ein kuglig gebautes, also nach allen Seiten gleichmässig mit
percipirenden Elementen ausgerüstetes Auge überhaupt beweglich eingerichtet is t? “ Diese E r klärung
erscheint mir je tz t sehr einfach. Das Facettenauge is t weniger zum Erkennen von Formen,
als zur Wahrnehmung von Veränderungen an den Objekten eingerichtet, denn jeder Lichtpunkt
erzeugt, w ie w ir sahen, einen Empfindungszerstreuungskreis. Bewegt sich der Lichtpunkt, so
verschiebt sich dieser Zerstreuungskreis, wodurch der Erregungszustand einer grossen Anzahl
von Nervenendigungen in verschiedener Weise geändert wird. Bleibt der Lichtpunkt aber unbeweglich,
so is t zwar auch der Zerstreuungskreis da; übt jedoch nicht die specifische Wirkung
aus, welche erst bei seiner Verschiebung au f der Netzhaut zur Geltung kommt. Um diese Wirkung
nun doch zu erzielen, wird es notig sein, das Auge zu bewegen. Auch wir müssen ja,
wenn w ir mit einem Auge ein Urteil über Entfernung und gegenseitige Beziehung räumlicher
Gegenstände gewinnen wollen, den Kopf hin und her bewegen, trotz unseres scharfen und deutlichen
Netzhautbildes (vergl. v. H e lm h o l t z , Physiologische Optik 1. Aufl., pag. 635). .
Ueberblickt man noch einmal das geringe biologische Material, welches bis jetzt über
die Polyphemiden vorliegt und welches ich, so gut es ging, auszunutzen versuchte, so muss man