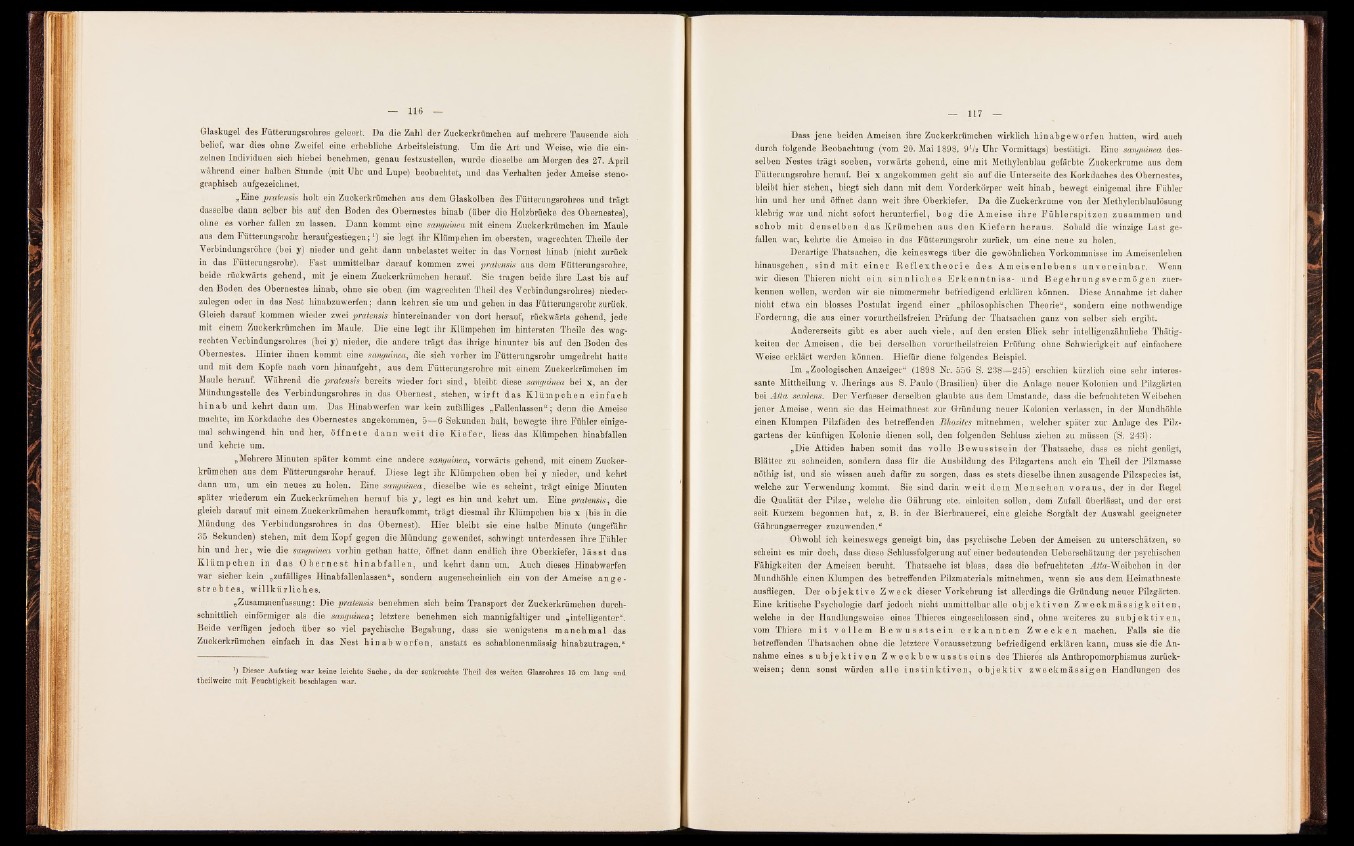
Glaskugel des Fütterungsrohres geleert. Da die Zahl der Zuckerkrümchen auf mehrere Tausende sich
belief, war dies ohne Zweifel eine erhebliche Arbeitsleistung. Um die Art und Weise, wie die einzelnen
Individuen sich hiebei benehmen, genau festzustellen, wurde dieselbe am Morgen des 27. April
während einer halben Stunde (mit Uhr und Lupe) beobachtet, und das Verhalten jeder Ameise stenographisch
aufgezeichnet.
»Eine pratensis holt ein Zuckerkrümchen aus dem Glaskolben des Fütterungsrohres und trägt
dasselbe dann selber bis auf den Boden des Obernestes hinab (über die Holzbrücke des Obernestes),
ohne es vorher fallen zu lassen. Dann kommt eine sanguinea mit einem Zuckerkrümchen im Maule
aus dem Fütterungsrohr heraufgestiegen;1) sie legt ihr Klümpchen im obersten, wagrechten Theile der
Verbindungsröhre (bei y) nieder und geht dann unbelastet weiter in das Vornest hinab (nicht zurück
in das Fütterungsrohr). Fast unmittelbar darauf kommen zwei pratensis aus dem Fütterungsrohre,
beide rückwärts gehend, mit je einem Zuckerkrümchen herauf. Sie tragen beide ihre Last bis auf
den Boden des Obernestes hinab, ohne sie oben (im wagrechten Theil des Verbindungsrohres) nieder
zulegen oder in das Nest hinabzuwerfen; dann kehren sie um und gehen in das Fütterungsrohr zurück.
Gleich darauf kommen wieder zwei pratensis hintereinander von dort herauf, rückwärts gehend, jede
mit einem Zuckerkrümchen im Maule. Die eine legt ihr Klümpchen im hintersten Theile des wagrechten
Verbindungsrohres (bei y) nieder, die andere trägt das ihrige hinunter bis auf den Boden des
Obernestes. Hinter ihnen kommt eine sanguinea, die sich vorher im Fütterungsrohr umgedreht hatte
und mit dem Kopfe nach vorn hinaufgeht, aus dem Fütterungsrohre mit einem Zuckerkrümchen im
Maule herauf. Während die pratensis bereits wieder fort sind, bleibt diese sanguinea bei x , an der
Mündungsstelle des Verbindungsrohres in das Obemest, stehen, w i r f t d a s K lü m p c h e n e in f a c h
h in a b und kehrt dann um. Das Hinabwerfen war kein zufälliges „Fallenlassen“ ; denn die Ameise
machte, im Korkdache des Obernestes angekommen, 5—6 Sekunden halt, bewegte ihre Fühler einigemal
schwingend, hin und her, ö f f n e t e d an n w e i t d ie K i e f e r , liess das Klümpchen hinabfallen
und kehrte um.
„Mehrere Minuten später kommt eine andere sanguinea, vorwärts gehend, mit einem Zuckerkrümchen
aus dem Fütterungsrohr herauf. Diese legt ihr Klümpchen oben bei y nieder, und kehrt
dann um, um ein neues zu holen. Eine sanguinea, dieselbe wie es scheint, trägt einige Minuten
später wiederum ein Zuckerkrümchen herauf bis y , legt es hin und kehrt um. Eine pratensis, die
gleich darauf mit einem.Zuckerkrümchen heraufkommt, trägt diesmal ihr Klümpchen bis x (bis in die
Mündung des Verbindungsrohres in das Obernest). Hier bleibt sie eine halbe Minute (ungefähr
35 Sekunden) stehen, mit dem Kopf gegen die Mündung gewendet, schwingt unterdessen ihre Fühler
hin und her, wie die sanguinea vorhin gethan hatte, öffnet dann endlich ihre Oberkiefer, l ä s s t das
K lüm p c h e n in d a s O b e r n e s t h in a b f a l l e n , und kehrt dann um. Auch dieses Hinabwerfen
war sicher kein „zufälliges Hinabfallenlassen“, sondern augenscheinlich ein von der Ameise a n g e s
t r e b t e s , w i l lk ü r l i c h e s .
„Zusammenfassung: Die pratensis benehmen sich beim Transport der Zuckerkrümchen durchschnittlich
einförmiger als die sanguinea; letztere benehmen sich mannigfaltiger und „intelligenter“.
Beide verfügen jedoch über so viel psychische Begabung, dass sie wenigstens m a n c hm a l das
Zuckerkrümchen einfach in das Nest h in a b w e r f e n , anstatt es schablonenmässig hinabzutragen.“
Dieser Aufstieg war keine leichte Sache, da der senkrechte Theil des weiten Glasrohres 15 cm lang und
theilweise mit Feuchtigkeit beschlagen war.
Dass jene beiden Ameisen ihre Zuckerkrümchen wirklich h in a b g ew o r fen hatten, wird auch
durch folgende Beobachtung (vom 20. Mai 1898, 9 l/2 Uhr Vormittags) bestätigt. Eine sanguinea desselben
Nestes trägt soeben, vorwärts gehend, eine mit Methylenblau gefärbte Zuckerkrume aus dem
Fütterungsrohre herauf. Bei x angekommen geht sie auf die Unterseite des Korkdaches des Obernestes,
bleibt hier stehen, biegt sich dann mit dem Vorderkörper weit hinab, bewegt einigemal ihre Fühler
hin und her und öffnet dann weit ihre Oberkiefer. Da die Zuckerkrume von der Methylenblaulösung
klebrig war und nicht sofort herunterfiel, b o g d ie A m e is e ih r e F ü h le r sp itz e n zusammen und
sch ob mit d e n s e lb e n d a s Krümchen aus den K ie fe rn h erau s. Sobald die winzige Last gefallen
war, kehrte die Ameise in das Fütterungsrohr zurück, um eine neue zu holen.
Derartige Thatsachen, die keineswegs über die gewöhnlichen Vorkommnisse im Ameisenleben
hinausgehen, s in d m it e in e r R e f l e x t h e o r i e d e s A m e i s e n l e b e n s u n v e r e in b a r . Wenn
wir diesen Thieren nicht e in s in n lic h .e s E r k e n n t n i s s - und B e g e h r u n g s v e rm ö g e n zuerkennen
wollen, werden wir sie nimmermehr befriedigend erklären können. Diese Annahme ist daher
nicht etwa ein blosses Postulat irgend einer „philosophischen Theorie“, sondern eine nothwendige
Forderung, die aus einer vorurteilsfreien Prüfung der Thatsachen ganz von selber sich ergibt.
Andererseits gibt es aber auch viele, auf den ersten Blick sehr intelligenzähnliche Thätig-
keiten der Ameisen, die bei derselben vorurtheilsfreien Prüfung ohne Schwierigkeit auf einfachere
Weise erklärt werden können. Hiefür diene folgendes Beispiel.
Im „Zoologischen Anzeiger“ (1898 Nr. 556 S. 238—245) erschien kürzlich eine sehr interessante
Mittheilung v. Jherings aus S. Paulo (Brasilien) über die Anlage neuer Kolonien und Pilzgärten
bei A tta sexdens. Der Verfasser derselben glaubte aus dem Umstande, dass die befruchteten Weibchen
jener Ameise, wenn sie das Heimathnest zur Gründung neuer Kolonien verlassen, in der Mundhöhle
einen Klumpen Pilzfäden des betreffenden JRhozites mitnehmen, welcher später zur Anlage des Pilzgartens
der künftigen Kolonie dienen soll, den folgenden Schluss ziehen zu müssen (S. 243):
„Die Attideü haben somit das v o lle B ew u s s t s e in der Thatsache, dass es nicht genügt,
Blätter zu schneiden, sondern dass für die Ausbildung des Pilzgartens auch ein Theil der Pilzmasse
nöthig ist, und sie wissen auch dafür zu sorgen, dass es stets dieselbe ihnen zusagende Pilzspecies ist,
welche zur Verwendung kommt. Sie sind darin w e i t d em M e n s c h e n v o r a u s , der in der Regel
die Qualität der P ilze , welche die Gährung etc. einleiten sollen, dem Zufall überlässt, und der erst
seit Kurzem begonnen hat, z. B. in der Bierbrauerei, eine gleiche Sorgfalt der Auswahl geeigneter
Gährungserreger zuzuwenden. “
Obwohl ich keineswegs geneigt bin, das psychische Leben der Ameisen zu unterschätzen, so
scheint es mir doch, dass diese Schlussfolgerung auf einer bedeutenden Ueberschätzung der psychischen
Fähigkeiten der Ameisen beruht. Thatsache ist bloss, dass die befruchteten Aifa-Weibchen in der
Mundhöhle einen Klumpen des betreffenden Pilzmaterials mitnehmen, wenn sie aus dem Heimathneste
ausfliegen. Der o b j e k t i v e Z w e c k dieser Vorkehrung ist allerdings die Gründung neuer Pilzgärten.
Eine kritische Psychologie darf jedoch nicht unmittelbar alle o b j e k t i v e n Z w e c k m ä s s i g k e i t e n ,
welche in der Handlungsweise eines Thieres eingeschlossen sind, ohne weiteres zu s u b j e k t iv e n ,
vom Thiere m i t v o l l e m B e w u s s t s e i n e r k a n n t e n Z w e c k e n machen. Falls sie die
betreffenden Thatsachen ohne die letztere Voraussetzung befriedigend erklären kann, muss sie die Annahme
eines s u b j e k t i v e n Z w e c k b e w u s s t s e i n s des Thieres als Anthropomorphismus zurückweisen;
denn sonst würden a l l e in s t in k t i v e n , o b j e k t i v zw e c k m ä s s ig e n Handlungen des