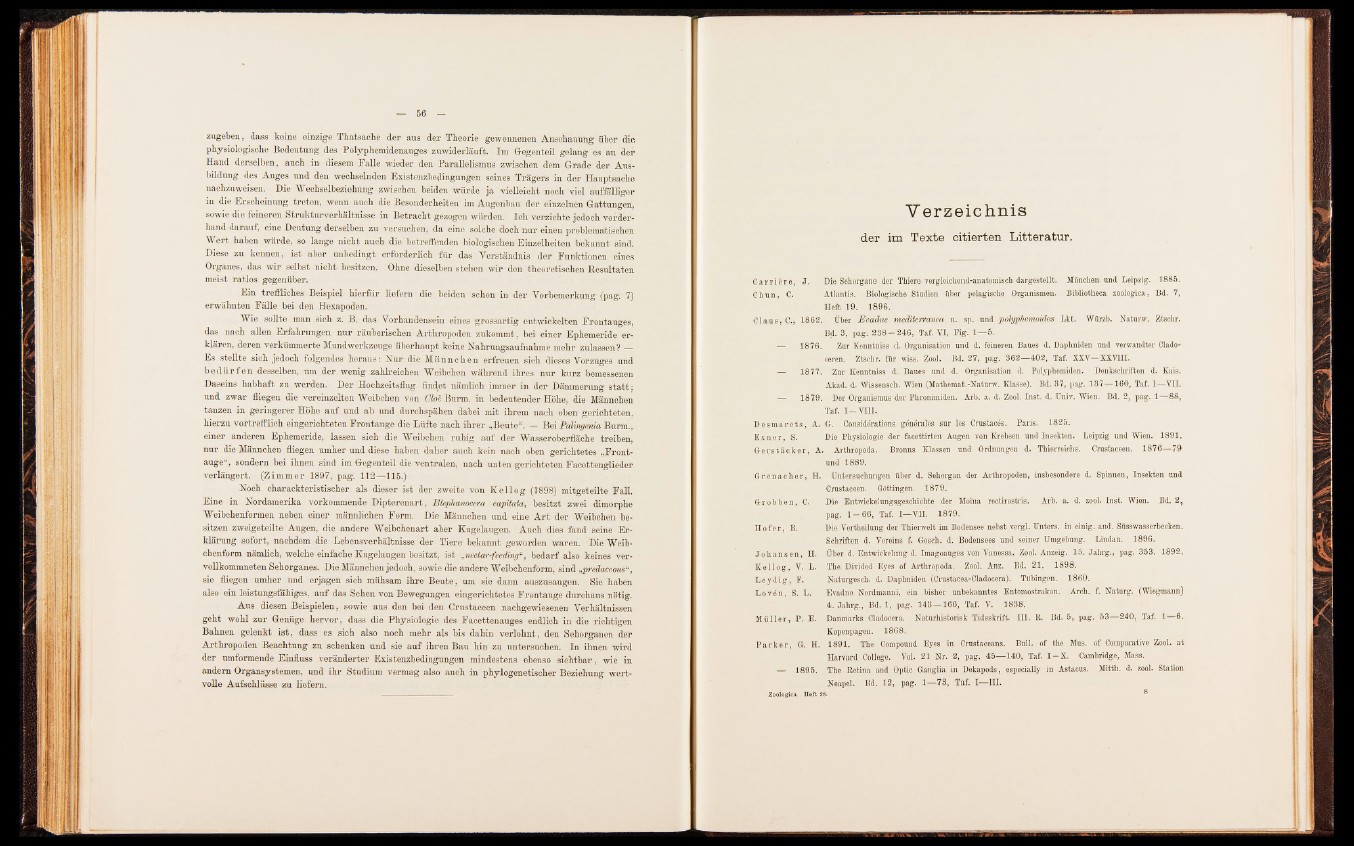
zugeben, dana keine einzige Tbatsache der ans der Theorie gewonnenen Anschauung über die
physiologische Bedeutung des Polyphemidenauges zuwiderläuffc. Im Gegenteil gelang es an der
Hand derselben, auch in diesem P a lle wieder den Parallelismus zwischen dem Grade der Ausbildung
des Auges und den wechselnden Existenzbedingungen seines Trägers in der Hauptsache
naehzuweisen. Die Wechselbeziehung zwischen beiden würde ja vielleicht noch v ie l auffälliger
in die Erscheinung treten, wenn auch die Besonderheiten im Augenbau der einzelnen Gattungen,
sowie d ie feineren Strukturverhältnisse in Betracht gezogen würden. Ich verzichte jedoch vorderhand
darauf, eine Deutung derselben zu versuchen, da eine solche doch nur einen problematischen
Wer t haben würde, so lange nicht auch die betreffenden biologischen Einzelheiten bekannt sind.
Diese zu kennen, is t aber unbedingt erforderlich; für das Verständnis der Punktionen eines
Organes, das w ir selbst nicht besitzen. Ohne dieselben stehen w ir den theoretischen Resultaten
meist ratlos gegenüber.
Ein treffliches Beispiel hierfür liefern die beiden schon in der Vorbemerkung (pag. 7)
erwähnten F ä lle bei den Hexapoden.
Wie sollte man sich z. B. das Vorhandensein eines grossartig entwickelten Frontauges,
das nach allen Erfahrungen nur räuberischen Arthropoden zukommt, bei einer Ephemeride erklären,
deren verkümmerte Mund Werkzeuge überhaupt keine Nahrungsaufnahme mehr zulassen? H
Es stellte sich jedoch folgendes heraus: Nur die M ä n n c h e n erfreuen sich dieses Vorzuges und
b e d ü r f e n desselben, um der wenig zahlreichen Weibchen während ihres nur kurz bemessenen
Daseins habhaft zu werden. Der Hochzeitsflug findet nämlich immer in der Dämmerung sta tt ;
und zwar fliegen die vereinzelten Weibchen von Cioè Burm. in bedeutender Höhe, die Männchen
tanzen in geringerer Höhe auf und ab und durchspähen dabei mit ihrem nach oben gerichteten,
hierzu vortrefflich eingerichteten F rontauge die Lüfte nach ihrer „Beute“. — Bei Palingenia Burm.,
einer anderen Ephemeride, lassen sich die Weibchen ruhig auf der Wasseroberfläche treiben,
nur die Männchen fliegen umher und diese haben daher auch kein nach oben gerichtetes „Frontauge“,
sondern bei ihnen sind im Gegenteil die ventralen, nach unten gerichteten Facettenglieder
verlängert. (Z im m e r 1897, pag. 112—115.)
Noch charackteristischer als dieser is t der zweite von K e l l o g (1898) mitgeteilte Fall.
Eine in Nordamerika vorkommende D ip teren a rt, Plephanocera capitata, besitzt zwei dimorphe
Weibchenformen neben einer männlichen Form. D ie Männchen und eine A r t der Weibchen besitzen
zweigeteilte Augen, die andere Weibchenart aber Kugelaugen. Auch dies fand seine Erklärung
sofort, nachdem die Lebensverhältnisse der Tiere bekannt geworden waren. Die Weibchenform
nämlich, welche einfache Kugelaugen besitzt, is t „nectar-feedingu, bedarf also keines vervollkommnten
Sehorganes. Die Männchen jedoch, sowie die andere Weibchenform, sind „predaceous“,
sie fliegen umher und erjagen sich mühsam ihre B eu te , um sie dann auszusaugen. Sie haben
also ein leistungsfähiges, auf das Sehen von Bewegungen eingerichtetes Frontauge durchaus nötig.
Aus diesen Beispielen, sowie aus den bei den Cxustaceen nachgewiesenen Verhältnissen
g eht wohl zur Genüge, h erv o r, dass die P h ysiologie des Facettenauges endlich in die richtigen
Bahnen gelenkt is t , dass es sich also noch mehr als bis dahin verlohnt, den Sehorganen der
Arthropoden Beachtung zu schenken und sie auf ihren Bau hin zu untersuchen. In ihnen wird
der umformende Einfluss veränderter Existenzbedingungen mindestens ebenso sichtbar, wie in
ändern Organsystemen, und ih r Studium vermag also auch in phylogenetischer Beziehung wertvolle
Aufschlüsse zu liefern.
V e r z e i c h n i s
der im Texte citierten Litteratur.
C a r r i è r e , J . Die Sehorgane der Thiere vergleichend-anatomisch dargestellt. München und Leipzig. 1885.
C h u n , C. Atlantis. Biologische Studien über pelagische Organismen. Bibliotheca zoologica , Bd. 7,
Heft 19. 1896.
C la u s , Cr, 1862. Über Evadne mediterranea n. sp. und polyphemoides Lkt. Würzb. Natur w. Ztschr.
Bd. 3, pag. 2 3 8 - 2 4 6 , Taf. VI, Fig. 1— 5.
— 1876. Zur Kenntniss d. Organisation und d. feineren, Baues d. Daphniden und verwandter Cladoceren.
Ztschr. für wiss. Zool. Bd. 27, pag. 362—402, Taf. XXV—XXVIII.
— 1877. Zur Kenntniss d. Baues und d. Organisation d. Polyphemiden. Denkschriften d. Kais.
Akad. d. Wissensch. Wien (Mathemat.-Naturw. Klasse). Bd. 37, pag. 137—160, Taf. I—VII.
— 1879. Der Organismus der Phronimiden. Arb. ä. d. Zool. Inst. d. Univ. Wien. Bd. 2, pag. 1—88,
Taf. I - VIII.
D e sm a r e t s , A. G-. Considérations générales sur les Crustacés. Paris. 1825.
E x n e r , S. Die Physiologie der facettirten Augen von Krebsen und Insekten. Leipzig und Wien. 1891.
G e r s t ä c k e r , A. Arthropoda. Bronns Klassen und Ordnungen d. Thierreichs. Crustaceen. 1876—79
und 1889.
G r e n a c h e r , H. Untersuchungen über d. Sehorgan der Arthropoden, insbesondere d. Spinnen, Insekten und
Crustaceen. Göttingen. 1879.
G ro b b e n , C. Die Entwickelungsgeschichte der Moina rectirostris. Arb. a. d. zool. Inst. Wien. Bd. 2,
pag. 1 - 6 6 , Taf. I—VH. 1879.
H o f e r , B. Die Vertheüung der Thierwelt im Bodensee nebst vergl. Unters, in einig, and. Süsswasserbecken.
Schriften d. Vereins f. Gesch. d. Bodensees und seiner Umgebung. Lindau. 1896.
J o h a n s e n , H. Über d. Entwickelung d. Imagoauges von Vanessa. Zool. Anzeig. 15. Jahrg., pag. 353. 1892.
K e llo g , V. L. The, Divided Eyes of Arthropoda. Zool. Anz. Bd. 21. 1898.
L e y d ig , F. Naturgesch. d. Daphniden (Crustacea-Cladocera). Tübingen. 1860.
L o v é n , S. L. Evadne Nordmanni, ein bisher unbekanntes - Entomostrakon. Arch. f. Naturg. (Wiegmann)
4. Jahrg., Bd. 1, pag. 143—166, Taf. V. 1838.
M ü lle r , P. E. Danmarks Cladocera. Naturhistorisk Tidsskrift. III. R. Bd. 5, pag. 53—240, Taf. 1—6.
Kopenpagen. 1868.
P a r k e r , G. H. 1891. The Compound Eyes in Crustaceans. Bull, of the Mus. of Comparative Zool. at
Harvard College. Vol. 21 Nr. 2, pag. 45—140, Taf. I —X. Cambridge, Mass.
— 1895. The Retina and Optic Ganglia in Dekapods, especially in Astacus. Mitth. d. zool. Station
Neapel. Bd. 12, pag. 1—73, Taf. I—III.
Zoologica. H e f t 28.