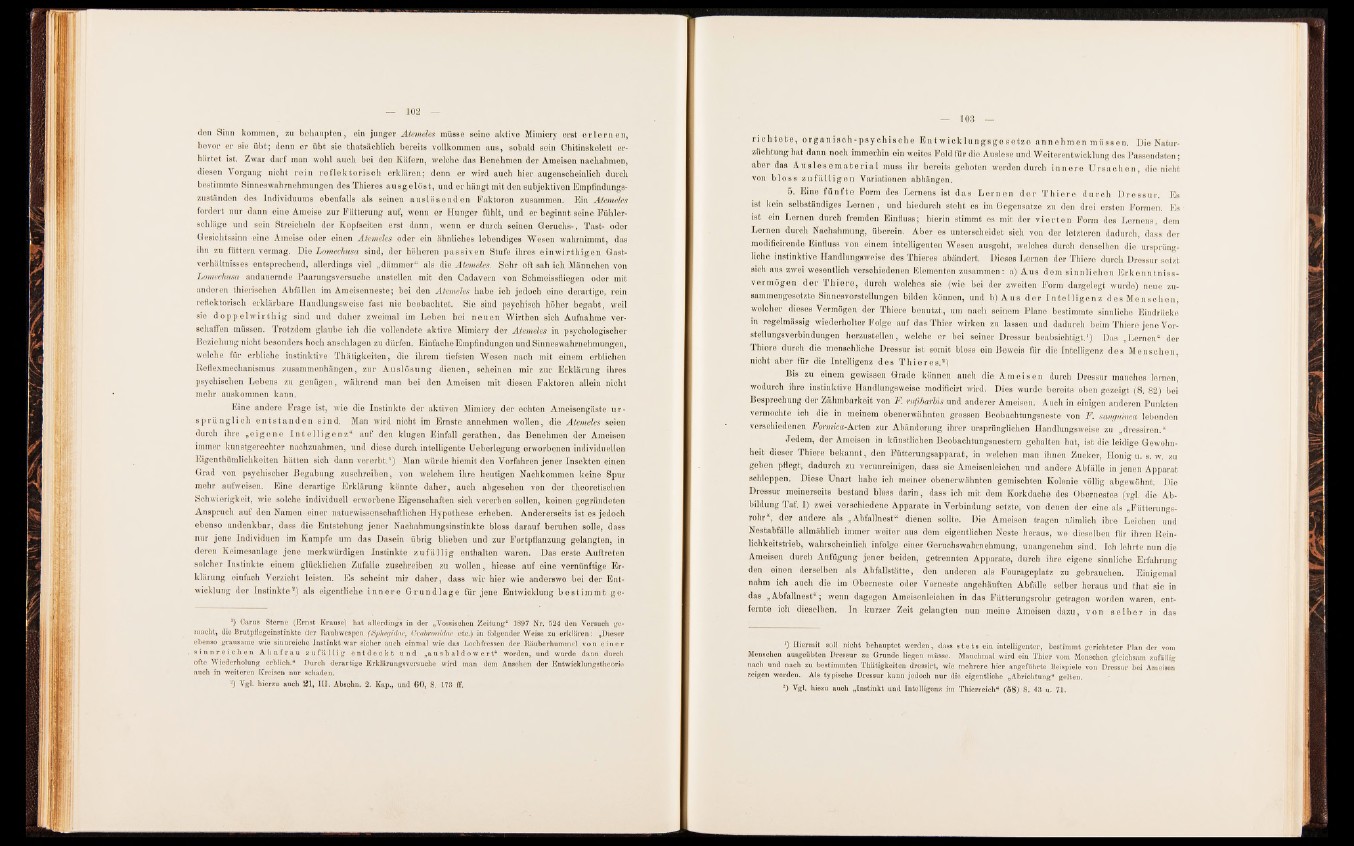
den Sinn kommen, zu behaupten, ein junger Atemeies müsse seine aktive Mimicry erst e r le r n e n ,
bevor er sie übt; denn er übt sie thatsächlieh bereits vollkommen aus, sobald sein Chitinskelett erhärtet
ist. Zwar darf man wohl auch bei den Käfern, welche das Benehmen der Ameisen nachahmen,
diesen Vorgang nicht r e in r e fle k to r is c h erklären; denn er wird auch hier augenscheinlich durch
bestimmte Sinneswahrnehmungen des Thieres a u s g e lö s t , und er hängt mit den subjektiven Empfindungszuständen
des Individuums ebenfalls als seinen a u s lö s e n d e n Faktoren zusammen. Ein A tm e le s
fordert nur dann eine Ameise zur Fütterung auf, wenn er Hunger fühlt, und er beginnt seine Fühlerschläge
und sein Streicheln der Kopfseiten erst dann, wenn er durch seinen Geruchs-, Tast- oder
Gesichtssinn -eine Ameise oder einen Atemeies oder ein ähnliches lebendiges Wesen wahrnimmt, das
ihn zu füttern vermag. Die Lomechusa sind, der höheren p a s s iv e n Stufe ihres e inw ir th ig e n Gastverhältnisses
entsprechend, allerdings viel „dümmer" als die Atemeies. Sehr oft sah ich Männchen von
Lomechusa andauernde Paarungsversudhe anstellen mit den Cadavern von Schmeissfliegen oder mit
anderen thierisohen Abfällen im Araeisenneste; bei den Atemeies habe ich jedoch eine derartige, rein
reflektorisch erklärbare Handlungsweise fast nie beobachtet. Sie sind psychisch höher begabt, weil
sie d o p p e lw i r t h ig sind und daher zweimal im Leben bei n eu en Wirthen sich Aufnahme verschaffen
müssen. Trotzdem glaube ich die vollendete aktive Mimicry der Atemeies in psychologischer
Beziehung nicht besonders hoch anschlagen zu dürfen. Einfache Empfindungen und Sinneswahrnehmungen,
welche für erbliche instinktive Thätigkeiten, die ihrem tiefsten Wesen nach mit einem erblichen
Reflexmechanismus Zusammenhängen, zur A u s lö su n g dienen, scheinen mir zur Erklärung ihres
psychischen Lebens zu genügen, während man bei den Ameisen mit diesen Faktoren allein nicht
mehr auskommen kann.
Eine andere Frage ist, wie die Instinkte der aktiven Mimicry der echten Ameisengäste u r s
p r ü n g l i c h e n t s t a n d e n s in d . Man wird nicht im Ernste annehmen wollen, die Atemeies seien
durch ihre „ e ig e n e I n t e l l i g e n z “ auf den klugen Einfall gerathen, das Benehmen der Ameisen
immer kunstgerechter nachzuahmen, und diese durch intelligente Ueberlegung erworbenen individuellen
Eigenthümlichkeiten hätten sich dann vererbt.1) Man würde hiemit den Vorfahren jener Insekten einen
Grad von psychischer Begabung zuschreiben, von welchem ihre heutigen Nachkommen keine Spur
mehr aufweisen. Eine derartige Erklärung könnte daher, auch abgesehen von der theoretischen
Schwierigkeit, wie solche individuell erworbene Eigenschaften sich vererben sollen, keinen gegründeten
Anspruch auf den Namen einer naturwissenschaftlichen Hypothese erheben. Andererseits ist es jedoch
ebenso undenkbar, dass die Entstehung jener Nachahmungsinstinkte bloss darauf beruhen solle, dass
nur jene Individuen im Kampfe um das Dasein übrig blieben und zur Fortpflanzung gelangten, in
deren Keimesanlage jene merkwürdigen Instinkte z u f ä l l i g enthalten waren. Das erste Auftreten
solcher Instinkte einem glücklichen Zufalle zuschreiben zu wollen, hiesse auf eine vernünftige Erklärung
einfach Verzicht leisten. Es scheint mir daher, dass wir hier wie anderswo bei der Entwicklung
der Instinkte8) als eigentliche in n e r e G r u n d la g e für jene Entwicklung b e s t im m t go-
’) Carus Storno (Ernst Krause) hat allerdings in der „Vossischen Zeitung“ 1897 Nr. 524 den Versuch gemacht,
die Brutpflegeinstinkte der Kaubwespen (Sphegidae, Crabronidac etc.) in folgender Weise zu erklären: „Dieser
ebenso grausame wie sinnreiche Instinkt war sicher auch einmal wie das Lochfressen der Räuberhummcl von einer
s i n n r e i c h e n Ah n f r a u z u f ä l l i g e n t d e c k t u n d „ a u s b a l d owe r t “ worden, und wurde dann durch
ofto Wiederholung erblich.“ Durch derartige Erklärungsversuche wird man dem Ansehen der Entwicklungstheorie
auch in weiteren Kreisen nur schaden.
a) Vgl. hierzu auch 21, III. Abschn. 2. Kap., und 6 0 , S. 173 ff.
r i c h t e t e , o r g a n i s c h - p s y c h i s c h e E n tw i c k lu n g s g e s e t z e a n n e hm e n m ü s s en . Die Naturzüchtung
hat dann noch immerhin ein weites Feld für die Auslese und Weiterentwicklung des Passendsten;
aber das A u s l e s e m a t e r i a l muss ihr bereits geboten werden durch in n e r e U r s a c h e n , die nicht
von b lo s s z u f ä l l i g e n Variationen abhängen.
5. Eine f ü n f t e Form des Lernens ist d a s L e r n e n d e r T h ie r e d u r c h D r e s s u r . Es
ist kein selbständiges Lernen, und hiedurch steht es im Gegensätze zu den drei ersten Formen. Es
ist ein Lernen durch fremden Einfluss; hierin stimmt es mit der v i e r t e n Form des Lernens, dem
Lernen durch Nachahmung, überein. Aber es unterscheidet sich von der letzteren dadurch, dass der
modificirende Einfluss von einem intelligenten Wesen ausgeht, welches durch denselben die ursprüngliche
instinktive Handlungsweise des Thieres abändert. Dieses Lernen der Thiere durch Dressur setzt
sich aus zwei wesentlich verschiedenen Elementen zusammen: a) A u s dem s in n lich en E rk en n tn is s-
v e rm ö g en der T h ie r e , durch welches sie (wie bei der zweiten Form dargelegt wurde) neue zusammengesetzte
Sinnesvorstellungen bilden können, und b )A u s d e r I n t e l l i g e n z d e sM e n s c h e n
welcher dieses Vermögen der Thiere benutzt, um nach seinem Plane bestimmte sinnliche Eindrücke
in regelmässig wiederholter Folge auf das Thier wirken zu lassen und dadurch beim Thiere jene Vorstellungsverbindungen
herzustellen, welche er bei seiner Dressur beabsichtigt,1) Das „Lernen“ der
Thiere durch die menschliche Dressur ist somit bloss ein Beweis für die Intelligenz d e s M en sch en ,
nicht aber für die Intelligenz d e s T h i e r e s .2)
Bis zu einem gewissen Grade können auch die A m e is e n durch Dressur manches lernen,
wodurch ihre instinktive Handlungsweise modificirt wird. Dies wurde bereits oben gezeigt (S. 82) bei
Besprechung der Zähmbarkeit von F . mfibarbis und anderer Ameisen. Auch in einigen anderen Punkten
vermochte ich die in meinem obenerwähnten grossen Beobachtungsnöste von F. smguvnea lebenden
verschiedenen Fovmicu-Arten zur Abänderung ihrer ursprünglichen Handlungsweise zu dressiren.“
Jedem, der Ameisen in künstlichen Beobachtungsnestern gehalten hat, ist die leidige Gewohnheit
dieser Thiere bekannt, den Fütterungsapparat, in welchen man ihnen Zucker, Honig u. s. w. zu
geben pflegt, dadurch zu verunreinigen, dass sie Ameisenleichen und andere Abfälle in jenen Apparat
schleppen. Diese Unart habe ich meiner obenerwähnten gemischten Kolonie völlig abgewöhnt. Die
Dressur meinerseits bestand bloss darin, dass ich mit dem Korkdache des Obernestes (vgl. die Abbildung
Taf. I) zwei verschiedene Apparate in Verbindung setzte, von denen der eine als „Fütterungsrohr“,
der andere als „Abfallnest“ dienen sollte. Die Ameisen tragen nämlich ihre Leichen und
Nestabfälle allmählich immer weiter aus dem eigentlichen Neste heraus, wo dieselben für ihren Reinlichkeitstrieb,
wahrscheinlich infolge einer Geruchswahrnehmung, unangenehm sind. Ich lehrte nun die
Ameisen durch Anfügung jener beiden, getrennten Apparate, durch ihre eigene sinnliche Erfahrung
den einen derselben als Abfallstätte, den anderen als Fourageplatz zu gebrauchen. Einigemal
nahm ich auch die im Oberneste oder Vorneste angehäuften Abfälle selber heraus und that sie in
das „Abfallnest“ ; wenn dagegen Ameisenleichen in das Fütterungsrohr getragen worden waren, entfernte
ich dieselben. In kurzer Zeit gelangten nun meine Ameisen dazu, v o n s e lb e r in das
*) Hiermit soll nioht behauptet werden, dass s t e t s ein intelligenter, bestimmt gerichteter Plan der vom
Menschen ausgeübten Dressur zu Grunde liegen müsse. Manchmal wird ein Thier vom Menschen gleichsam zufällig
nach und nach zu bestimmten Thätigkeiten dressirt, wie mehrere hier angeführte Beispiele von Dressur bei Ameisen
zeigen werden. Als typische Dressur kann jedoch nur die eigentliche „Abrichtung“ gelten.
2) Vgl. hiezu auch „Instinkt und Intelligenz im Thierreich“ (58) S. 43 u. 71.