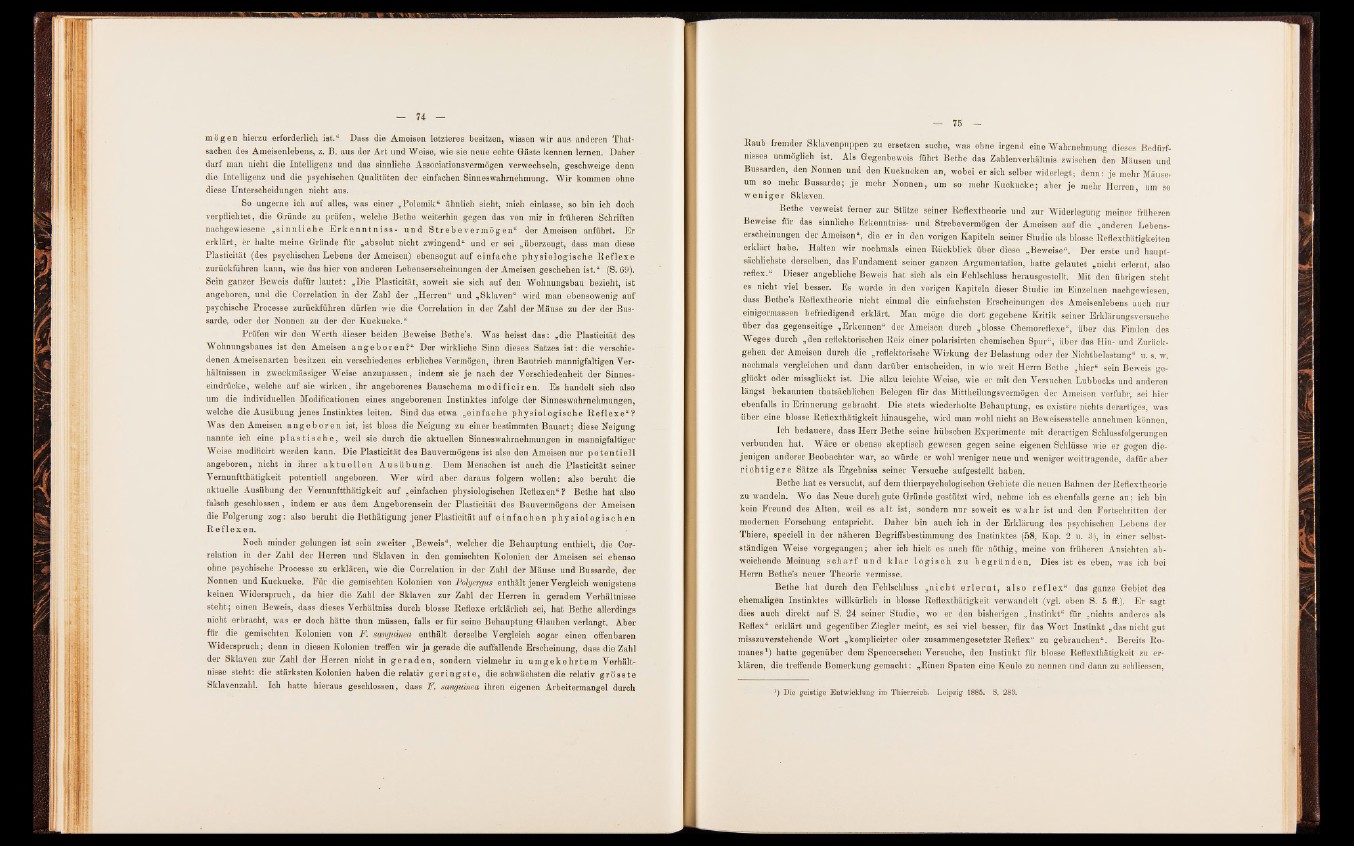
m m m , —
m ö g e n hierzu erforderlich ist.“ Dass die Ameisen letzteres besitzen, wissen wir aus anderen That-
sachen des Ameisenlebens, z. B. aus der Art und Weise, wie sie neue echte Gäste kennen lernen. Daher
darf man nicht die Intelligenz und das sinnliche Associationsvermögen verwechseln, geschweige denn
die Intelligenz und die psychischen Qualitäten der einfachen Sinneswahrnehmung. Wir kommen ohne
diese Unterscheidungen nicht aus.
So ungerne ich auf alles, was einer „Polemik“ ähnlich sieht, mich einlasse, so bin ich doch
verpflichtet, die Gründe zu prüfen, welche Bethe weiterhin gegen das von mir in früheren Schriften
nachgewiesene „ s in n l i c h e E r k e n n t n i s s - u n d S t r e b e v e rm ö g e n “ der Ameisen anführt. Er
erklärt, er halte meine Gründe für „absolut nicht zwingend“ und er sei „überzeugt, dass man diese
Plasticität (des psychischen Lebens der Ameisen) ebensogut auf e in fa c h e p h y s io lo g is c h e R e f le x e
zurückführen kann, wie das hier von anderen Lebenserscheinungen der Ameisen geschehen ist.“ (S. 69).
Sein ganzer Beweis dafür lautet: „Die Plasticität, soweit sie sich auf den Wohnungsbau bezieht, ist
angeboren, und die Correlation in der Zahl der „Herren“ und „Sklaven“ wird man ebensowenig auf
psychische Processe zurückführen dürfen wie die Correlation in der Zahl der Mäuse zu der der Bussarde,
oder der Nonnen zu der der Kuckucke.“
Prüfen wir den Werth dieser beiden Beweise Bethe’s. Was heisst das: „die Plasticität des
Wohnungsbaues ist den Ameisen a n g e b o r e n ? “ Der wirkliche Sinn dieses Satzes ist: die verschiedenen
Ameisenarten besitzen ein verschiedenes erbliches Vermögen, ihren Bautrieb mannigfaltigen Verhältnissen
in zweckmässiger Weise anzupassen, indem sie je nach der Verschiedenheit der Sinneseindrücke,
welche auf sie wirken, ihr angeborenes Bauschema m o d if ic ir e n . Es handelt sich also
um die individuellen Modificationen eines angeborenen Instinktes infolge der Sinneswahrnehmungen,
welche die Ausübung jenes Instinktes leiten. Sind das etwa „ e in fa c h e p h y s io lo g is c h e R e f l e x e “ ?
Was den Ameisen a n g e b o r e n ist, ist bloss die Neigung zu einer bestimmten Bauart; diese Neigung
nannte ich eine p l a s t i s c h e , weil sie durch die aktuellen Sinneswahrnehmungen in mannigfaltiger
Weise modificirt werden kann. Die Plasticität des Bauvermögens ist also den Ameisen nur p o t e n t ie l l
angeboren, nicht in ihrer a k t u e l l e n A u s ü b u n g . Dem Menschen ist auch die Plasticität seiner
Vemunftthätigkeit potentiell angeboren. Wer wird aber daraus folgern wollen: also beruht die
aktuelle Ausübung der Vemunftthätigkeit auf „einfachen physiologischen Reflexen“ ? Bethe hat also
falsch geschlossen, indem er aus dem Angeborensein der Plasticität des Bauvermögens der Ameisen
die Folgerung zog: also beruht die Bethätigung jener Plasticität auf e in f a c h e n p h y s i o lo g i s c h e n
R e f l e x e n .
Noch minder gelungen ist sein zweiter „Beweis“, welcher die Behauptung enthielt, die Correlation
in der Zahl der Herren und Sklaven in den gemischten Kolonien der Ameisen sei ebenso
ohne psychische Processe zu erklären, wie die Correlation in der Zahl der Mäuse und Bussarde, der
Nonnen und Kuckucke. Für die gemischten Kolonien von Fölyergus enthält jener Vergleich wenigstens
keinen Widerspruch, da hier die Zahl der Sklaven zur Zahl der Herren in geradem Verhältnisse
steht; einen Beweis, dass dieses Verhältniss durch blosse Reflexe erklärlich sei, hat Bethe allerdings
nicht erbracht, was er doch hätte thun müssen, falls er für seine Behauptung Glauben verlangt. Aber
für die gemischten Kolonien von F . sanguinea enthält derselbe Vergleich sogar einen offenbaren
Widerspruch; denn in diesen Kolonien treffen wir ja gerade die auffallende Erscheinung, dass die Zahl
der Sklaven zur Zahl der Herren nicht in g e r a d e n , sondern vielmehr in u m g e k e h r t em Verhältnisse
steht: die stärksten Kolonien haben die relativ g e r in g s t e , die schwächsten die relativ g r ö s s t e
Sklavenzahl. Ich hatte hieraus geschlossen, dass F . sanguinea ihren eigenen Arbeitermangel durch
Raub fremder Sklavenpuppen zu ersetzen suche, was ohne irgend eine Wahrnehmung dieses Bedürfnisses
unmöglich ist. Als Gegenbeweis führt Bethe das Zablenverhältnis zwisohen den Mäusen und
Bussarden, den Nonnen nnd den Kuckucken an, wobei er sich selber widerlegt; denn; je mehr Mäuse’
um so mehr Bussarde;Bs mehr IJonnen, um so mehr Kuckucke; aber je mehr Herren, um so
w o n ig e r Sklaven.
Bethe verweist ferner zur Stütze seiner Reflextheorie und zur Widerlegung meiner früheren
Beweise für das sinnliche Erkenntniss- und Strebevermögen der Ameisen auf die „anderen Lebens-
ersoheinungen der Ameisen“, die er in den vorigen Kapiteln seiner Studie als blosse Reflexthätigkeiten
erklärt habe. Halten wir nochmals einen Rückblick über diese „Beweise". Der erste und hauptsächlichste
derselben, das Fundament seiner ganzen Argumentation, hatte gelautet „nicht erlernt, also
reflex.iil; Dieser angebliche Beweis hat sich als ein Fehlschluss heraüsgestellt. Mit den übrigen steht
es nicht viel besser. Es wurde in den vorigen Kapiteln dieser Studie im Einzelnen nachgewiesen,
dass Bethe’s Reflextheorie nicht einmal die einfachsten Erscheinungen des Ameisenlebens auch nur
einigermassen befriedigend erklärt..' Man möge d ieB o ft gegebene Kritik seiner Erklärungsversuche
über das gegenseitige „Erkennen“ der Ameisen? 'durch ¿blosse Chemoreflexe“, über das Finden dos
Weges durch „den reflektorischen Reiz einer polarisirten chemisohen Spur“, über das Hin- und Zurückgehen
der Ameisen durch die „reflektorisohe Wirkung der Belastung oder der Niohtbelastung“ u. s. w.
nochmals vergleichen und dann darüber||ntscheiden, in wie weit Herrn Bethe „hier“ sein Beweis geglückt
oder missglückt is t Die allzu leichte Weise, wie er mit den Yersuchen Lubbooks und anderen
längst gekannten thatsächlichen Belegen für das Mittheilungsvermögen-der Ameisen verfuhr, sei hier
ebenfalls Erinnerung gebracht. Die stets wiederholte Behauptung, es existire nichts derartiges, was
über eine blosse Reflexthätigkeit hinausgehe, wird man wohl nicht an Beweisesstelle annehmen können.
Ich bedauere, dass Herr Bethe seine hübschen Experimente mit derartigen Schlussfolgerungen
verbunden hat. Wäre er ebenso skeptisch gewesen gegen seine eigenen Schlüsse wie er gegen diejenigen
anderer Beobachter war,; so würde er wohl wenige*S|eue und weniger weittragende, dafür aber
r i c h t ig e r e Sätze als Ergebniss seiner Versuche aufgestellt haben.
Bethe hat es versucht, auf dem thierpsychologischen Gebiete die neuen Bahnen der Reflextheorie
zu wandeln. Wo das Neue durch gute Gründe gestützt wird, nehme ich es ebenfalls gerne an; ich bin
kein Freund des Alten, weil es a lt ist, sondern nur soweit es w a h r ist und den Fortschritten der
modernen Forschung entspricht. Daher bin auch ich in der Erklärung des psychischen Lebens der
Thiere, speciell in der näheren Begriffsbestimmung des Instinktes (58, Kap. 2 u.f%), in einer selbstständigen
Weise vorgegangen; aber ich hielt es auch für nöthig, meine von früheren Ansichten abweichende
Meinung s c h a r t u n d k la r l o g i s c h zu b eg r ii-n d en . Dies ist es eben, was ich bei
Herrn Bethe's neuer Theorie vermisse.
Bethe hat durch den Fehlschluss „ n ich t e r l e r n t , a ls o r e f l e x “ das ganze Gebiet'des
ehemaligen Instinktes willkürlich in blosse Reflexthätigkeit verwandelt (vgl. oben S. 5 ff.). Er sagt
dies auch direkt auf S. 24 seiner Studie, wo er den bisherigen „Instinkt“ für „nichts anderes als
Reflex“ erklärt und gegenüber Ziegler meint, es sei viel besser, für das Wort Instinkt „das nicht gut
misszuverstehende Wort „komplicirter oder zusammengesetzter Reflex" zu gebrauchen“. Bereits Ro-
manes1) hatte gegenüber dem Spencerschen Versuche, den Instinkt für blosse Reflexthätigkeit zu erklären,
die treffende Bemerkung gemacht: „Einen Spaten eine Keule zu nennen und dann zu schliessen,
’) Die geistige Entwicklung im Thierreioh. Leipzig 1885. S. 283.