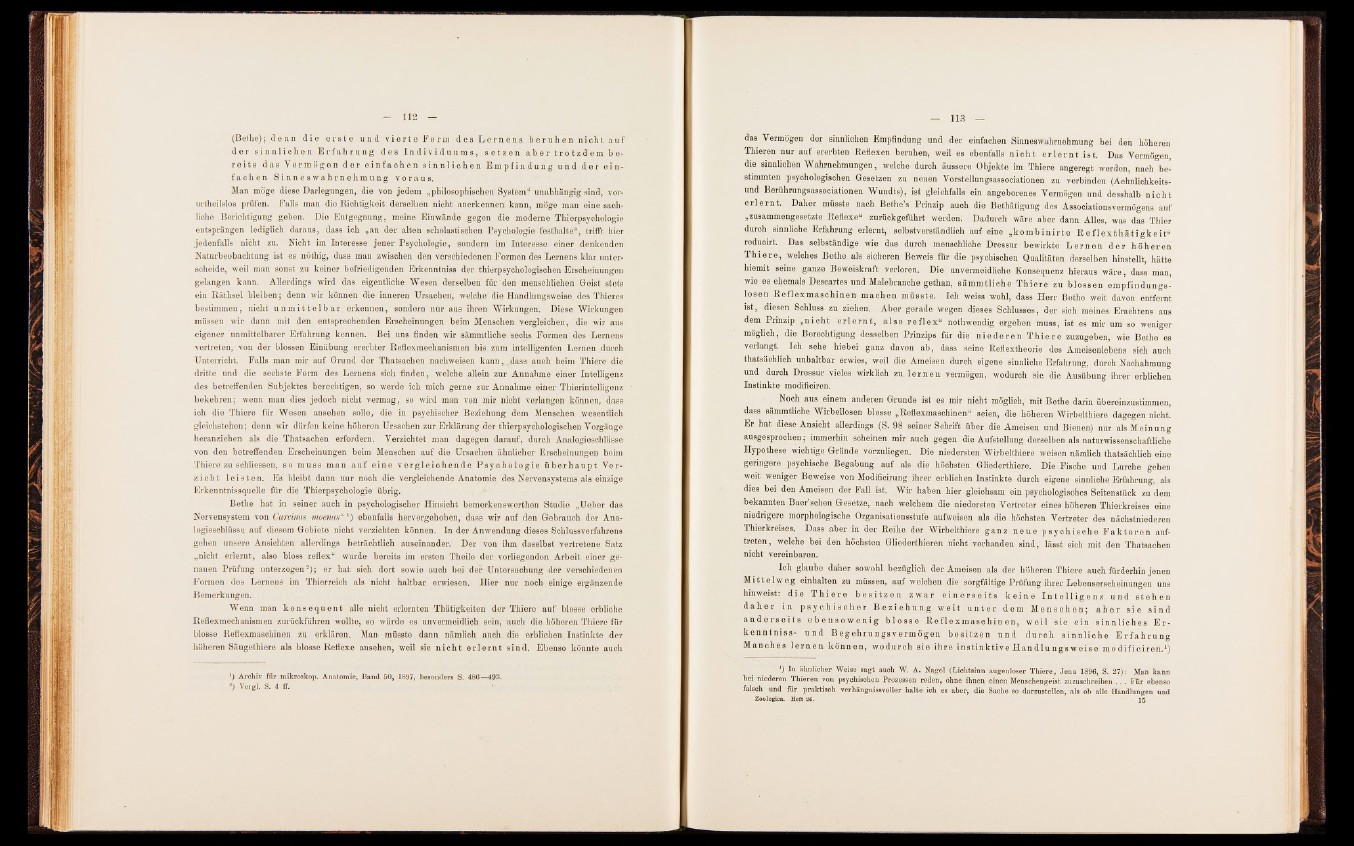
v (B e th e ); d e n n d i e e r s t e u n d v i e r t e F o rm d e s L e r n e n s b e r u h e n n ic h t a u f
d e r s i n n l i c h e n E r f a h r u n g d e s I n d i v i d u u m s , s e t z e n a b e r t r o t z d e m b e r
e i t s d a s V e rm ö g e n d e r e i n f a c h e n s i n n l i c h e n E m p f in d u n g u n d d e r e i n f
a c h e n S in n e s w a h r n e h m u n g v o r a u s .
Man möge diese Darlegungen, die von jedem „philosophischen System“ unabhängig sind, vo'r-
urtheilslos prüfen. Falls man die Richtigkeit derselben nicht anerkennen: kann, möge man eine sachliche
Berichtigung geben. Die Entgegnung, meine Einwände gegen die moderne Thierpsycholögie
entsprängen lediglich daraus, dass ich. „an der alten scholastischen Psychologie festhalte“, trifft hier
jedenfalls nicht zu. Nicht im Interesse jener Psychologie, sondern im Interesse einer denkenden
Naturbeobachtung ist es nöthig, dass man zwischen den verschiedenen Formen des Lernens klar unterscheide,
weil man sonst zu keiner befriedigenden Erkenntniss der thierpsychologischen Erscheinungen
gelangen kann. Allerdings wird das eigentliche Wesen derselben für den mensöhlichen Geist, stets
ein Räthsel bleiben; denn wir können die inneren Ursachen, welche die Handlungsweise des Thieres
bestimmen, nicht u n m i t t e l b a r erkennen, sondern nür aus ihren Wirkungen. Diese Wirkungen
müssen wir dann mit den entsprechenden Erscheinungen beim Menschen Vergleichen, 'die wir aus
eigener unmittelbarer Erfahrung kennen. Bei uns finden wir sämmtliche sechs Formen des Lernens
vertreten, von der blossen Einübung ererbter Reflexmechanismen bis zum intelligenten Lernen durch
Unterricht. Falls man mir auf Grund der Thatsachen nachweisen kann, „dass auch beim Thiere die
dritte und die sechste Form des Lernens sich finden, welche allein zur Annahme einer Intelligenz
des betreffenden Subjektes berechtigen, so werde ich mich gerne zur Annahme einer Thierintelligenz
bekehren; wenn man dies jedoch nicht vermag, so wird man von mir nicht verlangen können, dass
ich die Thiere für Wesen ansehen solle, die in psychischer Beziehung dem Menschen wesentlich
gleichstehen; denn wir dürfen keine höheren Ursachen zur Erklärung der thierpsychologischeü Vorgänge
heranziehen als die Thatsachen erfordern. Verzichtet man dagegen darauf, durph Analogieschlüsse
von den betreffenden Erscheinungen beim Menschen auf die Ursachen ähnlicher Erscheinungen beim
Thiere zu schliessen, so m u s s man a u f e in e v e r g l e i c h e n d e P s y c h o l o g i e ü b e r h a u p t V e r z
i c h t l e i s t e n . Es bleibt dann nur noch die vergleichende Anatomie des Nervensystems als einzige
Erkenntnissquelle für die Thierpsychologie übrig.
Bethe hat in seiner auch in psychologischer Hinsicht bemerkenswerthen Studie „Ueber das
Nervensystem von Cardnus moenas11 *) ebenfalls hervorgehoben, dass wir auf den Gebrauch der Analogieschlüsse
auf diesem Gebiete nicht verzichten können. In der Anwendung dieses Schlussverfahrens
gehen unsere Ansichten allerdings beträchtlich auseinander. Der von ihm daselbst vertretene Satz
„nicht erlernt, also bloss reflex“ wurde bereits im ersten Theile der vorliegenden Arbeit einer genauen
Prüfung unterzogen2); er hat sich dort sowie auch bei der Untersuchung der verschiedenen!
Formen des Lernens im Thierreich als nicht haltbar erwiesen. Hier nur noch einige ergänzende
Bemerkungen.
Wenn man k o n s e q u e n t alle nicht erlernten Thätigkeiten der Thiere auf blosse erbliche
Reflexmechanismen Zurückführen wollte, so würde es unvermeidlich sein; auch die höheren Thiere für
blosse Reflexmaschinen zu erklären. Man- müsste dann nämlich auch die erblichen Instinkte der
höheren Säugethiere als blosse Reflexe ansehen, weil sie n i c h t e r l e r n t s in d . Ebenso könnte auch
*) Archiv für mikroskop. Anatomie, Band 50, 1897, besonders S. 486—493.
I Vergl. S. 4 ff. ' •
das Vermögen der sinnlichen Empfindung und der einfachen Sinneswahrnehmung bei den höheren
Thieren nnr auf ererbten Reflexen beruhen, weil es ebenfalls n i c h t e r l e r n t is t . Das Vermögen,
die sinnhohen Wahrnehmungen, welohe durch äussere Objekte: im Thiere angeregt werden, nach bestimmten
psychologischen Gesetzen zu neuen Vorstellungsassociationen zu verbinden (Aehnlichkeits-
und Berührungsassociationen Wundts), ist gleichfalls ein angeborenes Vermögen und desshalb n ic h t
e r le r n t . Daher müsste naoh Bethe’s Prinzip auch die Bethätigung des Associationsvermögens auf
„zusammengesetzte Reflexe“ znrückgeführt werden. Dadurch wäre aber dann Alles, was das Thier
durch sinnhohe Erfahrung erlernt, selbstverständlich auf eine „ k om b in ir t e R e f l e x t h ä t i g k e i t “
reducirt. Das selbständige wie das durch menschliche Dressur bewirkte L e r n e n d e r h ö h e r e n
T h i e r e , welches Bethe. als sioheren Beweis für die pByohischen Qualitäten derselben hinstellt, hätte
hiemit seine ganze Beweiskraft verlören. Die unvermeidliche Konsequenz hieraus wäre, dass man,
wie es ehemals Descartes und Malebranche gethan, säm m tlich e T h ie r e zu b lo s s e n em p fin d u n g s lo
s e n R e fle xm a s c h in e n m a ch en m ü sste . Ich weiss wohl, dass Herr Bethe weit davon entfernt
ist, diesen Schluss zu ziehen. Aber gerade wegen dieses Schlusses, der sich meines Erachtens aus
dem Prmzip5jjnicht e r le r n t ,., a ls o r è f l e x “ nothwéndig ergeben muss, ist es mir um so weniger
möglich, die Berechtigung desselben Prinzips für djS n i e d e r e n fT h i e f e zuzugeben, wie Bethe es
verlangt. Ich sehe hiebei ganz davon ab, dass seine Reflextheorie des Ameisenlebens sich auch
thatsäohlich unhaltbar erwies, weil die Ameisen durch eigene sinnliche Erfahrung, durch Nachahmung
und durch Dressur vieles wirklich zu le rsnen vermögen, wodurch sie die Ausübung ihrer erblichen
Instinkte modificiren.
Noch aus einem anderen Grunde ist es mir nicht möglich, mit Bethe darin übereinzustimmen,
dass sämmtliche Wirbellosen blosse „Reflexmaschinengjaeien, die höheren Wirbeithiere dagegen nicht.
Er hat diese Ansicht allerdings (^S..98 seiner Schrift über die Ameisen und Bienen) nur als Me in un g
ausgesprochen; immerhin soheinen mir auch gegen die Aufstellung derselben als naturwissenschaftliche
Hypothese wichtige Gründe vorzuliegen. Die niedersten Wirbeithiere weisen nämlich thatsächlich eine
geringere psychische Begabung auf als die höchsten Gliederthiere. Die Fisohe und Lurche gehen
weit weniger Beweise von Modificirung ihrer erblichen Instinkte durch eigene sinnliche Erfahrung, als
dies bei den Ameisen der Fall ist. Wir haben hier gleichsam ein psychologisches Seitenstück zu dem
bekannten Baer’schen Gesetze, nach welchem die niedersten Vertreter eines höheren Thierkreises eine
niedrigere morphologische Organisationsstufe aufweisen als die höchsten Vertreter des nächstniederen
Thierkreises. Dass aber in der Reihe der Wirbeithiere g a n z n e u e p s y c h i s c h e F a k t o r e n auf-
treten, welche bei den höchsten Gliederthieren nicht vorhanden sind, läBst sich mit den Thatsachen
nicht vereinbaren.
Ich glaube daher sowohl bezüglich der Ameisen als der höheren Thiere auoh fürderhin jenen
M i t t e lw e g einhalten zu müssen, auf welohen die sorgfältige Prüfung ihrer Lebenserscheinungen uns
hinweist: d i e T h i e r e b e s i t z e n zw a r e i n e r s e i t s k e i n e I n t e l l i g e n z u n d s t e h e n
d a h e r in p s y c h i s c h e r B e z i e h u n g w e i t u n t e r d em M e n s c h e n ; a b e r s i e s in d
a n d e r s e i t s e b e n s o w e n i g b l o s s e R e f l e x m a s c h in e n , w e i l s ie e in s in n l i c h e s E r k
e n n t n i s s - n n d B e g e h r u n g s v e rm ö g e n b e s i t z e n u n d d u r ch s in n l i c h e E r f a h r u n g
M a n c h e s l e r n e n k ö n n en , w od u r ch s ie ih r e in s t in k t iv e H a n d lu n g sw e i s e m o d ific ir e n .* )
1 *j In ähnlicher Weise sagt auch W. A. Nagel (Lichtsinn angenloser Thiere, Jena 1896, -S.. 2 0 K Man kann
bei niederen Thieren von psychischen Prozessen reden, ohne ihnen einen Menschengeist zuzuschreiben . . . Für ebenso
falsch nnd für praktisch verhängnissvoller halte ich es aber, die Sache so darzustellen, als ob alle Handlangen und
Z o o lo g ic a. H e f t 26. 1 5