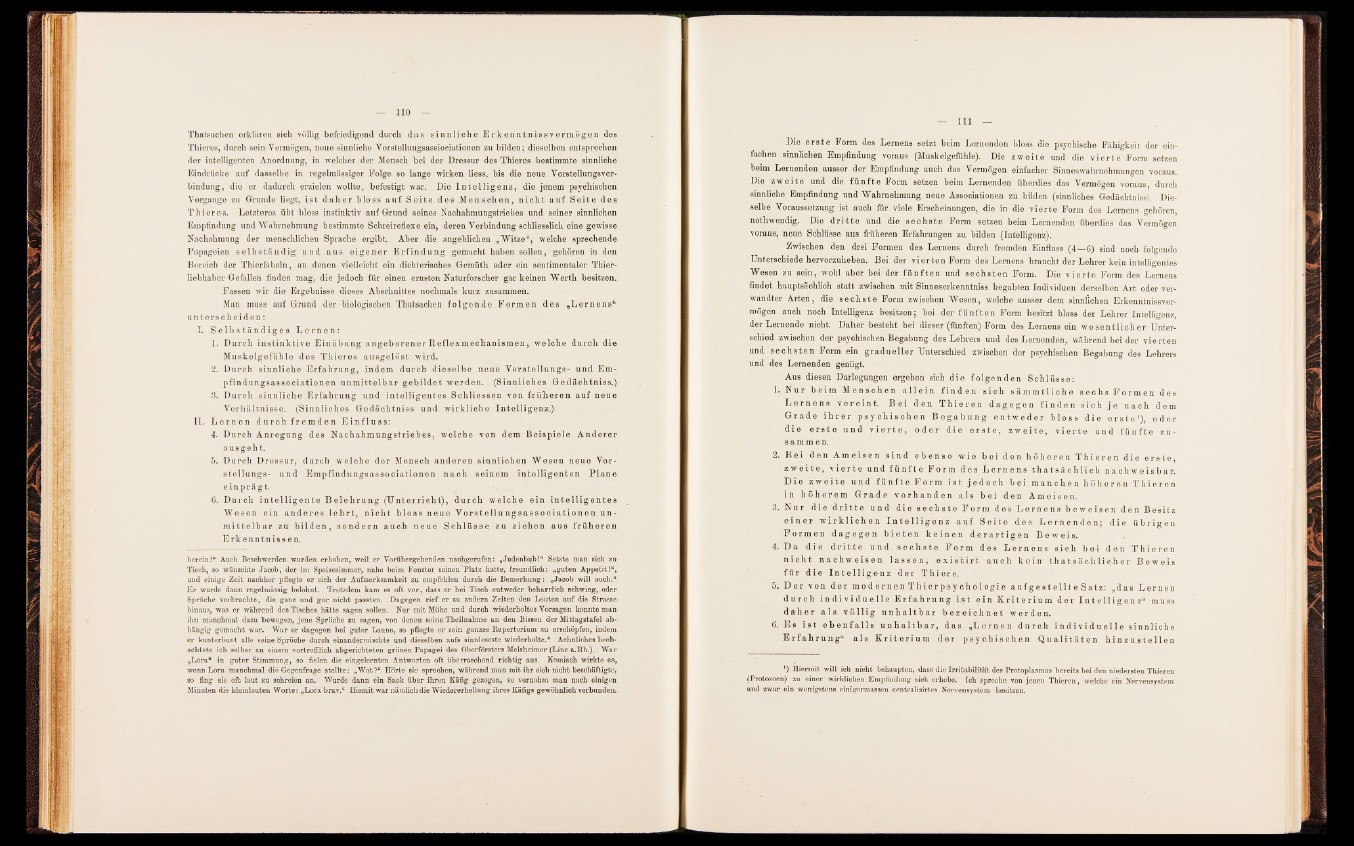
Thatsachen erklären sich völlig befriedigend durch d a s s in n l i c h e E r k e n n t n i s s v e rm ö g e n des
Thieres, durch sein Vermögen, neue sinnliche Vorstellungsassiociationen zu bilden; dieselben entsprechen
der intelligenten Anordnung, in welcher der Mensch bei der Dressur des Thieres bestimmte sinnliche
Eindrücke auf dasselbe in regelmässiger Folge so lange wirken liess, bis die neue Vorstellungsverbindung,
die er dadurch erzielen wollte, befestigt war. Die I n t e l l i g e n z , die jenem psychischen
Vorgänge zu Grunde liegt, i s t d a h e r b lo s s a u f S e i t e d e s M e n s c h e n , n i c h t a u f S e i t e d e s
T h ie r e s . Letzteres übt bloss instinktiv auf Grund seines Nachahmungstriebes und seiner sinnlichen
Empfindung und Wahrnehmung bestimmte Schreireflexe ein, deren Verbindung schliesslich eine gewisse
Nachahmung der menschlichen Sprache ergibt. Aber die angeblichen „Witze“, welche sprechende
Papageien s e lb s t ä n d i g u n d a u s e ig e n e r E r f in d u n g gemacht haben sollen, gehören in den
Bereich der Thierfabeln, an denen vielleicht ein dichterisches Gemüth oder ein sentimentaler Thierliebhaber
Gefallen finden mag, die jedoch für einen ernsten Naturforscher gar keinen Werth besitzen.
Fassen wir die Ergebnisse dieses Abschnittes nochmals kurz zusammen.
Man muss auf Grund der biologischen Thatsachen f o lg e n d e F o rm e n d e s „ L e r n e n s “
u n t e r s c h e id e n :
I. S e l b s t ä n d i g e s L e r n e n :
1. D ur ch in s t in k t iv e E in ü b u n g a n g eb o r en e r ß e f le xm e c h a n ism e n , w e lc h e durch die
M u sk e lg e fü h le d e s T h ie r e s a u s g e lö s t wird.
2. Dur ch s in n lic h e E r fa h ru n g , in d em durch d ie s e lb e n eu e V o r s t e llu n g s - und Em p
fin d u n g s a s s o c ia t io n e n u nm itte lb a r g e b ild e t w e rd en . (S in n lic h e s G e d ä c h tn is s .)
3. D ur ch s in n lic h e E r fah ru n g und in t e l lig e n t e s S c h lie s s e n von f r ü h e r e n a u f n eu e
V e rh ä ltn is s e . (S in n lic h e s G e d ä c h tn is s und w ir k lic h e In te llig e n z .)
II. L e r n e n d u r c h f r em d e n E in f lu s s :
4. Dur ch A n r egu n g d e s N a c h a hm u n g s tr ie b e s , w e lc h e von dem B e i s p ie le A n d e r e r
a u s g e h t.
5. Dur ch D r e s su r , durch w e lc h e der Mensch an d e r en s in n lic h e n W e s e n n eu e Vors
t e llu n g s - u n d E m p f in d u n g s a s s o e ia t io n e n n a c h s e in em in t e l lig e n t e n P la n e
e in p r ä g t .
6. D u r ch in t e l l i g e n t e B e l e h r u n g (U n t e r r ic h t ) , d u r ch w e lc h e e in i n t e l l i g e n t e s
W e s e n e in a n d e r e s l e h r t , n i c h t b lo s s n e u e V o r s t e l l u n g s a s s o c i a t i o n e n u n m
i t t e lb a r zu b i ld e n , s o n d e r n a u c h n e u e S c h lü s s e zu z i e h e n a u s f r ü h e r e n
E r k e n n t n i s s e n .
herein!“ Auch Beschwerden wurden erhoben, weil er Vorübergehenden nachgerufen: „Judenbub!“ Setzte man sieh zu
Tisch, so wünschte Jacob, der im Speisezimmer, nahe beim Fenster seinen Platz hatte, freundlich: „guten Appetit!“,
und einige Zeit nachher pflegte er sich der Aufmerksamkeit zu empfehlen durch die Bemerkung: „Jacob will auch.“
Er wurde dann regelmässig belohnt. Trotzdem kam es oft vor, dass er bei Tisch entweder beharrlich schwieg, oder
Sprüche vorbrachte, die ganz und gar nicht passten. Dagegen rief er zu ändern Zeiten deb Leuten auf die Strasse
hinaus, was er während des Tisches hätte sagen sollen. Nur mit Mühe und durch wiederholtes Vorsagen konnte man
ihn manchmal dazu bewegen, jene Sprüche zu sagen, von denen seine Theilnahme an den Bissen der Mittagstafel abhängig
gemacht war. War er dagegen bei guter Laune, so pflegte er sein ganzes Repertorium zu erschöpfen, indem
er kunterbunt alle seine Sprüche durch einandermischte und dieselben aufs sinnloseste wiederholte.“ Aehnliches beobachtete
ich selber an einem vortrefflich abgerichteten grünen Papagei des Oberförsters Melsheimer (Linz a.Rh.). War
„Lora“ in guter Stimmung, so fielen die eingelernten Antworten oft überraschend richtig aus. Komisch wirkte es,
wenn Lora manchmal die Gegenfrage stellte: „Wat?“ Hörte sie sprechen, während man mit ihr sich nicht beschäftigte,
so fing sie oft laut zu schreien an. Wurde dann ein Sack über ihren Käfig gezogen, so vernahm man nach einigen
Minuten die kleinlauten Worte: „Lora brav.“ Hiemitwar nämlich die Wiedererhellung ihres Käfigs gewöhnlich verbanden.
Die e r s t e Form des Lernens setzt beim Lernenden bloss die psychische Fähigkeit der einfachen
sinnlichen Empfindung voraus (Muskelgefühle). Die z w e i t e und die v i e r t e Form setzen
beim Lernenden ausser der Empfindung auch das Vermögen einfacher Sinneswahrnehmungen voraus.
Die z w e i t e und die f ü n f t e Form setzen beim Lernenden überdies das Vermögen voraus durch
sinnliche Empfindung und Wahrnehmung neue Associationen zu bilden (sinnliches Gedächtniss). Dieselbe
Voraussetzung ist auch für viele Erscheinungen, die in die v ie r t e Form des Lernens gehören
nothwendig. Die d r i t t e und die s e c h s t e Form setzen beim Lernenden überdies das Vermögen
voraus, neue Schlüsse aus früheren Erfahrungen zu bilden (Intelligenz).
Zwischen den drei Formen des Lernens durch fremden Einfluss (4—6) sind noch folgende
Unterschiede hervorzuheben. Bei der v ie r t e n Form des Lernens braucht der Lehrer kein intelligentes
Wesen zu sein, wohl aber bei der f ü n f t e n und s e c h s t e n Form. Die v i e r t e Form des Lernens
findet liauptsächlich statt zwischen mit Sinneserkenntniss begabten Individuen derselben Art oder verwandter
Arten, die s e c h s t e Form zwischen Wesen, welche ausser dem sinnlichen Erkenntnissver-
roögen auch noch Intelligenz besitzen; bei der fü n f t e n Form besitzt bloss der Lehrer Intelligenz
der Lernende nicht. Daher besteht bei dieser (fünften) Form des Lernens ein w e s e n t l i c h e r Unterschied
zwischen der psychischen Begabung des Lehrers und des Lernenden, während bei der v ie r ten
und s e c h s t e n Form ein g r a d u e lle r Unterschied zwischen der psychischen Begabung des Lehrers
und des Lernenden genügt.
Aus diesen Darlegungen ergeben sich d ie f o lg e n d e n S c h lü s s e :
1. N u r b e im M e n s c h e n a l l e i n f i n d e n s i c h s ä m m t l i c h e s e c h s F o rm e n d e s
L e r n e n s v e r e in t . B e i d e n T h i e r e n d a g e g e n f i n d e n s i c h j e n a c h d em
G r a d e ih r e r p s y c h i s c h e n B e g a b u n g e n tw e d e r b l o s s d i e e r s t e 1), o d e r
d i e e r s t e u n d v i e r t e , o d e r d i e e r s t e ^ z w e i t e , v i e r t e u n d f ü n f t e z u s
am m e n .
2. B e i d e n A m e i s e n s in d e b e n s o w i e b e i d e n h ö h e r e n T h i e r e n d i e e r s t e
z w e i t e , v i e r t e u n d f ü n f t e F o rm d e s L e r n e n s t h a t s ä c h l i c h n a c h w e i s b a r .
D i e z w e i t e u n d f ü n f t e F o rm i s t j e d o c h b e i m a n c h e n h ö h e r e n T h i e r e n
in h ö h e r em G r a d e v o r h a n d e n a l s b e i d e n A m e i s e n .
3. N u r d i e d r i t t e u n d d i e s e c h s t e F o rm d e s L e r n e n s b e w e i s e n d e n B e s i t z
e i n e r w i r k l i c h e n I n t e l l i g e n z a u f S e i t e d e s L e r n e n d e n ; d i e ü b r i g e n
F o rm e n d a g e g e n b i e t e n k e i n e n d e r a r t i g e n B e w e i s .
4. D a d i e d r i t t e u n d s e c h s t e F o rm d e s L e r n e n s s i c h b e i d e n T h i e r e n
n i c h t n a c h w e i s e n l a s s e n ; e x i s t i r t a u c h k e i n t h a t s ä c h l i c h e r B e w e i s
fü r d i e I n t e l l i g e n z d e r T h i e r e .
5 i D e r v o n d e r m o d e r n e n T h i e r p s y c h o l o g i e a u f g e s t e l l t e S a t z : „ d a s L e r n e n
d u r c h i n d i v i d u e l l e E r f a h r u n g i s t e in K r i t e r iu m d e r I n t e l l i g e n z “ m u ss
d a h e r a l s v ö l l i g u n h a l t b a r b e z e i c h n e t w e r d e n .
6. E s i s t e b e n f a l l s u n h a l t b a r , d a s „ L e r n e n d u r c h i n d i v i d u e l l e s in n l i c h e
E r f a h r u n g “ a l s K r i t e r iu m d e r p s y c h i s c h e n Q u a l i t ä t e n h i n z u s t e l l e n
*) Hiermit will ich nicht behanpten, dass die Irritabilität des Protoplasmas bereits bei den niedersten Thieren
(Protozoen) zu einer wirklichen Empfindung sich erhebe. Ich spreche von jenen Thieren, welche ein Nervensystem
und zwar ein wenigstens einigermassen centralisirtes Nervensystem besitzen.