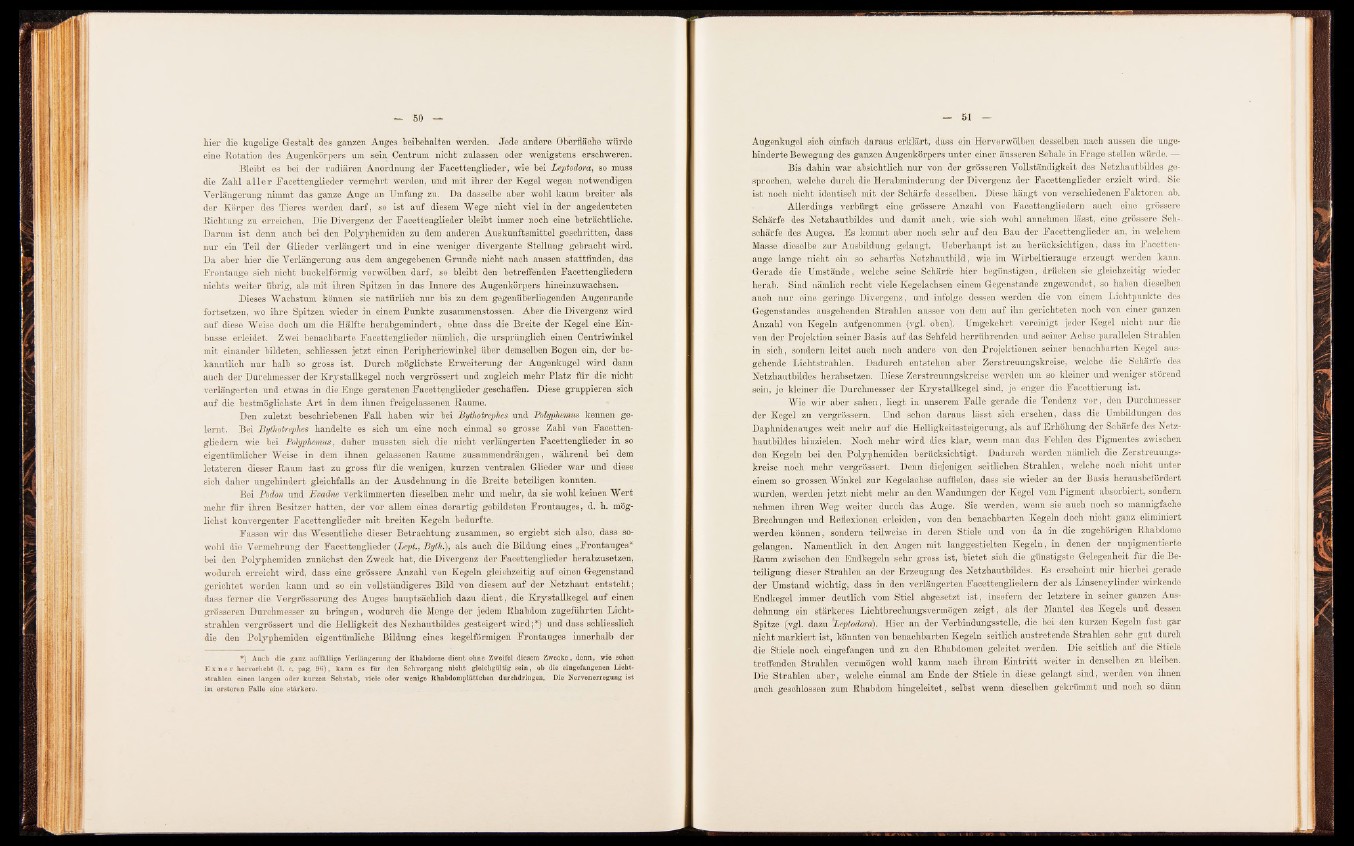
liier die kugelige Gestalt des ganzen Auges beibehalten werden. Jede andere Oberfläche würde
eine Rotation des Augenkörpers um sein Centrum nickt zulassen oder wenigstens erschweren.
Bleibt es bei der radiären Anordnung der Facettenglieder, wie bei Leptodora, so muss
die Zahl a l l e r Facettenglieder vermehrt werden, und mit ihrer der Kegel wegen notwendigen
Verlängerung nimmt das ganze Auge an Umfang zu. Da dasselbe aber wohl kaum breiter als
der Körper des Tieres werden darf, so is t auf diesem Wege nicht v ie l in der angedeuteten
Richtung zu erreichen., Die Divergenz der Facettenglieder bleibt immer noch eine beträchtliche.
Darum is t denn auch bei den Polyphemiden zu dem anderen Auskunftsmittel geschritten, dass
nur ein Teil der Glieder verlängert und in eine weniger divergente Stellung gebracht wird.
Da aber hier die Verlängerung aus dem angegebenen Grunde nicht nach aussen stattfinden, das
Frontauge sich nicht buckelförmig vorwölben darf, so bleibt den betreffenden Facettengliedern
nichts weiter übrig, als mit ihren Spitzen in das Innere des Augenkörpers hineinzuwachsen.
Dieses Wachstum können sie natürlich nur bis zu dem gegenüberliegenden Augenrande
fortsetzen, wo ihre Spitzen wieder in . einem Punkte zusammenstossen. Aber die Divergenz wird
auf diese Weise doch um die Hälfte herabgemindert, ohne dass die Breite der Kegel eine Einbusse
erleidet. Zwei benachbarte Facettenglieder nämlich, die ursprünglich einen Centriwinkel
mit einander bildeten, schliessen jetzt einen Peripheriewinkel über demselben Bogen ein, der bekanntlich
nur halb so gross ist. Durch möglichste Erweiterung der Augenkugel wird dann
auch der Durchmesser der Krystallkegel noch vergrössert und zugleich mehr Platz für die nicht
verlängerten und etwas in die Enge geratenen Facettenglieder geschaffen. Diese gruppieren sich
a u f die bestmöglichste A r t in dem ihnen freigelassenen Raume.
Den zuletzt beschriebenen F a ll haben wir bei Bythotrephes und Polyphemus kennen gelernt.
Bei Bythotrephes handelte es sich um eine noch einmal so grosse Zahl von Facettengliedern
wie bei Polyphemus, daher mussten sich die nicht verlängerten Facettenglieder in so
eigentümlicher Weise in dem ihnen gelassenen Raume zusammendrängen, während bei dem
letzteren dieser Raum fast zu gross für die wenigen, kurzen ventralen Glieder war und diese
sich daher ungehindert gleichfalls an der Ausdehnung in die Bre ite beteiligen konnten.
Bei Podon und Evadne verkümmerten dieselben mehr und mehr, da sie wohl keinen Wer t
mehr für ihren Besitzer hatten, der vor allem eines derartig gebildeten Frontauges, d. h. möglichst
konvergenter Facettenglieder mit breiten Kegeln bedurfte.
Fassen wir das Wesentliche dieser Betrachtung zusammen, so ergiebt sich also, dass sowohl
die Vermehrung der Facettenglieder (.Lept., Byih.), als auch die Bildung eines „Frontauges“
bei den Polyphemiden zunächst den Zweck hat, die Divergenz der Facettenglieder herabzusetzen,
wodurch erreicht wird, dass eine grössere Anzahl von Kegeln gleichzeitig auf einen Gegenstand
gerichtet werden kann und so ein vollständigeres Bild von diesem auf der Netzhaut entsteht;
dass ferner die Vergrösserung des Auges hauptsächlich dazu dient, die K ry sta llk eg el auf einen
grösseren Durchmesser zu bringen, wodurch die Menge der jedem Rhabdom zugeführten Lichtstrahlen
vergrössert und die Helligkeit des Nezhautbildes gesteigert wird;*) und dass schliesslich
die den Polyphemiden eigentümliche Bildung eines kegelförmigen Frontauges innerhalb der
*) Auch die ganz auffällige Verlängerung der Rhabdome dient ohne Zweifel diesem Zwecke, denn, wie schon
E x n e r hervorhebt (1. c. pag. 96), kann es für den Sehvorgang nicht gleichgültig sein, ob die eingefangenen Lichtstrahlen
einen langen oder kurzen Sehstab, viele oder wenige Rhabdomplättchen durchdringen. Die Nervenerregung ist
im ersteren Falle eine stärkere.
Augenkugel sich einfach daraus erklärt, dass ein Hervorwölben desselben nach aussen die ungehinderte
Bewegung des ganzen Augenkörpers unter einer äusseren Schale in F rage stellen würde. —
Bis dahin war absichtlich nur von der grösseren Vollständigkeit des Netzhautbildes gesprochen,
welche durch die Herabminderung der Divergenz der Facettenglieder erzielt wird. Sie
ist noch nicht identisch mit der Schärfe desselben^ Diese hängt von verschiedenen Faktoren ab.
Allerdings verbürgt eine grössere Anzahl von Facettengliedern auch eine grössere
Schärfe des Netzhautbildes uud damit auch, wie sich wohl annehmen lässt, eine grössere Seh-.
schärfe des Auges. Es kommt aber noch sehr auf den Bau der Facettenglieder an, in welchem
Masse dieselbe zur Ausbildung gelangt. Ueberhaupt is t zu berücksichtigen, dass im Facettenauge
lange nicht ein so scharfes Netzhautbild, wie im Wirbeltierauge erzeugt werden kann.
Gerade die Umstände, welche seine Schärfe hier begünstigen, drücken sie gleichzeitig wieder
herab. Sind nämlich recht viele Kegelachsen einem Gegenstände zugewendet, so haben dieselben
auch nur eine geringe Divergenz, und infolge dessen werden die von einem Lichtpunkte des
Gegenstandes ausgehenden Strahlen ausser von dem auf ihn gerichteten noch von einer'ganzen
Anzahl von Kegeln aufgenommen (vgl. oben). Umgekehrt vereinigt jeder Kegel nicht nur die
von der Projektion seiner Basis auf das Sehfeld herrührenden und seiner Achse parallelen Strahlen
in sich, sondern le itet auch noch andere von den Projektionen seiner benachbarten Kegel ausgehende
Lichtstrahlen. Dadurch entstehen aber Zerstreuungskreise, welche die Schärfe des
Netzhautbildes herabsetzen. Diese Zerstreuungskreise werden um so kleiner und weniger störend
sein, je kleiner die Durchmesser der K ry sta llk eg el sind, je enger die Facettierung ist.
Wie w ir aber sahenf:Üegt in unserem F a lle gerade die Tendenz v o r , den Durchmesser
der Kegel zu vergrössem. Und schon daraus lässt sich ersehen, dass die Umbildungen des
Daphnidenauges weit mehr auf die Helligkeitssteigerung, als auf Erhöhung der Schärfe des Netzhautbildes
hinzielen. Noch mehr wird dies klar, wenn man das Fehlen des Pigmentes zwischen
den Kegeln bei den Polyphemiden berücksichtigt. Dadurch werden nämlich die Zerstreuungskreise
noch mehr vergrössert. Denn diejenigen seitlichen Strahlen, welche noch nicht unter
einem s o . grossen Winkel zur Kegelachse auffielen, dass sie wieder an der Basis herausbefördert
wurden, werden je tz t nicht mehr an den Wandungen der Kegel vom Pigment absorbiert, sondern
nehmen ihren Weg weiter durch das Auge. Sie werden, wenn sie auch noch sö mannigfache
Brechungen und Reflexionen erleiden, von den benachbarten Kegeln doch nicht ganz eliminiert
werden können, sondern teilweise in deren S tiele und von da in die zugehörigen Rhabdome
gelangen. Namentlich in den Augen mit. langgestielten Kegeln, in denen der unpigmentierte
Raum zwischen den Endkegeln sehr gross ist, bietet sich die günstigste Gelegenheit für die Beteiligung
dieser Strahlen an der Erzeugung des Netzhautbildes. Es erscheint mir hierbei gerade
der Umstand wichtig, dass in den verlängerten Facettengliedern der als Linsencylinder wirkende
Endkegel immer deutlich vom S tie l abgesetzt i s t , insofern der letztere in seiner ganzen Ausdehnung
ein stärkeres Lichtbrechungsvermögen z e ig t, als der Mantel des Kegels und dessen
Spitze, (vgl. dazu *Leptodora). Hier an der Verbindungsstelle, die bei den kurzen Kegeln fast gar
nicht markiert ist, könnten von benachbarten Kegeln seitlich austretende Strahlen sehr gut durch
die Stiele noch eingefangen und zu den Rhabdomen g eleitet werden.. Die seitlich auf die Stiele
treffenden Strahlen vermögen wohl kaum nach ihrem Ein tr itt weiter in denselben zu bleiben.
D ie Strahlen aber, welche einmal am Ende der Stiele in diese gelangt sind, werden von ihnen
auch geschlossen zum Rhabdom hingeleitet , selbst wenn dieselben gekrümmt und noch so dünn