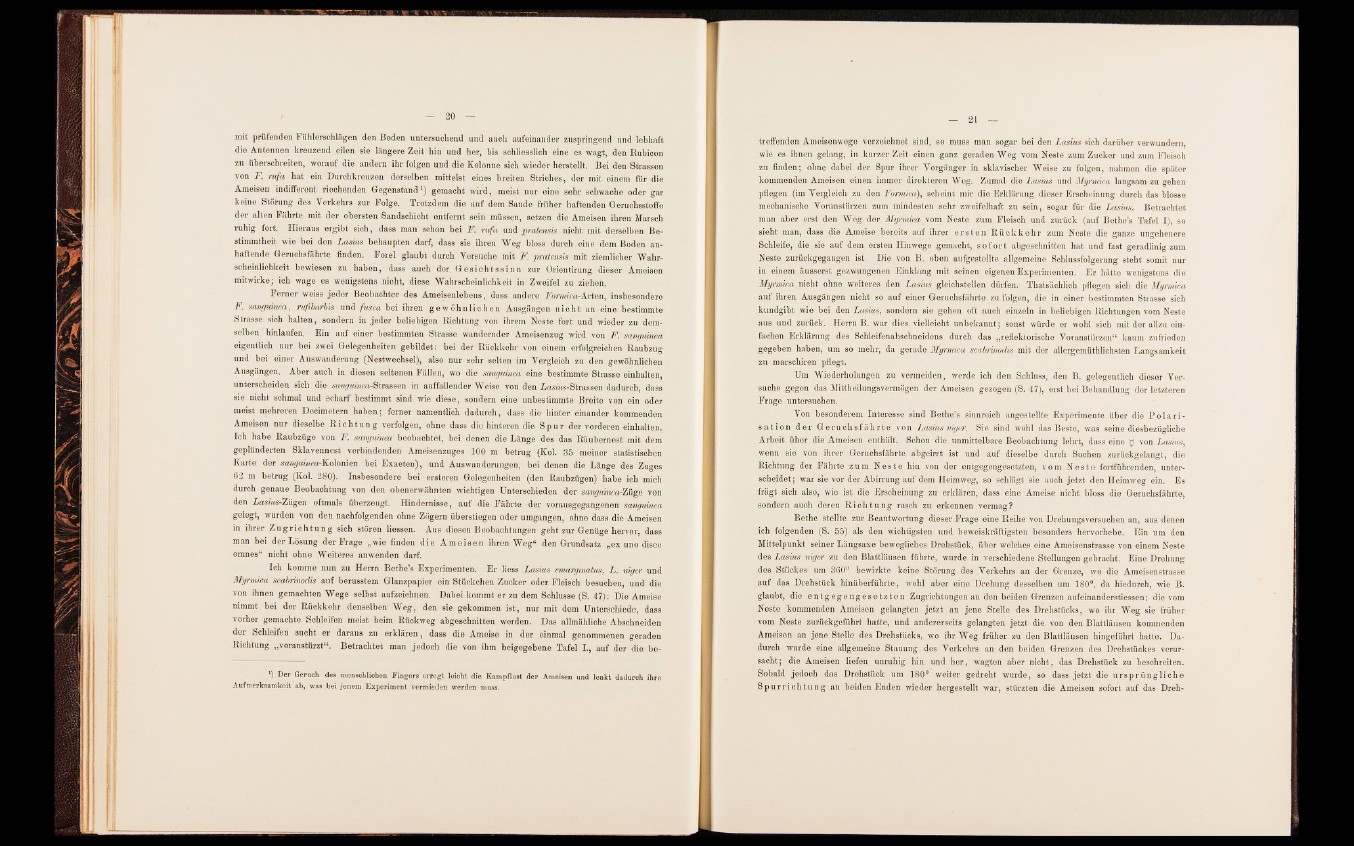
mit prüfenden Fühlerschlägen den Boden untersuchend und auch aufeinander zuspringend und lebhaft
die Antennen kreuzend eilen sie längere Zeit hin und her, bis schliesslich eine es wagt, den Rubicon
zu überschreiten, worauf die ändern ihr folgen und die Kolonne sich wieder herstellt. Bei den Strassen
von F . rufa hat ein Durchkreuzen derselben mittelst eines breiten Striches, der mit einem für die
Ameisen indifferent riechenden Gegenstand1) gemacht wird, meist nur eine sehr schwache oder gar
keine Störung des Verkehrs zur Folge. Trotzdem die auf dem Sande früher haftenden Geruchsstoffe
der alten Fährte mit der obersten Sandschicht entfernt sein müssen, setzen die Ameisen ihren Marsch
ruhig fort. Hieraus ergibt sich, dass man schon bei F. rufa und pratensis nicht mit derselben Bestimmtheit
wie bei den Lasitts behaupten darf, dass sie ihren Weg bloss durch eine dem Boden anhaftende
Geruchsfährte finden. Forel glaubt durch Versuche mit F. pratensis mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit
bewiesen zu haben, dass auch der G e s i c h t s s in n zur Orientirung dieser Ameisen
mitwirke; ich wage es wenigstens nicht, diese Wahrscheinlichkeit in Zweifel zu ziehen.
Ferner weiss jeder Beobachter des Ameisenlebens, dass andere Formica-Arben, insbesondere
F. sanguinea, rufibarbis und fusca bei ihren g e w ö h n l i c h e n Ausgängen n ic h t an eine bestimmte
Strasse sich halten, sondern in jeder beliebigen Richtung von ihrem Neste fort und wieder zu demselben
hinlaufen. Ein auf einer bestimmten Strasse wandernder Ameisenzug wird von F. sanguinea
eigentlich nur bei zwei Gelegenheiten gebildet: bei der Rückkehr von einem erfolgreichen Raubzug
und bei einer Auswanderung (Nestwechsel), also nur sehr selten im Vergleich zu den gewöhnlichen
Ausgängen. Aber auch in diesen seltenen Fällen, wo die sanguinea eine bestimmte Strasse einhalten,
unterscheiden sich die scmgwrcea-Strassen in auffallender Weise von den Xasms-Strassen dadurch, dass
sie nicht schmal und scharf bestimmt sind wie diese, sondern eine unbestimmte Breite von ein oder
meist mehreren Decimetern haben; ferner namentlich dadurch, dass die hinter einander kommenden
Ameisen nur dieselbe R i c h t u n g verfolgen, ohne dass die hinteren die S p u r der vorderen einhalten.
Ich habe Raubzüge von F . sanguinea beobachtet, bei denen die Länge des das Räubernest mit dem
geplünderten Sklavenncst verbindenden Ameisenzuges 100 m betrug (Kol. 35 meiner statistischen
Karte der sanguinea-Kolonien bei Exaeten), und Auswanderungen, bei denen die Länge des Zuges
62 m betrug (Kol. 280). Insbesondere bei ersteren Gelegenheiten (den Raubzügen) habe ich mich
durch genaue Beobachtung von den obenerwähnten wichtigen Unterschieden der sanguinea-Züge von
den Lasius-Zügen oftmals überzeugt. Hindernisse, auf die Fährte der vorausgegangenen sanguinea
gelegt, wurden von den nachfolgenden ohne Zögern überstiegen oder umgangen, ohne dass die Ameisen
in ihrer Z u g r ic h tu n g sich stören Hessen. Aus diesen Beobachtungen geht zur Genüge hervor, dass
man bei der Lösung der Frage „wie finden d ie A m e i s e n ihren Weg“ den Grundsatz „ex uno disce
omnes“ nicht ohne Weiteres anwenden darf.
Ich komme nun zu Herrn Bethe’s Experimenten. Er liess Lasius emarginatus, L . niger und
Myrmica scabrinodis auf berusstem Glanzpapier ein Stückchen Zucker oder Fleisch besuchen, und die
von ihnen gemachten Wege selbst aufzeichnen. Dabei kommt er zu dem Schlüsse (S. 47): Die Ameise
nimmt bei der Rückkehr denselben W eg , den sie gekommen ist, nur mit dem Unterschiede, dass
vorher gemachte Schleifen meist beim Rückweg abgeschnitten werden. Das allmähliche Abschneiden
der Schleifen sucht er daraus zu erklären, dass die Ameise in der einmal genommenen geraden
Richtung „voranstürzt“. Betrachtet man jedoch die von ihm beigegebene Tafel I., auf der die be*)
Der Geruch des menschlichen Fingers erregt leicht die Kampflust der Ameisen und lenkt dadurch ihre
Aufmerksamkeit ab, was bei jenem Experiment vermieden werden muss.
treffenden Ameisenwege verzeichnet sind, so muss man sogar bei den Lasius sich darüber verwundern,
wie es ihnen gelang, in kurzer Zeit einen ganz geraden Weg vom Neste zum Zucker und zum Fleisch
zu finden; ohne dabei der Spur ihrer Vorgänger in sklavischer Weise zu folgen, nahmen die später
kommenden Ameisen einen immer direkteren Weg. Zumal die Lasius und Myrmica langsam zu gehen
pflegen (im Vergleich zu den Formica), scheint mir die Erklärung dieser Erscheinung durch das blosse
mechanische Voranstürzen zum mindesten sehr zweifelhaft zu sein, sogar für die Lasius. Betrachtet
man aber erst den Weg der Myrmica vom Neste zum Fleisch und zurück (auf Bethe’s Tafel I), so
sieht man, dass die Ameise bereits auf ihrer e r s t e n R ü c k k e h r zum Neste die ganze ungeheuere
Schleife, die sie auf dem ersten Hinwege gemacht, s o f o r t abgeschnitten hat und fast geradlinig zum
Neste zurückgegangen ist; Die von B. oben aufgestellte allgemeine Schlussfolgerung steht somit nur
in einem äusserst gezwungenen Einklang mit seinen eigenen Experimenten. Er hätte wenigstens die
Myrmica nicht ohne weiteres den Lasius gleichstellen dürfen. Thatsächlich pflegen sich die Myrmica
auf ihren Ausgängen nicht so auf einer Geruchsfährte zu folgen, die in einer bestimmten Strasse sich
kundgibt wie bei den Lasius, sondern sie gehen oft auch einzeln in beliebigen Richtungen vom Neste
aus und zurück. Herrn B. war dies vielleicht unbekannt ; sonst würde er wohl sich init der allzu einfachen
Erklärung des Schleifenabschneidens durch das „reflektorische Voranstürzen“ kaum zufrieden
gegeben haben, um so mehr, da gerade Myrmica scabrinodis mit der allergemüthlichsten Langsamkeit
zu marschiren pflegt.
Um Wiederholungen zu vermeiden, werde ich den Schluss, den B. gelegentlich dieser Versuche
gegen das Mittheilungsvermögen der Ameisen gezogen (S. 47), erst bei Behandlung der letzteren
Frage untersuchen.
Von besonderem Interesse sind Bethe’s sinnreich angestellte Experimente über die P o l a r i s
a t i o n d e r G e r u c h s f ä h r t e von Lasius niger. Sie sind wohl das Beste, was seine diesbezügliche
Arbeit über die Ameisen enthält. Schon die unmittelbare Beobachtung lehrt, dass eine g von Lasius,
wenn sie von ihrer Geruchsfährte abgeirrt ist und auf dieselbe durch Suchen zurückgelangt, die
Richtung der Fährte zum N e s t e hin von der entgegengesetzten, vom N e s t e fortführenden, unterscheidet;
war sie vor der Abirrung auf dem Heimweg, so schlägt sie auch jetzt den Heimweg ein. Es
frägt sich also, wie ist die Erscheinung zu erklären, dass eine Ameise nicht bloss die Geruchsfährte,
sondern auch deren R i c h t u n g rasch zu erkennen vermag?
Bethe stellte zur Beantwortung dieser Frage eine Reihe von Drehungsversuchen an, aus denen
ich folgenden (S. 55) als den wichtigsten und beweiskräftigsten besonders hervorhebe. Ein um den
Mittelpunkt seiner Längsaxe bewegliches Drehstück, über welches eine Ameisenstrasse von einem Neste
des Lasius niger zu den Blattläusen führte, wurde in verschiedene Stellungen gebracht. Eine Drehung
des Stückes um 360° bewirkte keine Störung des Verkehrs an der Grenze, wo die Ameisenstrasse
auf das Drehstück hinüberführte, wohl aber eine Drehung desselben um 180°, da hiedurch, wie B.
glaubt, die e n t g e g e n g e s e t z t e n Zugrichtungen an den beiden Grenzen aufeinanderstiessen: die vom
Neste kommenden Ameisen gelangten jetzt an jene Stelle des Drehstücks, wo ihr Weg sie früher
vom Neste zurückgeführt hatte, und andererseits gelangten jetzt die von den Blattläusen kommenden
Ameisen an jene Stelle des Drehstücks, wo ihr Weg früher zu den Blattläusen hingeführt hatte. Dadurch
wurde eine allgemeine Stauung des Verkehrs an den beiden Grenzen des Drehstückes verursacht;
die Ameisen liefen unruhig hin und her, wagten aber nicht, das Drehstück zu beschreiten.
Sobald jedoch das Drehstück um 180° weiter gedreht wurde, so dass jetzt die u r s p r ü n g l ic h e
S p u r r ic h tu n g an beiden Enden wieder hergestellt war, stürzten die Ameisen sofort auf das Dreh