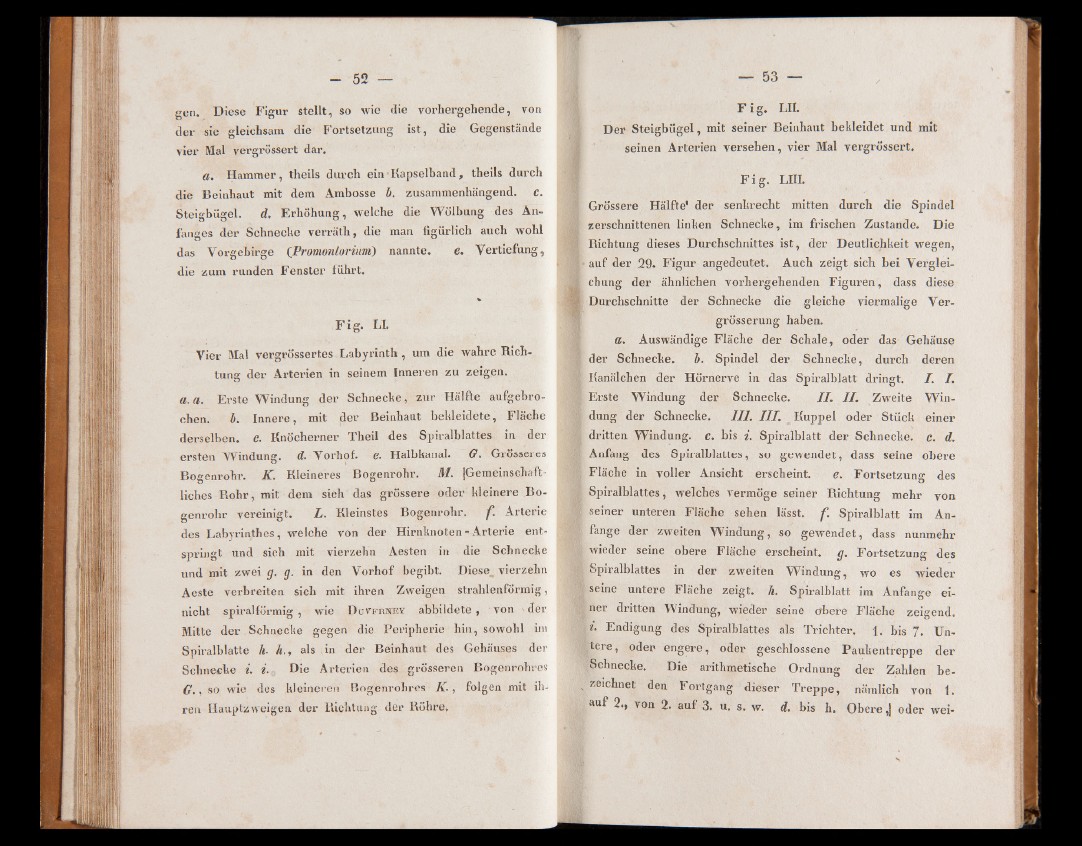
gen. Diese Figur stellt, so wie die vorhergehende, von
der sie gleichsam die Fortsetzung ist, die Gegenstände
vier Mal vergrössert dar.
a. Hammer, theils durch ein Kapselband, theils durch
die Beinhaut mit dem Ambosse b. zusammenhängend, c.
Steigbügel. d. Erhöhung, welche die Wölbung des Anfanges
der Schnecke verräth, die man figürlich auch wohl
das Vorgebirge (Promontorium) nannte, e. Vertiefung,
die zum runden Fenster führt.
Fig. LI.
Vier Mal vergrössertes Labyrinth , um die wahre Richtung
der Arterien in seinem Inneren zu zeigen.
a. a. Erste Windung der Schnecke , zur Hälfte aufgebrochen.
b. Innere, mit der Beinhaut bekleidete, Fläche
derselben. C. Knöcherner Theil des Spiralblattes in der
ersten ^Vindung. d. Vorhof. 6. Halbbanal. G. Grösseres
Bogenrohr. K. Kleineres Bogenrohr. M. JGemeinschaft-
liches Rohr, mit dem sieh das grössere oder kleinere .Bogenrohr
vereinigt. L. Kleinstes Bogenrohr. f. Arterie
des Labyrinthes, welche von der Hirnknoten - Arterie entspringt
und sich mit vierzehn Aesten in die Schnecke
und mit zwei g. g. in den Vorhof begibt. Diese_ vierzehn
Aeste verbreiten sich mit ihren Zweigen strahlenförmig,
nicht spiralförmig, wie Dcvfrmey abbildete, von 'der
Mitte der Schnecke gegen die Peripherie hin, sowohl im
Spiralblatte h. h., als xin der Beinhaut des Gehäuses der
Schnecke i. i .0 Die Arterien des grösseren Bogenrohres
G., so wie des kleineren Bogenrohres I{ ., folgen mit ihren
Hauptzweigen der Richtung der Röhre,
F ig . LII.
( Der Steigbügel, mit seiner Beinhaut bekleidet und mit seinen Arterien versehen, vier Mal vergrössert,
F ig . LIII.
I Grössere Hälfte1 der senkrecht mitten durch die Spindel
1 zerschnittenen linken Schnecke, im frischen Zustande. Die I Richtung dieses Durchschnittes ist, der Deutlichkeit wegen,
» » auf der 29» Figur angedeutet. Auch zeigt sich bei Verglei- <■; chung der ähnlichen vorhergehenden Figuren, dass diese
-Durchschnitte der Schnecke die gleiche viermalige Ver-
grösserung haben.
a. Auswändige Fläche der Schale, oder das Gehäuse
1 der Schnecke. b. Spindel der Schnecke, durch deren
1 Kanälchen der Hörnerve in das Spiralblatt dringt. I. /.
■ Erste Windung der Schnecke. II. II. Zweite Win-
I düng der Schnecke. III. III. Kuppel oder Stück einer
1 dritten Windung, c. bis i, Spiralblatt der Schnecke, c. d.
I Anfang des Spiralblattes, so gewendet, dass seine obere
| Fläche in voller Ansicht erscheint. e. Fortsetzung des
1 Spiralblattes, welches vermöge seiner Richtung mehr von
I seiner unteren Fläche sehen lässt, f. Spiralblatt im An-
I fange der zweiten Windung, so gewendet, dass nunmehr
« wieder seine obere Fläche erscheint, g. Fortsetzung des
|| Spiralblattes in der zweiten Windung, wo es wieder
M se^n® untere Fläche zeigt, h. Spiralblatt im Anfänge einer
dritten Windung, wieder seine erbere Fläche zeigend.
I «. Endigung des Spiralblattes als Trichter. 1 . bis 7. Un-
||te r e , oder engere, oder geschlossene Paukentreppe der
Schnecke. Die arithmetische Ordnung der Zahlen bezeichnet
den Fortgang dieser Treppe, nämlich von 1.
y auf 2., von 2. auf 3. u, s. w. d. bis h. Obere,] oder wei