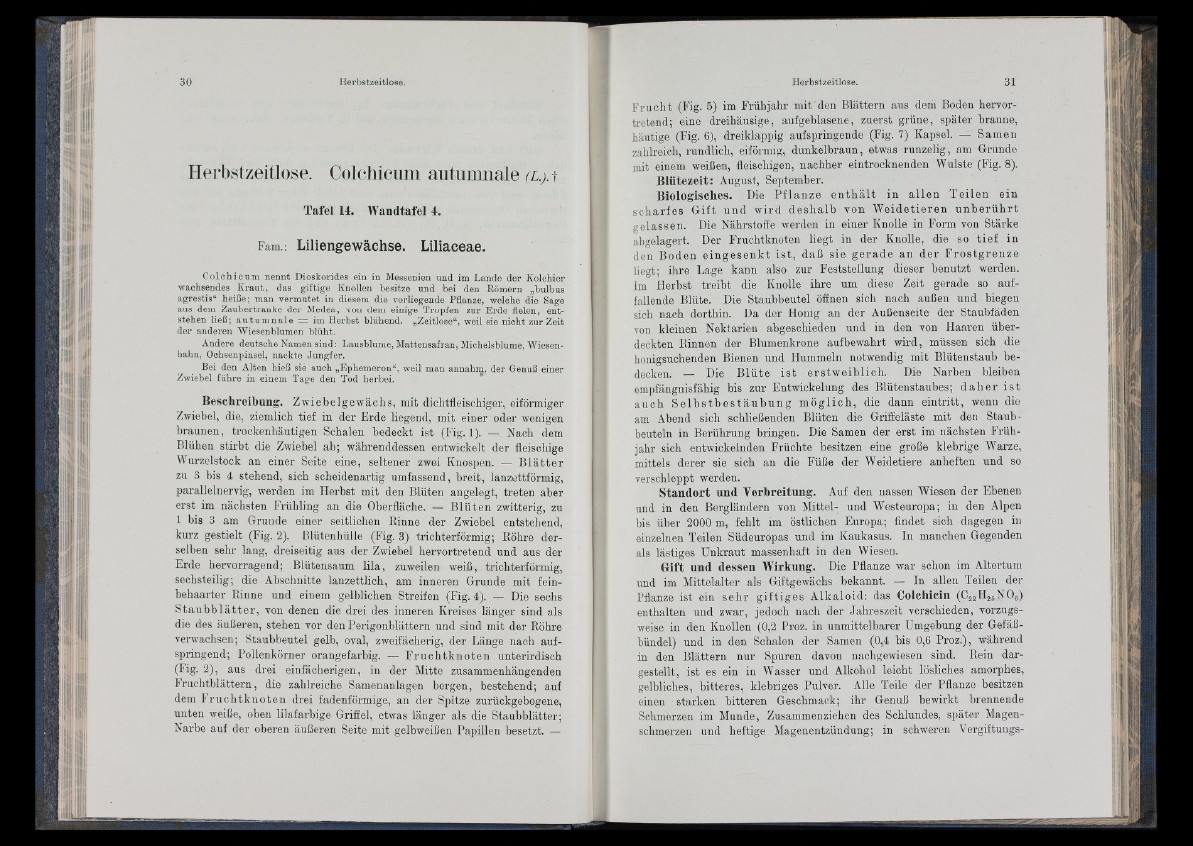
wüilll Ülll'
il i'
Herl)stzeitlose. Cok'hicuin autumnale ru;. t
Tafel 14. Wandtafel 4.
Fam.; Liliengewächse. Liliaceae.
C o l c h i c u m n e n u t D io sk o rid e s ein in Messenien u n d im L a n d e d e r K o lch ie r
w ach sen d es K r a u t, d a s g iftig e Knollen be sitz e u n d b e i d en R öm e rn „b u lb u s
a g r e s tis “ h e iß e ; m a u v e rm u te t in d ie sem d ie v o rlieg en d e Pflanze, welche d ie Sage
aus dem Z a u b e rtra n k e d e r M ed e a , v on d em e in ig e T ro p fe n zu r E rd e fie len , e n ts
teh e n ließ ; a u t u m n a l e = im H e rb s t b lü h en d . „Z e itlo se “, weil sie n ic h t zu r Z e it
d e r a n d e re n W ie sen b lum en b lü h t.
A n d e re d eu tsch e N am en s in d : L au sb lum e , M a tte n s a fra n , Miche lsblume , Wie seu -
h ah n , Och sen p in sel, n a c k te J u n g fe r.
Bei d en Alten h ieß sie au c h „E p h em e ro n “, w eil m an an n a hm , d e r Genuß e in er
Zwiebel fü h re in e in em T a g e d en To d h e rb e i. *
Beschreibung. Zw ie b e lg ew ä c h s, mit dicbtfleischiger, eiförmiger
Zwiebel, die, ziemlich tief in der Erde liegend, mit einer oder wenigen
braunen, trockenbäutigen Schalen bedeckt ist (Fig. 1 ). — Nach dem
Blühen stirbt die Zwiebel ab; währenddessen entwickelt der fleischige
Wurzelstock an einer Seite eine, seltener zwei Knospen. — B lä t te r
zu 3 bis 4 stehend, sich scheidenartig umfassend, breit, lanzettförmig,
parallelnervig, werden im Herbst mit den Blüten angelegt, treten aber
erst im nächsten Frühling an die Oberfläche. — B lü te n zwitterig, zu
1 bis 3 am Grunde einer seitlichen Rinne der Zwiebel entstehend,
kurz gestielt (Fig. 2). Blütenhülle (Fig. 3) trichterförmig; Röhre derselben
sehr lang, dreiseitig aus der Zwiebel hervortretend und aus der
Erde hervorragend; Blütensaum lila, zuweilen weiß, trichterförmig,
sechsteilig; die Abscliuitte lanzettlich, am inneren Grunde mit feinbehaarter
Rinne und einem gelblichen Streifen (Fig. 4). — Die sechs
S ta u b b l ä t t e r , von denen die drei des inneren Kreises länger sind als
die des äußeren, stehen vor den Perigonblättern und sind mit der Röhre
verwachsen; Staubbeutel gelb, oval, zweifächerig, der Länge nach aufspringend;
Pollenkörner orangefarbig. ■— F’ru c h tk u o te n unterirdisch
(Fig. 2), aus drei einfächerigen, in der Mitte zusammenhängenden
Fruchtblättern, die zahlreiche Samenanlagen bergen, bestehend; auf
dem F r u c h tk n o te n drei fadenförmige, an der Spitze zurückgebogene,
unten weiße, oben lilafarbige Griffel, etwas länger als die Staubblätter;
Narbe auf der oberen äußeren Seite mit gelbweißen Papillen besetzt. —
F ru c h t (Fig. .5) im Frühjahr mit den Blättern aus dem Boden hervortretend;
eine dreibäusige, aufgeblasene, zuerst grüne, später braune,
häutige (Fig. 6), dreiklappig aufspringende (Fig. 7) Kapsel. — Samen
zahlreich, rundlich, eiförmig, dunkelbraun, etwas runzelig, am Grunde
mit einem weißen, fleischigen, nachher eiutrocknenden Wulste (Fig. 8).
Blütezeit: August, September.
Biologisches. Die P fla n z e e n th ä l t in a lle n T e ile n e in
s c h a r fe s G ift u n d w ird d e s h a lb von W e id e tie r e n u n b e r ü h r t
g e la ssen . Die Nährstoffe werden in einer Knolle in Form von Stärke
abgelagert. Der Fruchtknoten liegt in der Knolle, die so tie f in
den Boden e in g e s e n k t is t, d aß sie g e r a d e an d e r F ro s tg re n z e
liegt; ihre Lage kann also zur Feststellung dieser benutzt werden.
Im Herbst treibt die Knolle ihre um diese Zeit gerade so auffallende
Blüte. Die Staubbeutel öffnen sich nach außen und biegen
sich nach dorthin. Da der Honig an der Außenseite der Staubfäden
von kleinen Nektarieu abgeschieden und in den von Haaren überdeckten
Rinnen der Blumenkroue auf bewahrt wird, müssen sich die
hoiiigsuchenden Bienen und Hummeln notwendig mit Blütenstaub bedecken.
— Die B lü te i s t e r s tw e ib lic b . Die Narben bleiben
empfängnisfähig bis zur Entwickelung des Blütenstaubes; d a h e r i s t
a u c h S e l b s t b e s t ä u b u n g m ö g l ic h , die dann eintritt, wenn die
am Abend sich schließenden Blüten die Griffeläste mit den Staubbeuteln
in Berührung bringen. Die Samen der erst im nächsten Frühjahr
sich entwickelnden Früchte besitzen eine große klebrige Warze,
mittels derer sie sich an die Füße der Weidetiere anheften und so
verschleppt werden.
Standort und Verbreitung. Auf den nassen Wiesen der Ebenen
und in den Bergländern von Mittel- und Westeuropa; in den Alpen
bis über 2000 m, fehlt im östlichen Europa; findet sich dagegen in
einzelnen Teilen Südeuropas und im Kaukasus. In manchen Gegenden
als lästiges Unkraut massenhaft in den Wiesen.
Gift und dessen Wirkung. Die Pflanze war schon im Altertum
und im Mittelalter als Giftgewäcbs bekannt. — In allen Teilen der
Pflanze ist ein s e h r g if tig e s A lk a lo id : das Colchicin (C22H25NO5)
enthalten und zwar, jedoch nach der Jahreszeit verschieden, vorzugsweise
in den Knollen (0,2 Proz. in unmittelbarer Umgebung der Gefäßbündel)
und in deu Schalen der Samen (0,4 bis 0,6 Proz.), während
in den Blättern nur Spuren davon uacligewiesen sind. Rein dargestellt,
ist es ein in Wasser und Alkohol leicht lösliches amorphes,
gelbliches, bitteres, klebriges Pulver. Alle Teile der Pflanze besitzen
einen starken bitteren Geschmack; ihr Genuß bewirkt brennende
Schmerzen im Munde, Zusammen ziehen des Schlundes, später Mageuschmerzen
und heftige Magenentzündung; in schweren Vergiftuugs