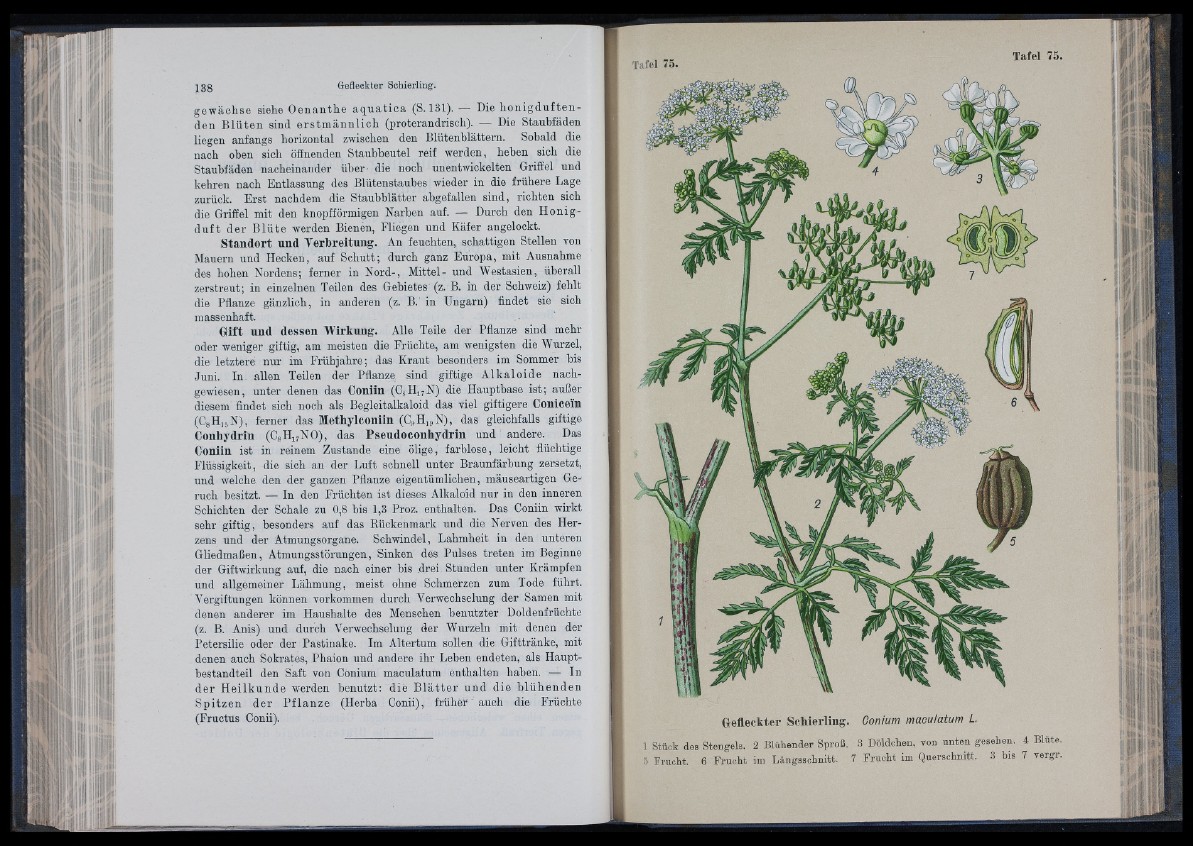
¡u
g ew ä ch se siehe O e n a n th e a q u a ti c a (S. 131). — Die h o n ig d u f te n d
en B lü te n sind e r s tm ä n n lic h (proterandrisch). — Die Staubfäden
liegen anfangs horizontal zwischen den Blütenblättern. Sobald die
nach oben sich öffnenden Staubbeutel reif werden, heben sich die
Staubfäden nacheinander über die noch unentwickelten Griffel und
kehren nach Entlassung des Blütenstauhes wieder in die frühere Lage
zurück. Erst nachdem die Staubblätter ahgefallen sind, richten sich
die Griffel mit den knopfförmigen Narben auf. — Durch den H o n ig -
d u f t d e r B lü te werden Bienen, Fliegen und Käfer angelockt.
Standort und Verbreitung. An feuchten, schattigen Stellen von
Mauern und Hecken, auf Schutt; durch ganz Europa, mit Ausnahme
des hohen Nordens; ferner in Nord-, Mittel- und Westasien, überall
zerstreut; in einzelnen Teilen des Gebietes (z. B. in der Schweiz) fehlt
die Pflanze gänzlich, in anderen (z. B. in Ungarn) findet sie sich
massenhaft.
Gift und dessen Wirkung. Alle Teile der Pflanze sind mehr
oder weniger giftig, am meisten die Früchte, am wenigsten die Wurzel,
die letztere nur im Frühjahre; das Kraut besonders im Sommer his
Juni. In allen Teilen der Pflanze sind giftige A lk a lo id e nachgewiesen,
unter denen das Coniin (OgHijN) die Hauptbase ist; außer
diesem findet sich noch als Begleitalkaloid das viel giftigere Conicein
(CgHigN), ferner das Metbyiconiin (CgHigN), das gleichfalls giftige
Conbydrin (CgHi^NO), das Pseudoconbydrin und andere. Das
Coniin ist in reinem Zustande eine ölige, farblose, leicht flüchtige
Flüssigkeit, die sich an der Luft schnell unter Braunfärbung zersetzt,
und welche den der ganzen Pflanze eigentümlichen, mäuseartigen Geruch
besitzt. — In den Früchten ist dieses Alkaloid nur iu den inneren
Schichten der Schale zu 0,8 bis 1,3 Proz. enthalten. Das Coniin wirkt
sehr giftig, besonders auf das Rückenmark und die Nerven des Herzens
und der Atmungsorgane. Schwindel, Lahmheit in den unteren
Gliedmaßen, Atmungsstörungen, Sinken des Pulses treten im Beginne
der Giftwirkung auf, die nach einer bis drei Stunden unter Krämpfen
und allgemeiner Lähmung, meist ohne Schmerzen zum Tode führt.
Vergiftungen können verkommen durch Verwechselung der Samen mit
denen anderer im Haushalte des Menschen benutzter Doldenfrüchte
(z. B. Anis) und durch Verwechselung der Wurzeln mit denen der
Petersilie oder der Pastinake. Im Altertum sollen die Gifttränke, mit
denen auch Sokrates, Phaion und andere ihr Leben endeten, als Hauptbestandteil
den Saft von Conium maculatum enthalten haben. — In
d e r H e ilk u n d e werden benutzt; d ie B lä t te r u n d d ie b lü h e n d e n
S p itz e n d e r P fla n z e (Herba Conii), früher auch die Früchte
(Fructus Conii). Gefleckter Scbierling. Conium maculatum L.
1 Stück des Stengels. 2 Blühender Sproß. 3 Döldchen, von unten gesehen. 4 Blüte.
.5 Frucht. 6 F ru c h t im Längsschnitt. 7 Fru ch t im Querschnitt. 3 his 7 vergr.