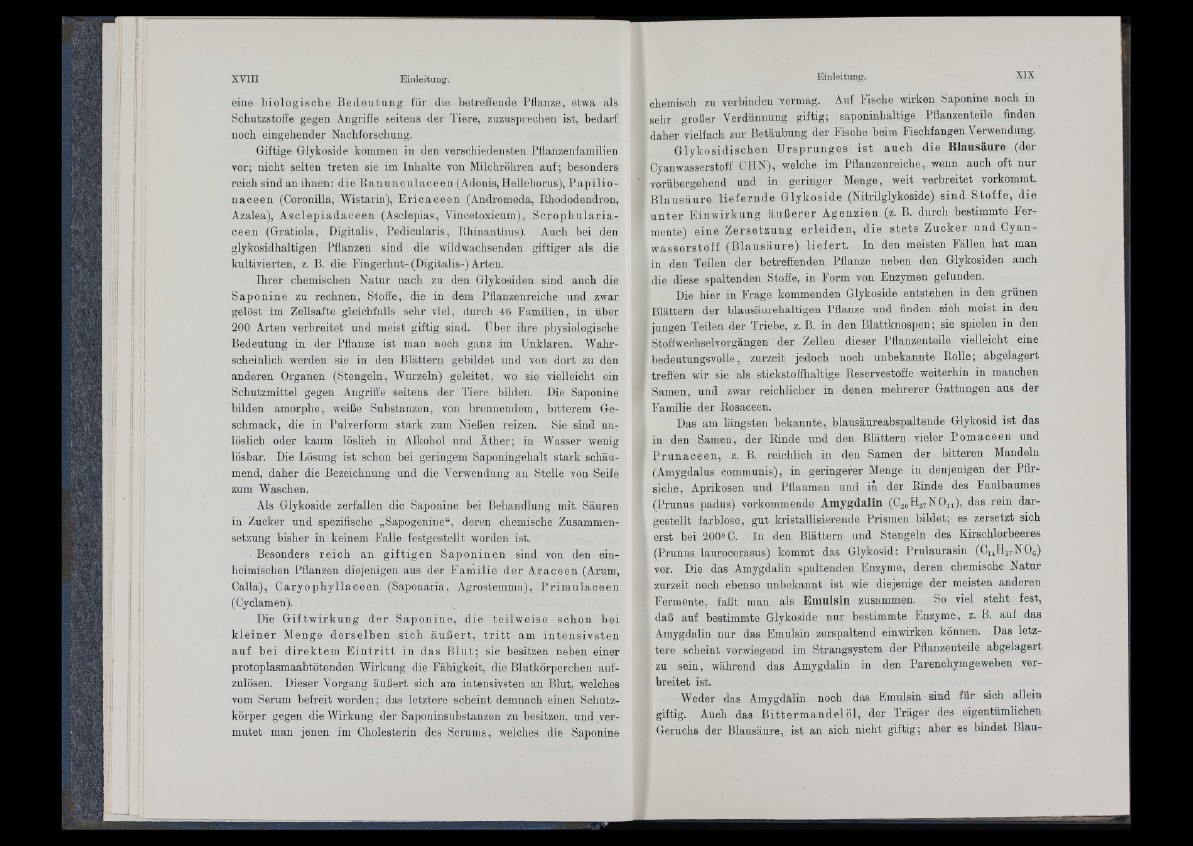
XVIII
eine b io lo g is c h e B e d e u tu n g für die betreffende Pflanze, etwa als
Schutzstoffe gegen Angriffe seitens der Tiere, zuznsprechen ist, bedarf
noch eingehender Nachforschung.
Giftige Glykoside kommen in den verschiedensten Pflanzenfamilien
vor; nicht selten treten sie im Inhalte von Milchröhren auf; besonders
reich sind an ihnen; die B a n u n c u la c e e n (Adonis, llelleborus), P a p i l io n
a c e e n (Coronilla, Wistaria), E r ic a c e e n (Andromeda, Rhododendron,
Azalea), A s c le p ia d a c e e n (Aselepias, Vincetoxicum), S c r o p h u l a r ia ceen
(Gratiola, Digitalis, Pedicularis, Rhinanthus). Auch bei den
glykosidhaltigen Pflanzen sind die wildwachsenden giftiger als die
kultivierten, z. B. die Fingerhut- (Digitalis-) Arten.
Ihrer chemischen Natur nach zu den Glykosiden sind auch die
S a p o n in e zu rechnen, Stoffe, die in dem Pflanzenreiche und zwar
gelöst im Zellsafte gleichfalls sehr viel, durch 46 Familien, in über
200 Arten verbreitet und meist giftig sind. Über ihre physiologische
Bedeutung in der Pflanze ist man noch ganz im Unklaren. Wahrscheinlich
werden sie in den Blättern gebildet und von dort zu den
anderen Organen (Stengeln, Wurzeln) geleitet, wo sie vielleicht ein
Schutzmittel gegen Angriffe seitens der Tiere bilden. Die Saponine
bilden amorphe, weiße Substanzen, von brennendem, bitterem Geschmack,
die in Pulverform stark zum Nießen reizen. Sie sind unlöslich
oder kaum löslich in Alkohol und Äther; in Wasser wenig
lösbar. Die Lösung ist schon bei geringem Saponingehalt stark schäumend,
daher die Bezeichnung und die Verwendung au Stelle von Seife
zum Waschen.
Als Glykoside zerfallen die Saponine bei Behandlung mit Säuren
in Zucker und spezifische „Sapogenine“, deren chemische Zusammensetzung
bisher in keinem Falle festgestellt worden ist.
Besonders re ic h an g if tig e n S a p o n in e n sind von den einheimischen
Pflanzen diejenigen aus der F am ilie d e r A ra c e e n (Arum,
Calla), C a ry o p h y lla c e e n (Saponaria, Agrostemma), P rim n la c e e n
(Cyclamen).
Die G if tw irk u n g d e r S a p o n in e , d ie te ilw e is e sch o n b e i
k le in e r Menge d e r s e lb e n sich ä u ß e r t , t r i t t am in te n s iv s te n
a u f b e i d ir e k tem E i n t r i t t in d a s B lu t; sie besitzen neben einer
protoplasmaabtötenden Wirkung die Fähigkeit, die Blutkörperchen aufzulösen.
Dieser Vorgang äußert sich am intensivsten an Blut, welches
vom Serum befreit worden; das letztere scheint demnach einen Schutzkörper
gegen die Wirkung der Saponinsubstanzen zu besitzen, und vermutet
man jenen im Cholesterin des Serums, welches die Saponine
chemisch zu verbinden vermag. Auf Fische wirken Saponine noch in
sehr großer Verdünnung giftig; saponinlialtige Pflanzenteile finden
daher vielfach zur Betäubung der Fische beim Fischfängen Verwendung.
G ly k o s id is c h e n U rsp ru n g e s i s t a u c h d ie Blausäure (der
Cyanwasserstoff CHN), welche im Pflanzenreiche, wenn auch oft nur
vorübergehend und in geringer Menge, weit verbreitet vorkommt.
B la u s ä u r e lie f e rn d e G ly k o sid e (Nitrilglykoside) s in d S to f fe , die
u n te r E inw irk u n g ä u ß e r e r A g en z ien (z. B. durch bestimmte Fermente)
ein e Z e rs e tz u n g e r le id e n , d ie s te ts Z u c k e r u n d C y a n w
a s s e rs to ff (B la u s ä u r e ) lie f e r t. In den meisten Fällen hat man
in den Teilen der betreffenden Pflanze neben den Glykosiden auch
die diese spaltenden Stoffe, in Form von Enzymen gefunden.
Die hier in Frage kommenden Glykoside entstehen in den grünen
Blättern der hlausäurehaltigen Pflanze und finden sich meist in den
jungen Teilen der Triebe, z. B. in den Blattknospen; sie spielen in den
Stoffwechselvorgängen der Zellen dieser Pflanzenteile vielleicht eine
bedeutungsvolle, zurzeit jedoch noch unbekannte Rolle; abgelagert
treffen wir sie als stickstoffhaltige Reservestoffe weiterhin in manchen
Samen, und zwar reichlicher in denen mehrerer Gattungen aus der
Familie der Rosaceen.
Das am längsten bekannte, hlansäureabspaltende Glykosid ist das
in den Samen, der Rinde und den Blättern vieler P om a c e e n und
P ru n a c e e n , z. B. reichlich in den Samen der bitteren Mandeln
(Amygdalus communis), in geringerer Menge in denjenigen der Pfirsiche,
Aprikosen und Pflaumen und in der Rinde des Faulbaumes
(Prunus padus) vorkommende Amygdalin (C20H27NO1 1)) rein dargestellt
farblose, gut kristallisierende Prismen bildet; es zersetzt sich
erst bei 200» C. In den Blättern und Stengeln des Kirschlorbeeres
(Prunus laurocerasus) kommt das Glykosid; Prulaurasin (C14H17NO6)
vor. Die das Amygdalin spaltenden Enzyme, deren chemische Natur
zurzeit noch ebenso unbekannt ist wie diejenige der meisten anderen
Fermente, faßt man als Emulsin zusammen. So viel steht fest,
daß auf bestimmte Glykoside nur bestimmte Enzyme, z. B. auf das
Amygdalin nur das Emulsin zerspaltend einwirken können. Das letztere
scheint vorwiegend im Strangsystem der Pflanzenteile abgelagert
zu sein, während das Amygdalin in den Parenchymgeweben verbreitet
ist.
Weder das Amygdalin noch das Emulsin sind für sich allein
giftig. Auch das B itte rm a n d e lö l, der Träger des eigentümlichen
Geruchs der Blausäure, ist an sich nicht giftig; aber es bindet Blau