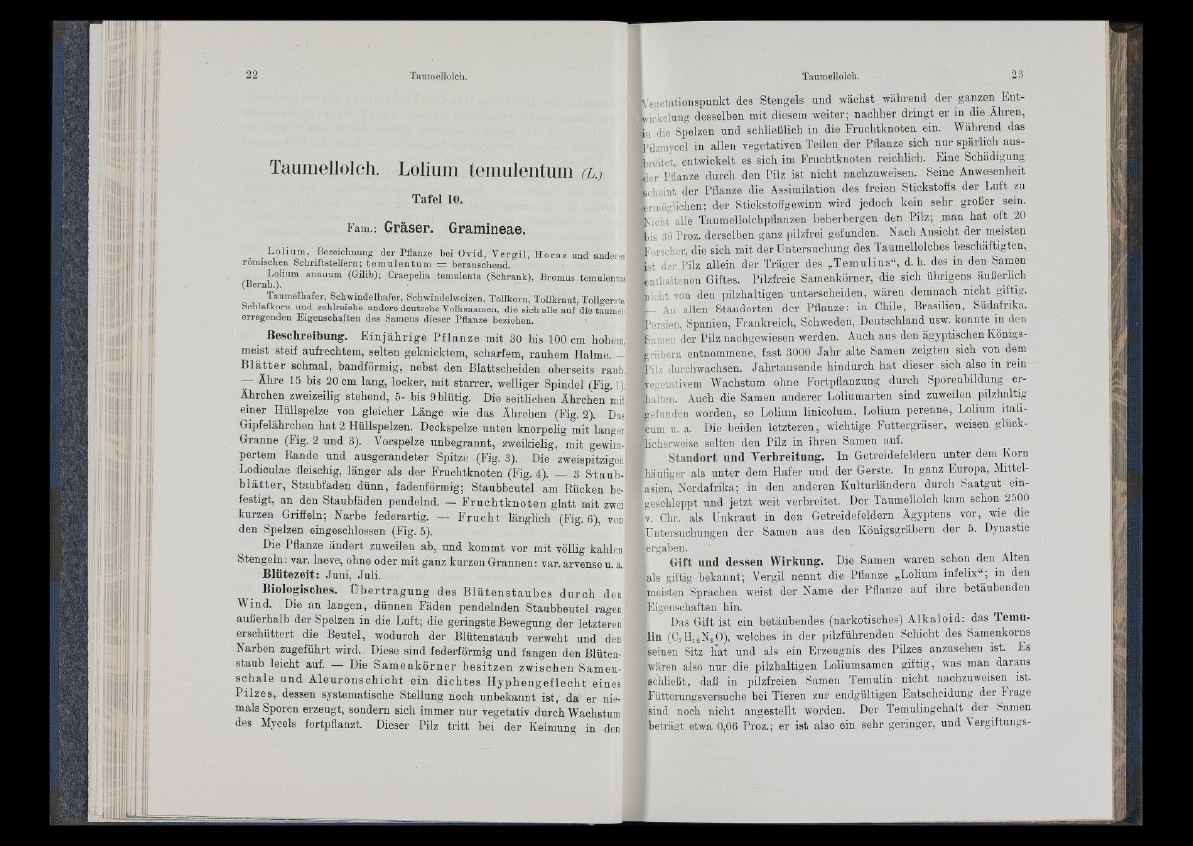
'I!
■l|ii
Ji''
sj;;
ml
!!ü
!l II' || ili
|! i
Ü !!'
II li
! I r
' i! !i
i1 1'I.
'I ll.
!| !
J S ili
' I' 1(1'
Tauiiiellolcli. Loliuiu temulentum (i.).
Tafel 10.
Fam.: Gräser. Gramineae.
L o l i u m , B e z eich n u ng d e r Pflanz e b ei O v id , V e r g i l , H o r a z u n d audeim
röm isc h en S c h rifts te lle rn ; t e m u l e n t u m r= b e rau sch e n d .
L o h um a n n u um (G ilib ); C ra ep e lia tem u le n ta (S ch ran k ), B romu s temulentui
(Bernh.).
T aum e lh a fe r, S chw in d e lh a fe r, Schwindelwe izen, T o llk o rn , T o llk ra u t, Tollgerste
S o h la fk o rn und z a h lre ic h e an d e re d eu tsc h e V o lksuamen, d ie sich alle au f die taum e l
e rreg e n d e n E ig e n s c h a fte n d e s Samens d ie se r Pflanz e bez ieh en .
Beschreibung. E in jä h r ig e P fla n z e mit 30 bis 100 cm hohem,
meist steif aufrechtem, selten geknicktem, scharfem, rauhem Halme. -
B l ä t t e r schmal, bandförmig, nebst den Blattscheiden oberseits rauh,
— Ähre 15 bis 20 cm laug, locker, mit starrer, welliger Spindel (Fig. 1),
Ährchen zweizeilig stehend, 5- bis 9blütig. Die seitlichen Ährchen mit
einer Hüllspelze von gleicher Länge wie das Ährchen (Kg. 2). Das
Gipfelährchen hat 2 Hüllspelzen. Deckspelze unten knorpelig mit langer
Granne (Fig. 2 und 3). Vorspelze unbegrannt, zweikielig, mit gewim-
pertem Rande und ausgeraudeter Spitze (Fig. 3). Die zweispitzigen
Lodiculae fleischig, länger als der Fruchtknoten (Fig. 4). — 3 S'taub-
b lä t t e r , Staubfaden dünn, fadenförmig; Staubbeutel am Rücken befestigt,
au den Staubfäden pendelnd. — F r u c h tk n o te n glatt mit zwei
kurzen Griffeln; Narbe federartig. — F r u c h t länglich (Fig. 6), von
den Spelzen eingeschlosseu (Fig. 5).
Die Pflanze ändert zuweilen ab, und kommt vor mit völlig kahlen
Stengeln; var. laeve, ohne oder mit ganz kurzen Grannen: var. arvense u. a.
Blütezeit: Juni, Juli.
Biologisches. Ü b e r tr a g u n g des B lü te n s ta u b e s d u r c h den
Wind. Die an laugen, dünnen Fäden pendelnden Staubbeutel ragen
außerhalb der Spelzen in die Luft; die geringste Bewegung der letzteren
erschüttert die Beutel, wodurch der Blütenstaub verweht und den
Narben zugeführt wird. Diese sind federförmig und fangen den Blütenstaub
leicht auf. — Die S am e n k ö rn e r b e s itz e n zw isch en S am en s
c h a le u n d A le u ro n s c h ic h t e in d ic h te s H y p h e n g e f le c h t eines
P ilz e s , dessen systematische Stellung noch unbekannt ist, da er niemals
Sporen erzeugt, sondern sich immer nur vegetativ durch Wachstum
des Mycels fortpflanzt. Dieser Pilz tritt bei der Keimung in den
\’egetatiouspunkt des Stengels und wächst während der ganzen Entwickelung
desselben mit diesem weiter; nachher dringt er in die Ähren,
in die Spelzen und schließlich in die Fruchtknoten ein. Während das
Pil.zraycel in allen vegetativen Teilen der Pflanze sich nur spärlich ausbreitet,
entwickelt es sich im Fruchtknoten reichlich. Eine Schädigung
(der Pflanze durch den Pilz ist nicht nachzuweisen. Seine Anwesenheit
scheint der Pflanze die Assimilation des freien Stickstoffs der Luft zu
ierraögliohen; der Stickstoffgewinn wird jedoch kein sehr großer sein.
Nicht alle Taumellolchpflanzen beherbergen den Pilz; man hat oft 20
bis 30 Proz. derselben ganz pilzfrei gefunden. Nach Ansicht der meisten
Forscher, die sich mit der Untersuchung des Taumellolches beschäftigten,
ist der Pilz allein der Träger des „T em u lin s “, d.h. des in den Samen
enthaltenen Giftes. Pilzfreie Samenkörner, die sich übrigens äußerlich
nicht von deu pilzhaltigeii unterscheiden, wären demnach nicht giftig.
S— Au allen Standorten der Pflanze; in Chile, Brasilien, Südafrika,
Persien, Spanien, Frankreich, Schweden, Deutschland usw. konnte in den
(Samen der Pilz nachgewieseu werden. Auch aus den ägyptischen Königsgräbern
entnommene, fast 3000 Jahr alte Samen zeigten sich von dem
Pilz clurohwaclisen. Jahrtausende hindurch hat dieser sich also in rein
vegetativem Wachstum ohne Fortpflanzung durch Sporeubildung erhalten.
Auch die Samen anderer Loliumarten sind zuweilen pilzhaltig
gefunden worden, so Lolium liuicolum, Lolium perenne, Lolium itali-
cum u. a. Die beiden letzteren, wichtige Futtergräser, weisen glücklicherweise
selten den Pilz in ihren Samen auf.
Standort und Verbreitung. In Getreidefeldern unter dem Korn
häufiger als unter dem Hafer und der Gerste, In ganz Europa, Mittelasien,
Nordafrika; in den anderen Kulturländern durch Saatgut eingeschleppt
und jetzt weit verbreitet. Der Taumellolch kam schon 2500
V. Chr. als Unkraut in den Getreidefeldern Ägyptens vor, wie die
.Untersuchungen der Samen aus den Königsgräbern der 5. Dynastie
ergaben.
Gift und dessen Wirkung. Die Samen waren schon den Alten
als giftig bekannt; Vergil nennt die Pflanze „Lolium iufelix“ ; in den
meisten Sprachen weist der Name der Pflanze auf ihre betäubenden
Eigenschaften hin.
Das Gift ist ein betäubendes (narkotisches) A lk a lo id : das Temu-
lin (C^HjjNgO), welches in der pilzführenden Schicht des Samenkorns
seinen Sitz hat und als ein Erzeugnis des Pilzes anzusehen ist. Es
wären also nur die pilzhaltigen Loliumsamen giftig, was man daraus
schließt, daß in pilzfreien Samen Temulin nicht nachzuweisen ist.
Fütterungsversuche bei Tieren zur endgültigen Entscheidung der Frage
sind noch nicht augestellt worden. Der Temulingehalt der Samen
beträgt etwa 0,06 Proz.; er ist also ein sehr geringer, und Vergiftungs-
■ i?l
iW
liiu