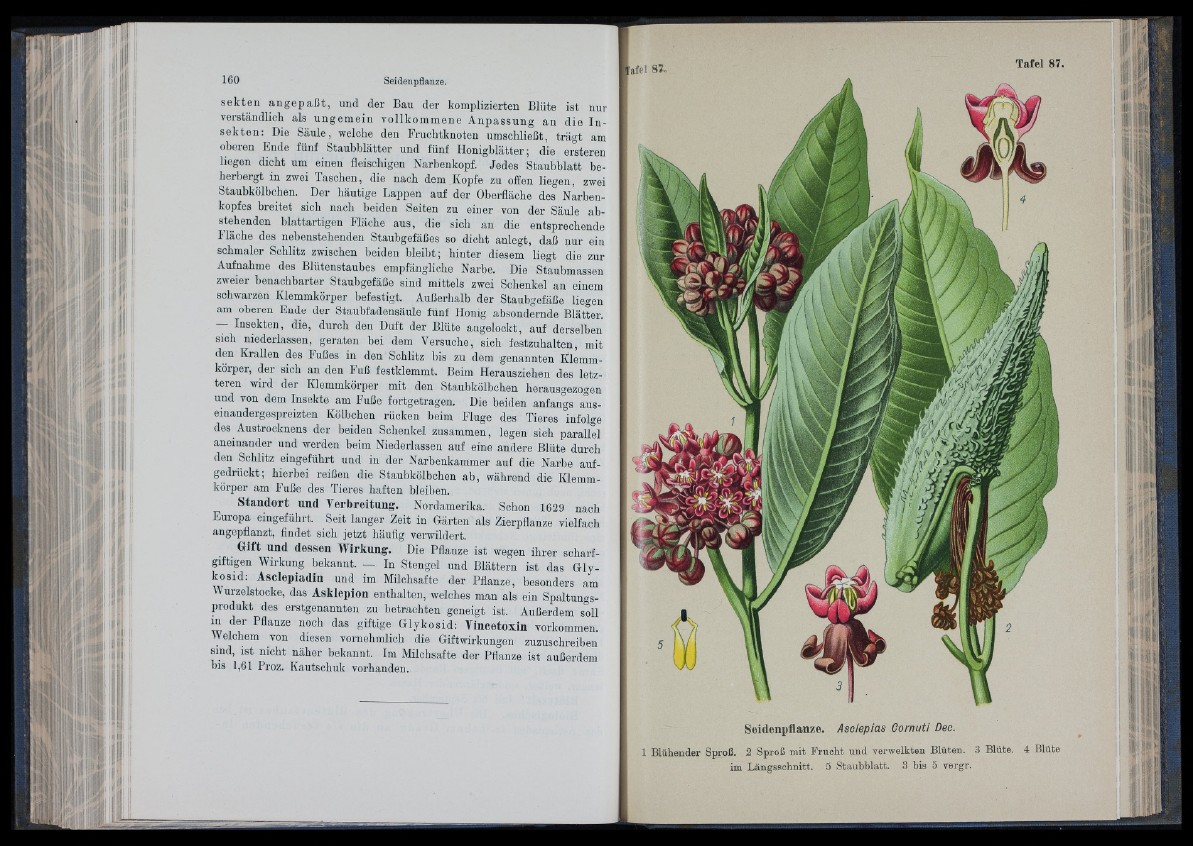
1 f : lailii'
M' N.-'Mjß l .1®Ö!!
f II
. IIiI|I?"
S ek ten a n g e p a ß t, und der Bau der komplizierten Blüte ist nur
verständlich als u n g em e in v o llk om m en e A n p a s su n g an d ie I n s
e k te n : Die Säule, welche den Fruchtknoten umscldießt, trägt am
oberen Ende fünf Staubblätter und fünf Honigblätter; die erateren
liegen dicht um einen fleischigen Narbenkopf. Jedes Staubblatt beherbergt
in zwei Taschen, die nach dem.Kopfe zu offen liegen, zwei
Staubkölbchen. Der häutige Lappen auf der Oberfläche des Narhen-
kopfes breitet sich nach beiden Seiten zu einer von der Säule abstehenden
blattartigen Fläche aus, die sich an die entsprechende
Fläche des nebenstehenden Staubgefäßes so dicht anlegt, daß nur ein
schmaler Schlitz zwischen beiden bleibt; hinter diesem liegt die zur
Aufnahme des Blütenstaubes empfängliche Narbe. Die Stlubmassen
zweier benachbarter Staubgefäße sind mittels zwei Schenkel an einem
schwarzen Klemmkörper befestigt. Außerhalb der Staubgefäße liegen
am oberen Ende der Staubfadensäule fünf Honig absondernde Blätter.
— Insekten, die, durch den Duft der Blüte angelockt, auf derselben
sich niederlassen, geraten bei dem Versuche, sich festzuhalten, mit
den Krallen des Fußes in den Schlitz bis zu dem genannten Klemmkörper,
der sich an den Fuß festklemmt. Beim Herausziehen des letzteren
wird der Klemmkörper mit den Staubkölbchen herausgezogen
und von dem Insekte am Fuße fortgetragen. Die beiden anfangs aus-
emandergespreizten Kölbchen rücken beim Fluge des Tieres infolge
des Austrocknens der beiden Schenkel zusammen, legen sich parallel
aneinander und werden beim Niederlassen auf eine andere Blüte durch
den Schlitz eingeführt und in der Narbeukammer auf die Narbe auf-
gedrückt; hierbei reißen die Staubkölbchen ah, während die Klemmkörper
am Fuße des Tieres haften bleiben.
Standort und Verbreitung. Nordamerika. Schon 1629 nach
Europa eingeführt. Seit langer Zeit in Gärten als Zierpflanze vielfach
angepflanzt, findet sich jetzt häufig verwildert.
Gift und dessen Wirkung. Die Pflanze ist wegen ihrer scharf-
giftigen Wirkung bekannt. — In Stengel und Blättern ist das G ly k
o sid : Asclepiadin und im Milchsäfte der Pfianze, besonders am
Wurzelstocke, das Asklepion enthalten, welches man als ein Spaltungsprodukt
des erstgenannten zu betrachten geneigt ist. Außerdem soll
in der Pflanze noch das giftige G ly k o sid : Vincetoxin Vorkommen.
Welchem von diesen vornehmlich die Giftwirkungen zuzuschreiben
sind, ist nicht näher bekannt. Im Milchsäfte der Pflanze ist außerdem
bis 1,61 Proz. Kautschuk vorhanden.
Seidenpflanze. A s o l e p i a s G o rn u ti Deo.
1 Blühender Sproß. 2 Sproß mit Frucht und verwelkten Blüten. 6 Blüte. 4 Blüte
im Längsschnitt. 5 Staubblatt. 3 bis 5 vergr.
i m
41 i l i I W'iil
iil
■li; m
!' i i l
i'ji» *
! m
I i
■I::
|( 31
1! i?
ii 31h |
. «I
l l '
iS:
«
ilHl
l i
'3 m
I v H
i i