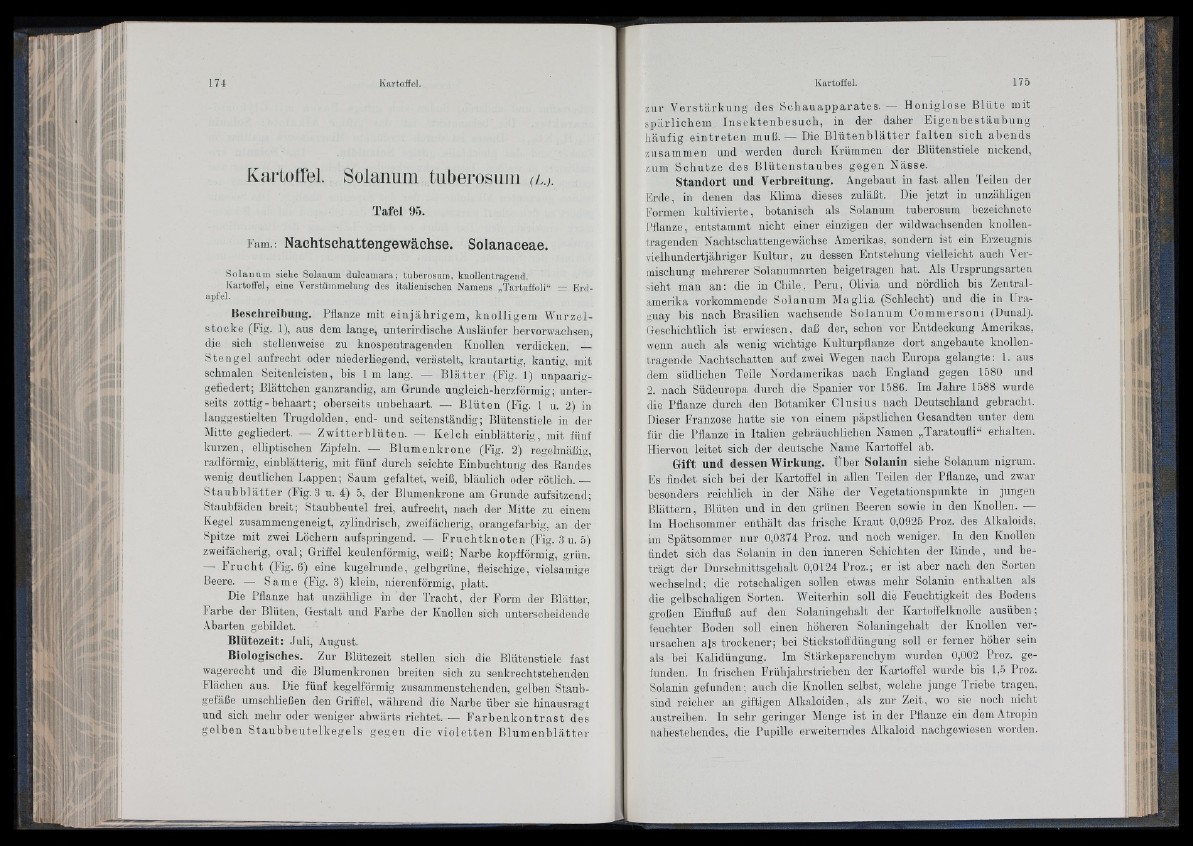
*«l.ü
Kartüiiel. Solanum tuberos um (L.>.
Tafel 95.
Fam.: Nachtschattengewächse. Solanaceae.
S o l a n u m siehe Solanum d u lc am a ra ; tu b e ro sum , k n o llen tra g en d .
K arto ffel, eine V e rs tüm m e lu n g des ita lien isch en Namens „T a rtu ffo li“ E r d apfel.
Beschreibung. Pflanze mit e in jä h r ig em , k n o llig em W u rz e l-
s to c k e (Fig. 1), aus dem lange, unterirdische Ausläufer hervorwachseii,
die sich stellenweise zu kiiospentragenden Knollen verdicken. —
S te n g e l aufrecht oder niederliegend, verästelt, krautartig, kantig, mit
schmalen Seitenleisten, his 1 m lang. — B lä t te r (Fig. 1) unpaariggefiedert;
Blättchen ganzrandig, am Grunde ungleich-herzförmig; unterseits
zottig - behaart; oberseits unbehaart. — B lü te n (Fig. 1 u. 2) in
langgestielten Trugdolden, end- und seitenständig; Blütenstiele in der
Mitte gegliedert. — Z w itte rb lü te n . — K e lch einblätterig, mit fünf
kurzen, elliptischen Zipfeln. — B lum e u k ro n e (Fig. 2) regelmäßig,
radförmig, einblätterig, mit fünf durch seichte Einbuchtung des Randes
wenig deutlichen Lappen; Saum gefaltet, weiß, bläulich oder rötlich.—
S ta u b b l ä tt e r (Fig. 3 u. 4) 5, der Blumenkrone am Grunde aufsitzend;
Staubfäden breit; Staubbeutel frei, aufrecht, nach der Mitte zu einem
Kegel zusammengeneigt, zylindrisch, zweifächerig, orangefarbig, an der
Spitze mit zwei Löchern aufspringend. — F ru c h tk n o te n (Fig. 3 u. 5)
zweifächerig, oval; Griffel keulenförmig, weiß; Narbe kopfförmig, grün.
— F ru c h t (Fig. 6) eine kugelrunde, gelbgrüne, fleischige, vielsamige
Beere. — S am e (Fig. 3) klein, uierenförmig, platt.
Die Pflanze hat unzählige iu der Tracht, der Form der Blätter,
Farbe der Blüten, Gestalt und Farbe der Knollen sich unterscheidende
-Vbarten gebildet.
Blü te z e it: Juli, August.
Biologisches. Zur Blütezeit stellen sich die Blütenstiele fast
wagerecht und die Blumenkronen breiten sich zu senkrechtstehendeu
Flächen aus. Die fünf kegelförmig zusammenstehendeii, gelben Staubgefäße
umschließen den Griffel, während die Narbe über sie hinausragt
und sich mehr oder weniger abwärts richtet. — F a r b e n k o n t r a s t des
g e lb e n S ta u h b e u te lk e g e ls g eg en die v io le tte n B lum e n b lä t te r
zur V e r s tä rk u n g des S c h a u a p p a r a te s . — H o n ig lo s e B lü te mit
s p ä r lic h em In s e k te n b e s u c h , in der daher E ig e n b e s tä u b u n g
h ä u fig e in t r e t e n m u ß .— Die B lü t e n b lä t te r f a l te n sich a b e n d s
zu sam m en und werden durch Krümmen der Blütenstiele nickend,
zum S c h u tz e des B lü te n s ta u b e s g eg en Nässe.
Standort und Verbreitung. Angebaut in fast allen Teilen der
Erde, in denen das Klima dieses zuläßt. Die jetzt iu unzähligen
Formen kultivierte, botanisch als Solanum tuberosum bezeichnete
Pflanze, entstammt nicht einer einzigen der wildwachsenden knollentragenden
Nachtschattengewächse Amerikas, sondern ist ein Erzeugnis
vielhundertjähriger Kultur, zu dessen Entstehung vielleicht auch Vermischung
mehrerer Solanumarten beigetragen hat. Als Ursprungsarteii
sieht man an: die in Chile, Peru, Olivia und nördlich bis Zentralamerika
verkommende S o lan um M a g lia (Schlecht) und die in Lra-
guay his nach Brasilien wachsende S o la n um C om m e rso n i (Dunal).
Geschichtlich ist erwiesen, daß der, schon vor Entdeckung Amerikas,
wenn auch als wenig wichtige Kulturpflanze dort angehaute knollen-
tragende Nachtschatten auf zwei Wegen nach Europa gelangte: 1. aus
dem südlichen Teile Nordamerikas nach England gegen 1580 und
2. nach Südeuropa durch die Spanier vor 1586. Im Jahre 1588 wurde
die Pflanze durch den Botaniker C lu s iu s nach Deutschland gebracht.
Dieser Franzose hatte sie von einem päpstlichen Gesandten unter dem
für die Pflanze in Italien gebräuchlichen Namen „Taratoufli“ erhalten.
Hiervon leitet sich der deutsche Name Kartoffel ab.
Gift und dessen Wirkung. Über Solanin siehe Solanum nigrum.
Es findet sich hei der Kartoffel in allen Teilen der Pflanze, und zwar
besonders reichlich in der Nähe der Vegetationspunkte in jungen
Blättern, Blüten und in den grünen Beeren sowie in den Knollen. —
Im Hochsommer enthält das frische Kraut 0,0925 Proz. des Alkaloids,
im Spätsommer nur 0,0374 Proz. und noch weniger. In den Knollen
tindet sich das Solanin in den inneren Schichten der Rinde, und beträgt
der Durschnittsgehalt 0,0124 Proz.; er ist aber nach den Sorten
wechselnd; die rotschaligen sollen etwas mehr Solanin enthalten als
die gelbschaligen Sorten. Weiterhin soll die Feuchtigkeit des Bodens
großen Einfluß auf den Solaningebalt der Kartoffelknolle ausüben;
feuchter Boden soll einen höheren Solaningebalt der Knollen verursachen
als trockener; bei Stickstoffdüngung soll er ferner höher sein
als bei Kalidüngung. Im Stärkeparenchym wurden 0,002 Proz. gefunden.
In frischen Frülijahrstriebeu der Kartoffel wurde bis 1,5 Proz.
Solanin gefunden; auch die Knollen selbst, welche junge Triebe tragen,
sind reicher an giftigen Alkaloiden, als zur Zeit, wo sie noch nicht
austreiben. In sehr geringer Menge ist in der Pflanze ein dem Atropin
nahestehendes, die Pupille erweiterndes Alkaloid nachgewieseu worden.