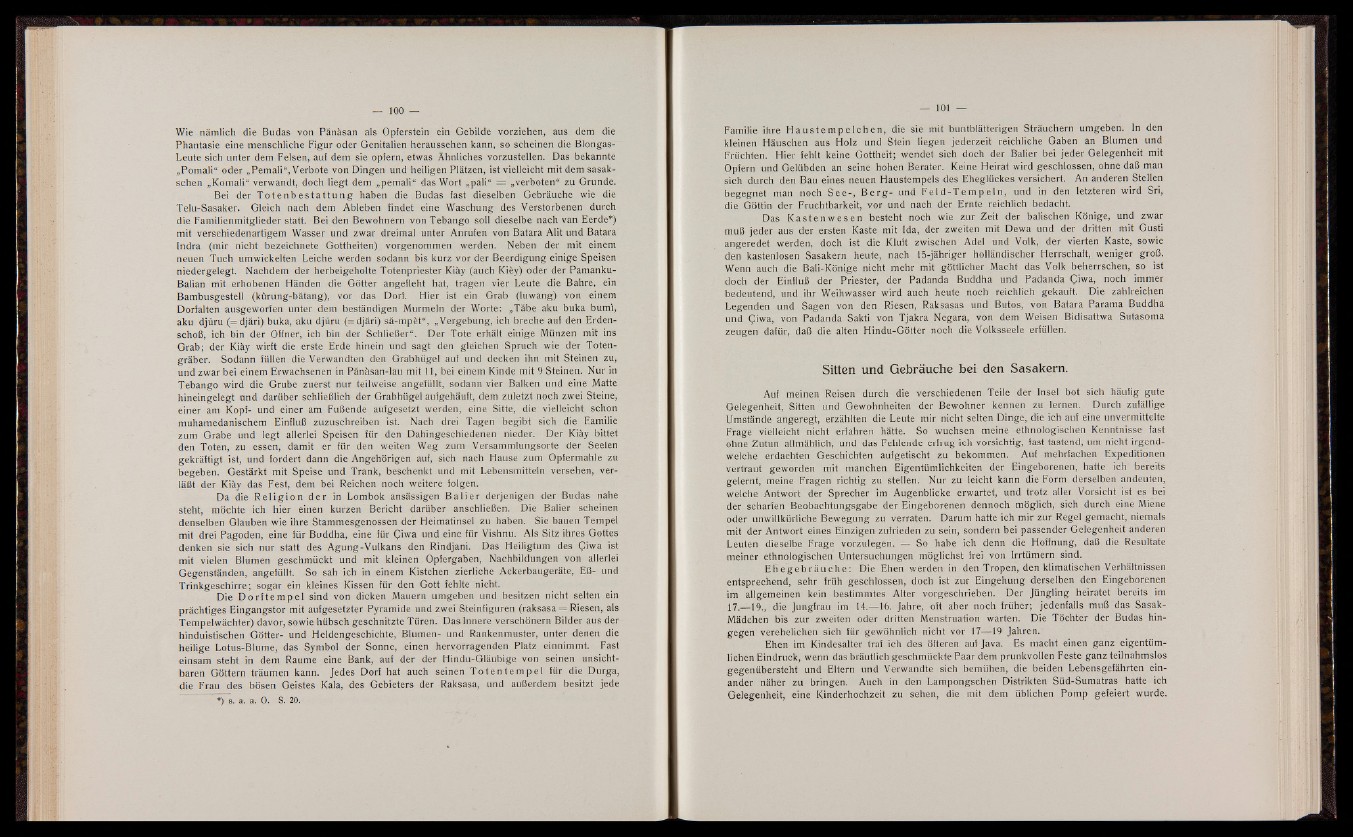
Wie nämlich die Budas von Pänäsan als Opferstein ein Gebilde vorziehen, aus dem die
Phantasie eine menschliche Figur oder Genitalien heraussehen kann, so scheinen die Blongas-
Leute sich unter dem Felsen, auf dem sie opfern, etwas Ähnliches vorzustellen. Das bekannte
„Pomali“ oder „Pemali“, Verbote von Dingen und heiligen Plätzen, ist vielleicht mit dem sasak-
schen „Komali“ verwandt, doch liegt dem „pemali“ das Wort „pali“ ==<„verboten“ zu Grunde.
Bei der T o t e n b e s t a t t u n g haben die Budas fast dieselben Gebräuche wie die
Telu-Sasaker. Gleich nach dem Ableben findet eine Waschung des Verstorbenen durch
die Familienmitglieder statt. Bei den Bewohnern von Tebängo soll dieselbe nach van Eerde*)
mit verschiedenartigem Wasser und zwar dreimal unter Anrufen von Batara Alit und Batara
Indra (mir nicht bezeichnete Gottheiten) vorgenommen werden. Neben der mit einem
neuen Tuch umwickelten Leiche werden sodann bis kurz vor der Beerdigung einige Speisen
niedergelegt. Nachdem der herbeigeholte Totenpriester Kiäy (auch Kiäy) oder der Pamanku-
Balian mit erhobenen Händen die Götter angefleht hat, tragen vier Leute die Bahre, ein
Bambusgestell (kürung-bätang), vor das Dorf. Hier ist ein Grab (luwang) von einem
Dorfalten ausgeworfen unter dem beständigen Murmeln der Worte: „Täbe aku buka buml,
aku djüru (= djäri) buka, aku djüru (= djäri) sä-mpät“, „Vergebung, ich breche auf den Erdenschoß,
ich bin der Öffner, ich bin der Schließer“. Der Tote erhält einige Münzen mit ins
Grab; der Kiäy wirft die erste Erde hinein und sagt den gleichen Spruch wie der Totengräber.
Sodann füllen die Verwandten den Grabhügel auf und decken ihn mit Steinen zu,
und zwar bei einem Erwachsenen in Pänäsan-lau mit 11, bei einem Kinde mit 9 Steinen. Nur in
Tebängo wird die Grube zuerst nur teilweise angefüllt, sodann vier Balken und eine Matte
hineingelegt und darüber schließlich der Grabhügel aufgehäuft, dem zuletzt noch zwei Steine,
einer am Kopf- und einer am Fußende aufgesetzt werden, eine Sitte, die vielleicht schon
muhamedanischem Einfluß zuzuschreiben ist. Nach drei Tagen begibt sich die Familie
zum Grabe und legt allerlei Speisen für den Dahingeschiedenen nieder. Der Kiäy bittet
den Toten, zu essen, damit er für den weiten Weg zum Versammlungsorte der Seelen
gekräftigt ist, und fordert dann die Angehörigen auf, sich nach Hause zum Opfermahle zu
begeben. Gestärkt mit Speise und Trank, beschenkt und mit Lebensmitteln versehen, verläßt
der Kiäy das Fest, dem bei Reichen noch weitere folgen.
Da die R e lig io n d e r in Lombok ansässigen B a li e r derjenigen der Budas nahe
steht, möchte ich hier einen kurzen Bericht darüber anschließen. Die Balier scheinen
denselben Glauben wie ihre Stammesgenossen der Heimatinsel zu haben. Sie bauen Tempel
mit drei Pagoden, eine für Buddha, eine für Qiwa und eine für Vishnu. Als Sitz ihres Gottes
denken sie sich nur statt des Agung-Vulkans den Rindjani. Das Heiligtum des Qiwa ist
mit vielen Blumen geschmückt und mit kleinen Opfergaben, Nachbildungen von allerlei
Gegenständen, angefüllt. So sah ich in einem Kistchen zierliche Ackerbaugeräte, Eß- und
Trinkgeschirre; sogar ein kleines Kissen für den Gott fehlte nicht.
Die D o r f t em p e l sind von dicken Mauern umgeben und besitzen nicht selten ein
prächtiges Eingangstor mit aufgesetzter Pyramide und zwei Steinfiguren (raksasa = Riesen, als
Tempelwächter) davor, sowie hübsch geschnitzte Türen. Das Innere verschönern Bilder aus der
hinduistischen Götter- und Heldengeschichte, Blumen- und Rankenmuster, unter denen die
heilige Lotus-Blume, das Symbol der Sonne, einen hervorragenden Platz einnimmt. Fast
einsam steht in dem Raume eine Bank, auf der der Hindu-Gläubige von seinen unsichtbaren
Göttern träumen kann. Jedes Dorf hat auch seinen T o t e n t e m p e l für die Durga,
die Frau des bösen Geistes Kala, des Gebieters der Raksasa, und außerdem besitzt jede
*) s. a. a. 0 . S. 20.
Familie ihre H ä u s t e m p e l c h e n , die sie mit buntblätterigen Sträuchern umgeben, ln den
kleinen Häuschen aus Holz und Stein liegen jederzeit reichliche Gaben an Blumen und
Früchten. Hier fehlt keine Gottheit; wendet sich doch der Balier bei-jeder Gelegenheit mit
Opfern und Gelübden an seine hohen Berater. Keine Heirat wird geschlossen, ohne daß man
sich durch den Bau eines neuen Haustempels des Eheglückes versichert. An anderen Stellen
begegnet man noch S e e - , B e r g - und F e l d - T e m p e l n , und in den letzteren wird Sri,
die Göttin der Fruchtbarkeit, vor und nach der Ernte reichlich bedacht.
Das K a s t e n w e s e n besteht noch wie zur Zeit der balischen Könige, und zwar
muß jeder aus der ersten Kaste mit Ida, der zweiten mit Dewa und der dritten mit Gusti
angeredet werden, doch ist die Kluft zwischen Adel und Volk, der vierten Kaste, sowie
den kastenlosen Sasakern heute, nach 15-jähriger holländischer Herrschaft, weniger groß.
Wenn auch die Bali-Könige nicht mehr mit göttlicher Macht das Volk beherrschen, so ist
doch der Einfluß der Priester, der Padanda Buddha und Padanda Qiwa, noch immer
bedeutend, und ihr Weihwasser wird auch heute noch reichlich gekauft. Die zahlreichen
Legenden und Sagen von den Riesen, Raksasas und Butos, von Batara Parama Buddha
und Qiwa, von Padanda Sakti von Tjakra Negara, von dem Weisen Bidisattwa Sutasoma
zeugen dafür, daß die alten Hindu-Götter noch die Volksseele erfüllen.
Sitten und Gebräuche bei den Sasakern.
Auf meinen Reisen durch die verschiedenen Teile der Insel bot sich häufig gute
Gelegenheit, Sitten und Gewohnheiten der Bewohner kennen zu lernerti Durch zufällige
Umstände angeregt, erzählten die Leute mir nicht selten Dinge, die ich auf eine unvermittelte
Frage vielleicht nicht erfahren hätte. So wuchsen meine ethnologischen Kenntnisse fast
ohne Zutun allmählich, und das Fehlende erfrug ich vorsichtig, fast tastend, um nicht irgendwelche
erdachten Geschichten aufgetischt zu bekommen. Auf mehrfachen Expeditionen
vertraut geworden mit manchen Eigentümlichkeiten der Eingeborenen, hatte ich bereits
gelernt, meine Fragen richtig zu stellen. Nur zu leicht kann i||p Form derselben andeuten,
welche Antwort der Sprecher im Augenblicke erwartet, und trotz aller Vorsicht ist es bei
der scharfen Beobachtungsgabe der Eingeborenen dennoch möglich, sich durch eine Miene
oder unwillkürliche Bewegung zu verraten. Darum hatte ich mir zur Regel gemacht, niemals
mit der Antwort eines Einzigen zufrieden zu sein, sondern bei passender Gelegenheit anderen
Leuten dieselbe Frage vorzulegen. — So habe ich denn die Hoffnung, daß die Resultate
meiner ethnologischen Untersuchungen möglichst frei von Irrtümern sind.
E h e g e b r ä u c h e : Die Ehen werden in den Tropen, den klimatischen Verhältnissen
entsprechend, sehr früh geschlossen, doch ist zur Eingehung derselben den Eingeborenen
im allgemeinen kein bestimmtes Alter vorgeschrieben. Der Jüngling heiratet bereits im
17.— 19., die Jungfrau im 1 4 ^ 1 6 . Jahre, oft aber noch früher; jedenfalls muß das Sasak-
Mädchen bis zur zweiten oder dritten Menstruation warten. Die Töchter der Budas hingegen
verehelichen sich für gewöhnlich nicht vor 17—19 Jahren.'
Ehen im Kindesalter traf ich des öfteren auf Java. Es macht einen ganz eigentümlichen
Eindruck, wenn das bräutlich geschmückte Paar dem prunkvollen Feste ganz teilnahmslos
gegenübersteht und Eltern und Verwandte sich bemühen, die beiden Lebensgefährten " einander
näher zu bringen. Auch in den Lampongschen Distrikten Süd-Sumatras hatte ich
Gelegenheit, eine Kinderhochzeit zu sehen, die mit dem üblichen Pomp gefeiert wurde.