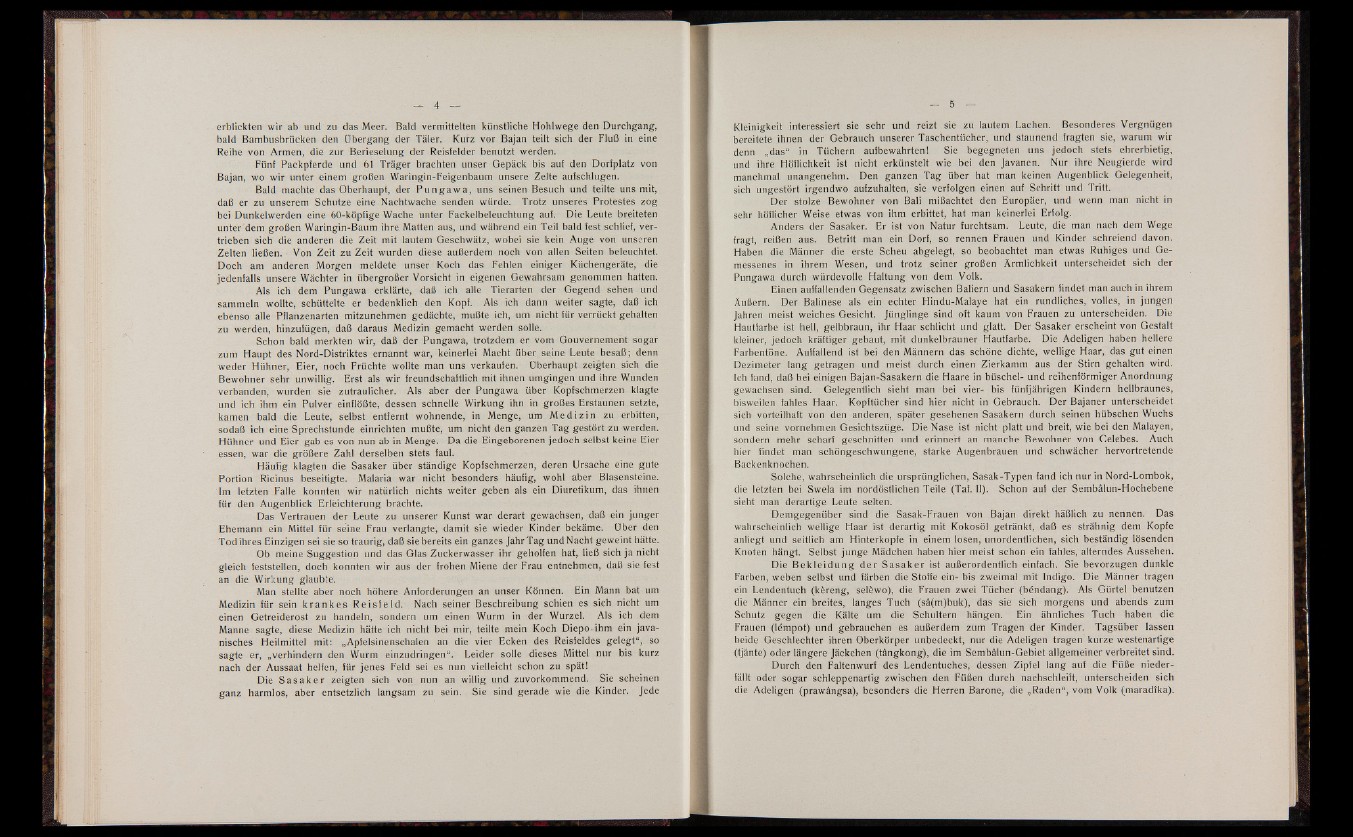
erblickten wir ab und zu das Meer. Bald vermittelten künstliche Hohlwege den Durchgang,
bald Bambusbrücken den Übergang der Täler. Kurz vor Bajan teilt sich der Fluß in eine
Reihe von Armen, die zur Berieselung der Reisfelder benutzt werden.
Fünf Packpferde und 61 Träger brachten unser Gepäck bis auf den Dorfplatz von
Bajan, wo wir unter einem großen Waringin-Feigenbaum unsere Zelte aufschlugen.
Bald machte das Oberhaupt, der P u n g a w a , uns seinen Besuch und teilte uns mit,
daß er zu unserem Schutze eine Nachtwache senden würde. Trotz unseres Protestes zog
bei Dunkelwerden eine 60-köpfige Wache unter Fackelbeleuchtung auf. Die Leute breiteten
unter dem großen Waringin-Baum ihre Matten aus, und während ein Teil bald fest schlief, vertrieben
sich die anderen die Zeit mit lautem Geschwätz, wobei sie kein Auge von unseren
Zelten ließen. Von Zeit zu Zeit wurden diese außerdem noch von allen Seiten beleuchtet.
Doch am anderen Morgen meldete unser Koch das Fehlen einiger Küchengeräte, die
jedenfalls unsere Wächter in übergroßer Vorsicht in eigenen Gewahrsam genommen hatten.
Als ich dem Pungawa erklärte, daß ich alle Tierarten der Gegend sehen und
sammeln wollte, schüttelte er bedenklich den Kopf. Als ich dann weiter sagte, daß ich
ebenso alle Pflanzenarten mitzunehmen gedächte, mußte ich, um nicht für verrückt gehalten
zu werden, hinzufügen, daß daraus Medizin gemacht werden solle.
Schon bald merkten wir, daß der Pungawa, trotzdem er vom Gouvernement sogar
zum Haupt des Nord-Distriktes ernannt war, keinerlei Macht über seine Leute besaß; denn
weder Hühner, Eier, noch Früchte wollte man uns verkaufen. Überhaupt zeigten sich die
Bewohner sehr unwillig. Erst als wir freundschaftlich mit ihnen umgingen und ihre Wunden
verbanden, wurden sie zutraulicher. Als aber der Pungawa über Kopfschmerzen klagte
und ich ihm ein Pulver einflößte, dessen schnelle Wirkung ihn in großes Erstaunen setzte,
kamen bald die Leute, selbst entfernt wohnende, in Menge, um M e d i z in zu erbitten,
sodaß ich eine Sprechstunde einrichten mußte, um nicht den ganzen Tag gestört zu werden.
Hühner und Eier gab es von nun ab in Menge. Da die Eingeborenen jedoch selbst keine Eier
essen, war die größere Zahl derselben stets faul.
Häufig klagten die Sasaker über ständige Kopfschmerzen, deren Ursache eine gute
Portion Ricinus beseitigte. Malaria war nicht besonders häufig, wohl aber Blasensteine.
Im letzten Falle konnten wir natürlich nichts weiter geben als ein Diuretikum, das ihnen
für den Augenblick Erleichterung brachte.
Das Vertrauen der Leute zu unserer Kunst war derart gewachsen, daß ein junger
Ehemann ein Mittel für seine Frau verlangte, damit sie wieder Kinder bekäme. Uber den
Tod ihres Einzigen sei sie so traurig, daß sie bereits ein ganzes Jahr Tag und Nacht geweint hätte.
Ob meine Suggestion und das Glas Zuckerwasser ihr geholfen hat, ließ sich ja nicht
gleich feststellen, doch konnten wir aus der frohen Miene der Frau entnehmen, daß sie fest
an die Wirkung glaubte.
Man stellte aber noch höhere Anforderungen an unser Können. Ein Mann bat um
Medizin für sein k r a n k e s R e is f e ld . Nach seiner Beschreibung schien es sich nicht um
einen Getreiderost zu handeln, sondern um einen Wurm in der Wurzel. Als ich dem
Manne sagte, diese Medizin hätte ich nicht bei mir, teilte mein Koch Dieporihm ein javanisches
Heilmittel mit: „Apfelsinenschalen an die vier Ecken des Reisfeldes gelegt“, so
sagte er, „verhindern den Wurm einzudringen“. Leider solle dieses Mittel nur bis kurz
nach der Aussaat helfen, für jenes Feld sei es nun vielleicht schon zu spät!
Die S a s a k e r zeigten sich von nun an willig und zuvorkommend. Sie scheinen
ganz harmlos, aber entsetzlich langsam zu sein. Sie sind gerade wie die Kinder. Jede
Kleinigkeit interessiert sie sehr und reizt sie zu lautem Lachen. Besonderes Vergnügen
bereitete ihnen der Gebrauch unserer Taschentücher, und staunend fragten sie, warum wir
denn „das“ in Tüchern aufbewahrten! Sie begegneten uns jedoch stets ehrerbietig,
und ihre Höflichkeit ist nicht erkünstelt wie bei den Javanen. Nur ihre Neugierde wird
manchmal unangenehm. Den ganzen Tag über hat man keinen Augenblick Gelegenheit,
sich ungestört irgendwo aufzuhalten, sie verfolgen einen auf Schritt und Tritt.
Der stolze Bewohner von Bali mißachtet den Europäer, und wenn man nicht in
sehr höflicher Weise etwas von ihm erbittet, hat man keinerlei Erfolg.
Anders der Sasaker. Er ist von Natur furchtsam. Leute, die man nach dem Wege
fragt, reißen aus. Betritt man ein Dorf, so rennen Frauen und Kinder schreiend davon.
Haben die Männer die erste Scheu abgelegt, so beobachtet man etwas Ruhiges und Gemessenes
in ihrem Wesen, und trotz seiner großen Ärmlichkeit unterscheidet sich der
Pungawa durch würdevolle Haltung von dem Volk.
Einen auffallenden Gegensatz zwischen Baliern und Sasakern findet man auch in ihrem
Äußern. Der Balinese als ein echter Hindu-Malaye hat ein rundliches, volles, in jungen
Jahren meist weiches Gesicht. Jünglinge sind oft kaum von Frauen zu unterscheiden. Die
Hautfarbe ist hell, gelbbraun, ihr Haar schlicht und glatt. Der Sasaker erscheint von Gestalt
kleiner, jedoch kräftiger gebaut, mit dunkelbrauner Hautfarbe. Die Adeligen haben hellere
Farbentöne. Auffallend ist bei den Männern das schöne dichte, wellige Haar, das gut einen
Dezimeter lang getragen und meist durch einen Zierkamm aus der Stirn gehalten wird.
Ich fand, daß bei einigen Bajan-Sasakern die Haare in büschel- und reihenförmiger Anordnung
gewachsen sind. Gelegentlich sieht man bei vier- bis fünfjährigen Kindern hellbraunes,
bisweilen fahles Haar. Kopftücher sind hier nicht in Gebrauch. Der Bajaner unterscheidet
sich vorteilhaft von den anderen, später gesehenen Sasakern durch seinen hübschen Wuchs
und seine vornehmen Gesichtszüge. Die Nase ist nicht platt und breit, wie bei den Malayen,
sondern mehr scharf geschnitten und erinnert an manche Bewohner von Celebes. Auch
hier findet man schöngeschwungene, starke Augenbrauen und schwächer hervortretende
Backenknochen.
Solche, wahrscheinlich die ursprünglichen, Sasak-Typen fand ich nur in Nord-Lombok,
die letzten bei Swela im nordöstlichen Teile (Taf. II). Schon auf der Sembälun-Hochebene
sieht man derartige Leute selten.
Demgegenüber sind die Sasak-Frauen von Bajan direkt häßlich zu nennen. Das
wahrscheinlich wellige Haar ist derartig mit Kokosöl getränkt, daß es strähnig dem Kopfe
anliegt und seitlich am Hinterkopfe in einem losen, unordentlichen, sich beständig lösenden
Knoten hängt. Selbst junge Mädchen haben hier meist schon ein fahles, alterndes Aussehen.
Die B e k le id u n g d e r S a s a k e r ist außerordentlich einfach. Sie bevorzugen dunkle
Farben, weben selbst und färben die Stoffe ein- bis zweimal mit Indigo. Die Männer tragen
ein Lendentuch (k£reng, sel£wo), die Frauen zwei Tücher (b^ndang). Als Gürtel benutzen
die Männer ein breites, langes Tuch (sä(m)buk), das sie sich morgens und abends zum
Schutz gegen die Kälte um die Schultern hängen. Ein ähnliches Tuch haben die
Frauen (16mpot) und gebrauchen es außerdem zum Tragen der Kinder. Tagsüber lassen
beide Geschlechter ihren Oberkörper unbedeckt, nur die Adeligen tragen kurze westenartige
(tjänte) oder längere Jäckchen (tängkong), die im Sembälun-Gebiet allgemeiner verbreitet sind.
Durch den Faltenwurf des Lendentuches, dessen Zipfel lang auf die Füße niederfällt
oder sogar schleppenartig zwischen den Füßen durch nachschleift, unterscheiden sich
die Adeligen (prawängsa), besonders die Herren Barone, die „Raden“* vom Volk (maradtka).