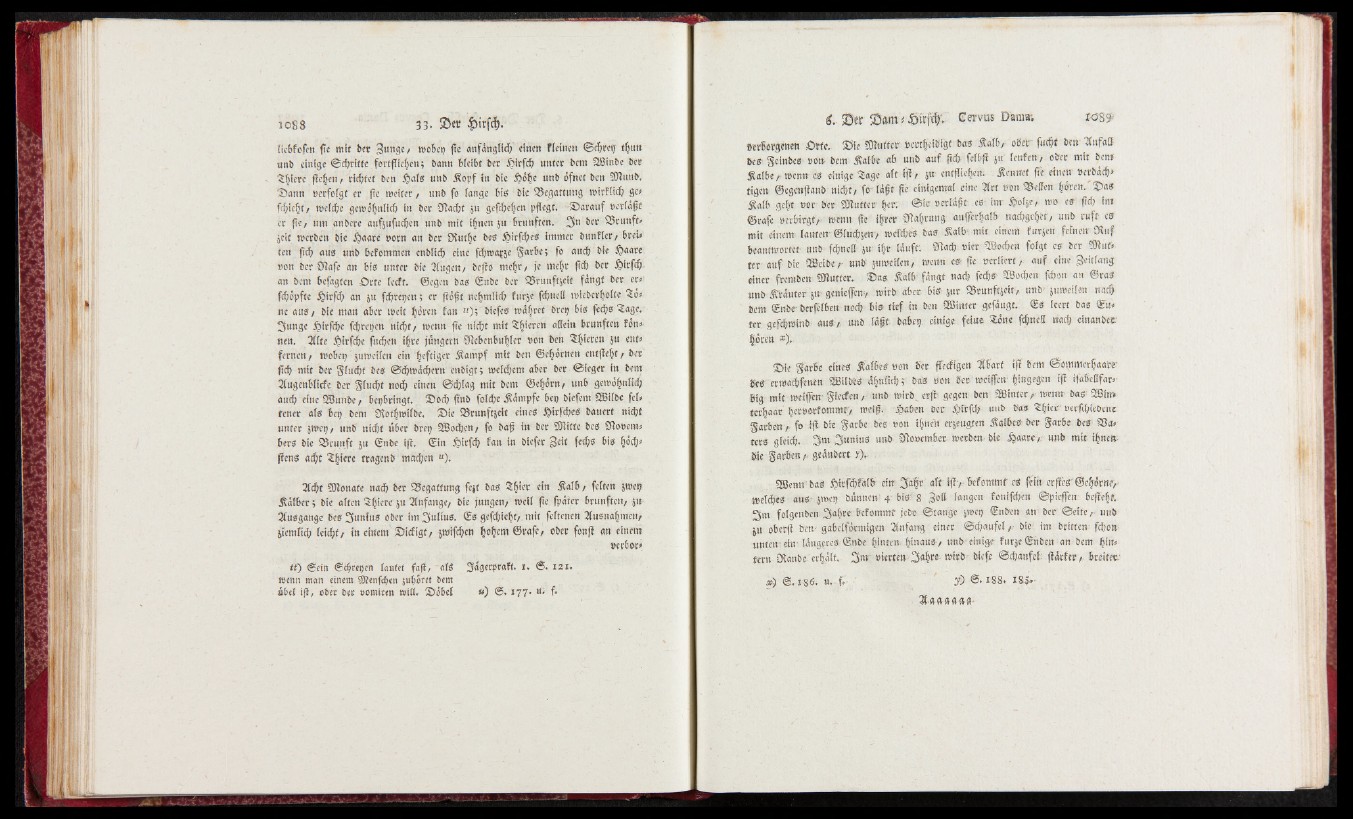
iicbfofen ße mit bet 3 imge/ wöbet; ße atifängiid; einen Fieinen ©eßtetj fßtm
unb einige ©dritte fortffie^en; bann bicibt ber fiiirfd) unter bem ©inbe ber
'Jßierc fielen, rietet ben §a[s unb Äopf in bie fjöße unb öfnet ben ©unb.
Sann »erfolgt er fte weiter / unb fo (ange bis bie Begattung wiriiieß ge»
feßießt/ weieße gewößniteß in ber Sftacßt ju gefeßeßen pflegt. Sarauf »erläßt
er fte/ Um anbere aufjufueßen unb mit ißnen ju brunften. 3 n ber SJrunft»
jeit werben bie ijaare »orn an ber Diutße beS Äirfcßes immer bunflet/ bret»
ten ftdf) aus unb befommen enbiieß eine ßßwapje garbe; fo attefj bie $aare
»on ber SSafc an bis unter bie 3Cugen/ beßo meßt / je meßr ßcß bet ^irfdß
an bem befagten £)rte ieeft. ©egen bas (Ettbe ber 93runftjett fängt ber er»1
feftöpfte jjirfd; an ju feßrepen; er flößt neßmiitf? furje feßneii wicberßoite 3 ö»
ne aus/ bie man aber Weif flöten fan w); biefes wäßret brep bis feeßs ?age.
3tmgc öjirfeße feßrepen nlcßf/ wenn ße nirfjt mit gieren allein brunften fön»
nen. 2([fe Äirfcße finden ißre jungem Ülcbcnbußfcr »on ben Sßiercn ju ent»
fernen/ wobep juweiien ein ßeftiget Äampf mit ben ©eßörnen entßeßt/ ber
ßcß mit ber gfueßt bes ©ößwäcßcrn enbigt; wefdjem aber ber ©leger in bem
3(ugenbfitfc ber glucf?( nod; einen ©djtag mit betn ©eßörn/ unb gewoßniieß
aueß eine ©unbe/ bepbringt. Socß ßnb foieße Kämpfe bep biefem SSBifbe fei»
rener afs bep bem Ototßwiibe. Sie 25runftjeit eines $irfcßes bauert Hießt
unter jwep/ unb nief/t über brep ©oeßen/ fo baß in ber SSJlitte bes 9 io»cm»
bers bie SJJrunft ju ©nbe iß. Sin öjirfcß fan in biefer Seit feeßs bis ßoeß»
ffens aeßt Sßiete tragenb maeßen “ ).
2ftßt ©onafe naeß ber Begattung fcjt bas Sßier ein M b / feiten jwep
Ääiber; bie aifen ?ßtcre ju Anfänge/ bie jungen/ weil ße fpäter brunften/ ju
Ausgange bes^unius ober im Julius. Ss gefeßießt/. mit feitenen Kusnaßmen/
Siemticß leießf/ in einem Sicfigt/ jwtfcßen ßoßem ©rafe/ ober fonß an einem
»erbot»
ff) ©ein ©eßtepef» taufet faß, afS ^ogetprafu t. ©. 121.
wenn man einem SKenfcßen jubötet bem
übet iß, ober ber »omiren wiK, Söbef
»erborgenen £>rfe. Sie ©uffer »crtßciBfgt bas M b / ober fueßt ben Knfatt
bes geinbes »on. bem Äafbe ab unb auf ßcß feibß ju teufen/ ober mit bem
Äalbe r wenn es einige Sage alt iß / jn cnfßießcm Rennet ße einen »erbäcß»
tigen ©egcnßanb meßt/ fo läßt ße ethigemai eine ?trt »on Neffen ßoren. Sas
^aib geßt »Of ber ©ufter ßer: @ic »erläßt cs- tm £>oijr/ wo es ßcß im
©rafe »erbirgt/- wenn ße ißect SRaßcnug aufferßaib naeßgeßet / unb ruft cs
mit einem lauten- ©tiicßjtn/ wrTcßes bas Salb- mit einem furjeri feinen- fKuf
beantwortet tmb feßneß 51t ißt läuft; Sladß- »ier ©oeßen folgt cs ber ©uf»
ter auf bie ©eibeunb juweifen, wenn cs- ße »eriierf, auf eine ^eitiang
einer fremben «SKntfer. Sas M b ' fängt naeß feeßs ©oeßen feßon an ©ras
unb Äräüter 51t’ genieffcw/ wirb aber bis-jur fBrunftjeit , unb’ juweifen natß
bem Silbe berfeiben noeß bis tief in ben ©inter gefäugt. Ss leert bas ©u»
ter gefeßwinb aus /. unb läßt babep einige feiue 5 öne fd;ncd naeß einanbet
ßören *).
Sie gärbe eines ÄaibeS »on ber ßeefigen libätf iß' bem ©ommerßaare-
6tS erwatßfcntn ©übts äßtificß? baS »on Bef weißen- ßingegen iß tfaßcCfar»
Big mit weißen' gietfen, unb wirb, ecß gegen’ ben ©inter / wemt bas ©fm
terßaar ßeworfommt/ weiß. S)aben ber ijitfeß unb bas ?ßier »erfeßiebene
garben/ fb iß bie garbc bes »on tßnen erjeugjen Äatbcs ber gatbe bes Sßa»
ters gieieß. 2fm 3unius unb 2ßo»ember werben bie ä?aace/: unb mit ißneu-
bie garben/ geänbert y),.
©enn bas fjirfcßfatb ein 3 'aßr aft iß/ Befommt es feilt crßcS'Seßönte,-
weteßes aus- jwep bnmieni 4 bis: 8 gott (äugen fonifeßen ©pießen beßeßf.
3m folgcnbcn 3 ttßre befommr jeDe ©tange jwep ©nben an ber ©eite/ unb
ui oberji ben- gabelförmigen Knfarrg einer ©cßaufcl /- bie’ im britfen feßon
unten-ein längeres ®nbe ßi 11 ten. ßinauS/ unb einige furje ©nbe.n an bem ßlit»
fern Dianbc crßäit, 3m t>ierteit 3«ß« wirb- biefe ©eßaufei; ßärfer/ breiter;
yi) ©. 188. iSJ--
Xaaaaa«.