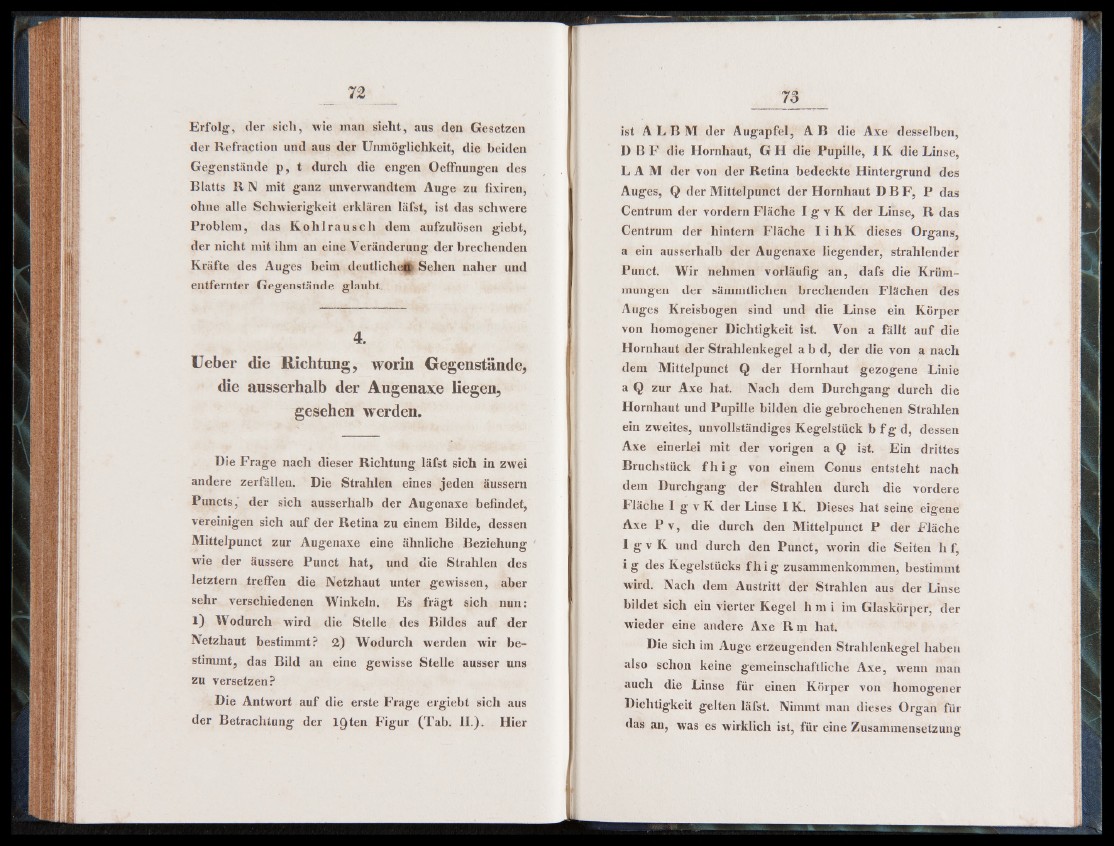
Erfolg, der sich, wie man sieht, aus den Gesetzen
der Refraction und aus der Unmöglichkeit, die beiden
Gegenstände p , t durch die engen Oeffnungen des
Blatts R N mit ganz unverwandtem Auge zu fixiren,
ohne alle Schwierigkeit erklären läfst, ist das schwere
Problem, das Kohl raus ch dem aufzulösen giebt,
der nicht mit ihm an eine Veränderung der brechenden
Kräfte des Auges beim deutliche^ Sehen naher und
entfernter Gegenstände glaubt.
4.
Ueber die Richtung, worin Gegenstände,
die ausserhalb der Augenaxe liegen,
gesehen werden.
Die Frage nach dieser Richtung läfst sich in zwei
andere zerfallen. Die Strahlen eines jeden äussern
Pnncts,' der sich ausserhalb der Augenaxe befindet,
vereinigen sich auf der Retina zu einem Bilde, dessen
Mittelpunct zur Augenaxe eine ähnliche Beziehung
wie der äussere Punct hat, und die Strahlen des
letztem treffen die Netzhaut unter gewissen, aber
sehr verschiedenen Winkeln. Es fragt sich nun:
l) Wodurch wird die Stelle des Bildes auf der
Netzhaut bestimmt? 2) Wodurch werden wir bestimmt,
das Bild an eine gewisse Stelle ausser uns
zu versetzen?
Die Antwort auf die erste Frage ergiebt sich aus
der Betrachtung der lQten Figur (Tab, II.). Hier
ist A L B M der Augapfel, A B die Axe desselben,
D B F die Hornhaut, G H die Pupille, I K die Linse,
L A M der von der Retina bedeckte Hintergrund des
Auges, Q der Mittelpunct der Hornhaut D B F, P das
Centrum der vordem Fläche I g v K der Linse, R das
Centrum der hintern Fläche I i h K dieses Organs,
a ein ausserhalb der Augenaxe liegender, strahlender
Punct. Wir nehmen vorläufig an, dafs die Krümmungen
der sämmtlichen brechenden Flächen des
Auges Kreisbogen sind und die Linse ein Körper
von homogener Dichtigkeit ist. Von a fällt auf die
Hornhaut der Strahlenkegel a b d, der die von a nach
dem Mittelpunct Q der Hornhaut gezogene Linie
a Q zur Axe hat. Nach dem Durchgang durch die
Hornhaut und Pupille bilden die gebrochenen Strahlen
ein zweites, unvollständiges Kegelstück b f g d, dessen
Axe einerlei mit der vorigen a Q ist. Ein drittes
Bruchstück f h i g von einem Conus entsteht nach
dem Durchgang der Strahlen durch die vordere
Fläche I g v K der Linse I K. Dieses hat seine eigene
Axe P v, die durch den Mittelpunct P der Fläche
1 g v K und durch den Punct, worin die Seiten h f,
ig des Kegelstücks f h ig Zusammenkommen, bestimmt
wird. Nach dem Austritt der Strahlen aus der Linse
bildet sich ein vierter Kegel hm i im Glaskörper, der
wieder eine andere Axe R m hat.
Die sich im Auge erzeugenden Strahlenkegel haben
also schon keine gemeinschaftliche Axe, wTenn man
auch die Linse für einen Körper von homogener
Dichtigkeit gelten läfst. Nimmt man dieses Organ für
das an, was es wirklich ist, für eine Zusammensetzung