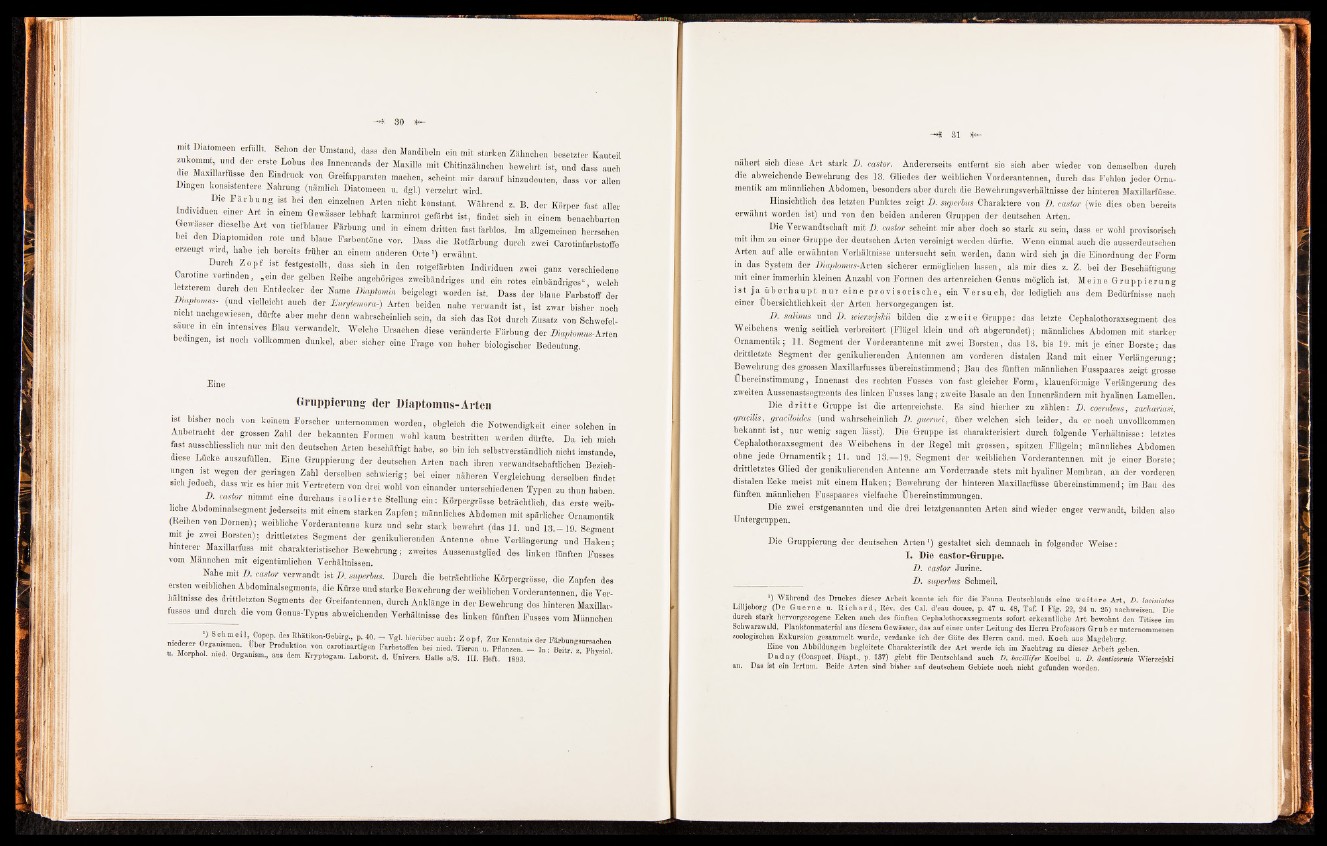
mit Diatomeen erfüllt. Schon der Umstand, dass den Mandibeln ein mit starken Zähnchen besetzter Kauteil — 9 erS‘G L°bUS d6S Innenrands der Maxille mit Chitinzähnohen bewehrt ist, nnd dass auch
le Maxillarfüsse den Eindrnck von Greifapparaten machen, scheint mir darauf hinzudeuten, dass vor allen
Dingen konsistentere Nahrung (nämlich Diatomeen u. dgl.) verzehrt wird.
t I I H H m B ist bei den einzelnen Arten nicht konstant. Während z. B. der Körper fast aller
Individuen einer Art in einem Gewässer lebhaft karminrot gefärbt ist, findet sich in einem benachbarten
Gewässer dieselbe Art von tiefblauer Färbung und in einem dritten fast farblos, ■ Im allgemeinen herrschen
he. den D.aptomiden rote und blaue Farbentöne vor. Dass die Botfärbung durch zwei Carotinfarbstoffe
erzeugt wird, habe ich bereits früher an einem anderen Orte1) erwähnt.
Durch Z o p f ist festgestellt, dass sich in den rotgefärbten Individuen zwei ganz verschiedene
Carotine vorfinden, ,em der gelben Reihe angehöriges zweibändriges und ein rotes einbändriges“ , welch
letzterem durch den Entdecker der Name Diaptomin beigelegt worden ist. Dass der blaue Farbstoff der
Dmptomm- (und vielleicht auch der Burytemora-) Arteu beiden nahe verwandt ist, ist zwar bisher noch
nicht nachgewiesen, durfte aber mehr denn wahrscheinlich sein, da sich das Rot durch Zusatz von Schwefelsäure
in em intensives Blau verwandelt. Welche Ursachen diese veränderte Färbung der Ä o p ta « -A r te n
bedingen, ist noch vollkommen dunkel, aber sicher eine Frage von hoher biologischer Bedeutung.
Eine
Gruppierung der Diaptomns-Arten
ist bisher noch von keinem Forscher unternommen worden, obgleich die Notwendigkeit einer solchen in
Anbetracht der grossen Zahl der bekannten Formen wohl kaum bestritten werden dürfte. Da ich mich
fast ausschliesslich nur mit den deutschen Arten beschäftigt habe, so bin ich selbstverständlich nicht imstande,
diese Lucke auszufullen. Eine Gruppierung der deutschen Arten nach ihren verwandtschaftlichen Beziehungen
ist wegen der geringen Zahl derselben schwierig; bei einer, näheren Vergleichung derselben findet
sich jedoch, dass wir es hier mit Vertretern von drei wohl von einander unterschiedenen Typen zu thun haben,
I 9 8 9 9 mmmt ei”e durohaus i s o l i e r t e Stellung ein: Körpergrösse beträchtlich, das erste weib-
hclie Abdommalsegment j'ederseits mit einem starken Zapfen; männliches Abdomen mit spärlicher Ornamentik
(Reihen von Dornen); weibliche Vorderantenne kurz und sehr stark bewehrt (das 11. und 13 - 1 9 Segment
mit je zwei Borsten); drittletztes Segment der genikulierenden Antenne ohne Verlängerung und Haken-
hinterer Maxillarfuss mit charakteristischer Bewehrung; zweites Aussenastglied des linken fünften Fusses
vom Männchen mit eigentümlichen Verhältnissen.
Nahe mit D. castor verwandt ist D. superbus. Durch die beträchtliche Körpergrösse, die Zapfen des
ersten weiblichen Abdommalsegments, die Kürze und starke Bewehrung der weiblichen Vorderantennen, die Verhältnisse
des drittletzten Segments der Greifantennen, durch Anklänge in der Bewehrung des hinteren Maxillar-
fusses und durch die vom Genus-Typus abweichenden Verhältnisse des linken fünften Fusses vom Männchen
. , „ -2 Sc.I,mci1'J?°pe£ B 9 h 9 3 S p-9 - V«b hieriiber “ cb: Zopf, Zur Kenntnis der Färbungsursachen
, 1 r, ° rgam!m®n- Uber Produktion von carotinartigen Farbstoffen bei nied. Tieren u. Pflanzen. - ln: Beitr z Phvsiol
u. Morphol. med. Orgamsm., aus dem Kryptogam. Laborat. d. Univers, Halle a/S. III. Heft. 1893.
nähert sich diese Art stark D. castor. Andererseits entfernt sie sich aber wieder von demselben durch
die abweichende Bewehrung des 13. Gliedes der weiblichen Vorderantennen, durch das Pehlen jeder Ornamentik
am männlichen Abdomen, besonders aber durch die Bewehrungsverhältnisse der hinteren Maxillarfüsse.
Hinsichtlich des letzten Punktes zeigt D. superbus Charaktere von D. castor (wie dies oben bereits
erwähnt worden ist) und von den beiden anderen Gruppen der deutschen Arten.
Die Verwandtschaft mit D. castor scheint mir aber doch so stark zu sein, dass er wohl provisorisch
mit ihm zu einer Gruppe der deutschen Arten vereinigt werden dürfte. Wenn einmal auch die ausserdeutschen
Arten auf alle erwähnten Verhältnisse untersucht sein werden, dann wird sich ja die Einordnung der Form
in das System der JDiaptomus-Arten sicherer ermöglichen lassen, als mir dies z. Z. bei der Beschäftigung
mit einer immerhin kleinen Anzahl von Formen des artenreichen Genus möglich ist. M e in e G r u p p ie r u n g
i s t j a ü b e r h a u p t n u r e in e p r o v i s o r i s c h e , ein V e r s u c h , der lediglich aus dem Bedürfnisse nach
einer Übersichtlichkeit der Arten hervorgegangen ist.
JD. salinus und D. wierzejskii bilden die zw e it e Gruppe: das letzte Cephalothoraxsegment des
Weibchens wenig seitlich verbreitert (Flügel klein und oft abgerundet); männliches Abdomen mit starker
Ornamentik; 1 1 . Segment der Vorderantenne mit zwei Borsten, das 13. bis 19. mit je einer Borste; das
drittletzte Segment der genikulierenden Antennen am vorderen distalen Rand mit einer Verlängerung;
Bewehrung des grossen Maxillarfusses übereinstimmend; Bau des fünften männlichen Fusspaares zeigt grosse
ÜbereinstimmuDg, Innenast des rechten Fusses von fast gleicher Form, klauenförmige Verlängerung des
zweiten Aussenastsegments des linken Fusses lang; zweite Basale an den Innenrändern mit hyalinen Lamellen.
Die d r i t t e Gruppe ist die artenreichste. Es sind hierher zu zählen: JD. coeruleus, mchariasi,
gracüis, graciloides (und wahrscheinlich JD. guernei, über welchen sich leider, da er noch unvollkommen
bekannt ist, nur wenig sagen lässt). Die Gruppe ist charakterisiert durch folgende Verhältnisse: letztes
Cephalothoraxsegment des Weibchens in der Regel mit grossen, spitzen Flügeln; männliches Abdomen
ohne jede Ornamentik; 1 1 . und 13.— 19. Segment der weiblichen Vorderantennen mit je einer Borste;
drittletztes Glied der genikulierenden Antenne am Vorderrande stets mit hyaliner Membran, an der vorderen
distalen Ecke meist mit einem Haken; Bewehrung der hinteren Maxillarfüsse übereinstimmend; im Bau des
fünften männlichen Fusspaares vielfache Übereinstimmungen.
Die zwei erstgenannten und die drei letztgenannten Arten sind wieder enger verwandt, bilden also
Untergruppen.
Die Gruppierung der deutschen Arten1) gestaltet sich demnach in folgender Weise:
I . Die castor-Gruppe.
D. castor Jurine.
___________________________ JD. superbus Schmeil.
x) Während des Druckes dieser Arbeit konnte ich für die Fauna Deutschlands eine w e ite re Art, D. laciniatus
Lilljeborg (De G u ern e u. R ic h a rd , Rev. des Cal. d’eau douce, p. 47 u. 48, Taf. I Fig. 22, 24 u. 25) nachweisen. Die
durch stark hervorgezogene Ecken auch des fünften Cephalothoraxsegments sofort erkenntliche Art bewohnt den Titisee im
Schwarzwald. Planktonmaterial aus diesem Gewässer, das auf einer unter Leitung des Herrn Professors Grub er unternommenen
zoologischen Exkursion gesammelt wurde, verdanke ich der Güte des Herrn cand. med. Koch aus Magdeburg.
Eine von Abbildungen begleitete Charakteristik der Art werde ich im Nachtrag zu dieser Arbeit geben.
Dad ay (Conspect-. Diapt., p. 137) giebt für Deutschland auch D. baciUifer Koelbel u. D. denticornis Wierzejski
an. Das ist ein Irrtum. Beide Arten sind bisher auf deutschem Gebiete noch nicht gefunden worden.