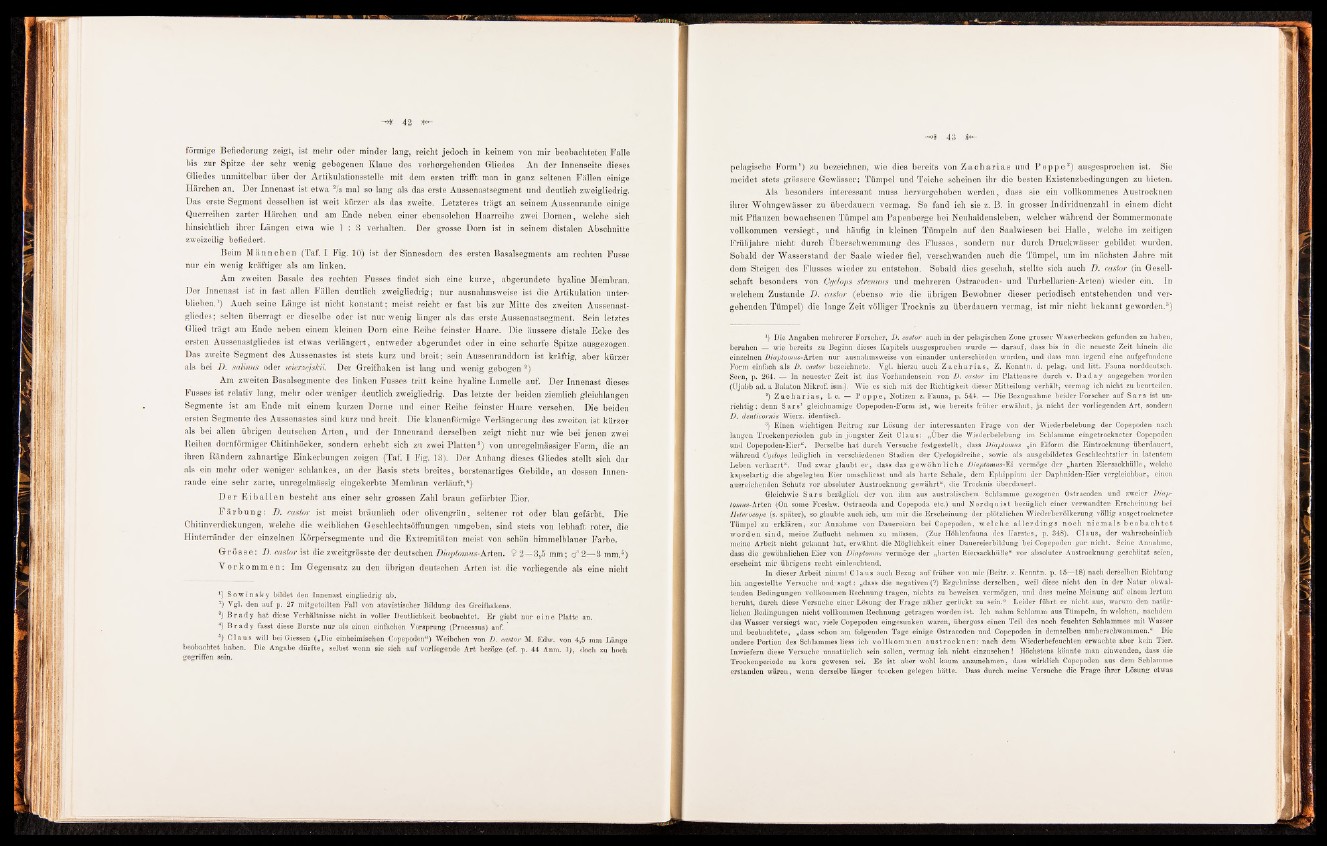
förmige Befiederung zeigt, ist mehr oder minder lang, reicht jedoch in keinem von mir beobachteten Falle
bis zur Spitze der sehr wenig gebogenen Klaue des vorhergehenden Gliedes. An der Innenseite dieses
Gliedes unmittelbar über der Artikulationsstelle mit dem ersten trifft man in ganz seltenen Fällen einige
Härchen an. Der Innenast ist etwa 2/s mal so lang als das erste Aussenastsegment und deutlich zweigliedrig.
Das erste Segment desselben ist weit kürzer als das zweite. Letzteres trägt an seinem Aussenrande einige
Querreihen zarter Härchen und am Ende neben einer ebensolchen Haarreihe zwei Dornen, welche sich
hinsichtlich ihrer Längen etwa wie 1 : 3 verhalten. Der grosse Dorn ist in seinem distalen Abschnitte
zweizeilig befiedert.
Beim M ä n n c h e n (Taf. I Fig. 10) ist der Sinnesdorn des ersten Basalsegments am rechten Fusse
nur ein wenig kräftiger als am linken.
Am zweiten Basale des rechten Fusses findet sich eine kurze, abgerundete hyaline Membran.
Der Innenast ist in fast allen Fällen deutlich zweigliedrig; nur ausnahmsweise ist die Artikulation unterblieben.
1) Auch seine Länge ist nicht konstant; meist reicht er fast bis zur Mitte des zweiten Aussenast-
gliedes; selten überragt er dieselbe oder ist nur wenig länger als das erste Aussenastsegment. Sein letztes
Glied trägt am Ende neben einem kleinen Dorn eine Reihe feinster Haare. Die äussere distale Ecke des
ersten Aussenastgliedes ist etwas verlängert, entweder abgerundet oder in eine scharfe Spitze ausgezogen.
Das zweite Segment des Aussenastes ist stets kurz und breit; sein Aussenranddorn ist kräftig, aber kürzer
als bei D. salinus oder wierzejsMi. Der Greifhaken ist lang und wenig gebogen 2)
Am zweiten Basalsegmente des linken Fusses tritt keine hyaline Lamelle auf. Der Innenast dieses
Fusses ist relativ lang, mehr oder weniger deutlich zweigliedrig. Das letzte der beiden ziemlich gleichlangen
Segmente ist am Ende mit einem kurzen Dorne und einer Reihe feinster Haare versehen. Die beiden
ersten Segmente des Aussenastes sind kurz und breit. Die klauenförmige Verlängerung des zweiten ist kürzer
als bei allen übrigen deutschen Arten, und der Innenrand derselben zeigt nicht nur wie bei jenen zwei
Reihen dornförmiger Chitinhöcker, sondern erhebt sich zu zwei Platten8) von unregelmässiger Form, die an
ihren Rändern zahnartige Einkerbungen zeigen (Taf. I Fig. 13). Der Anhang dieses Gliedes stellt sich dar
als ein mehr oder weniger schlankes, an der Basis stets breites, borstenartiges Gebilde, an dessen Innenrande
eine sehr zarte, unregelmässig eingekerbte Membran verläuft.4)
D e r E i b a l l e n besteht aus einer sehr grossen Zahl braun gefärbter Eier.
F ä r b u n g : D. castor ist meist bräunlich oder olivengrün, seltener rot oder blau gefärbt. Die
Chitinverdickungen, welche die weiblichen Geschlechtsöffnungen umgeben, sind stets von lebhaft roter, die
Hinterränder der einzelnen Körpersegmente und die Extremitäten meist von schön himmelblauer Farbe.
G rö s s e : D. castor ist die zweitgrösste der deutschen JDiaptomus-Arten. 9 2—3,5 mm; c?2—3 mm.5)
V o rk om m e n : Im Gegensatz zu den übrigen deutschen Arten ist die vorliegende als eine nicht
*) S ow in sk y bildet den Innenast eingliedrig ab.
2) Vgl. den auf p. 27 mitgeteilten Fall von atavistischer Bildung des Greifhakens.
8) B ra d y hat diese Verhältnisse nicht in voller Deutlichkeit beobachtet. Er giebt nur e in e Platte an.
4) B ra d y fasst diese Borste nur als einen einfachen Vorsprung (Processus) auf.
5) Clau s will bei Giessen (»Die einheimischen Copepoden“) Weibchen von D. castor M. Edw. von 4,5 mm Länge
beobachtet haben. Die Angabe dürfte, selbst wenn sie sich auf vorliegende Art bezöge (cf. p. 44 Anm. 1), doch zu hoch
gegriffen sein.
pelagische Form1) zu bezeichnen, wie dies bereits von Z a c h a r i a s und P o p p e 2) ausgesprochen ist. Sie
meidet stets grössere Gewässer; Tümpel und Teiche scheinen ihr die besten Existenzbedingungen zu bieten.
Als besonders interessant muss hervorgehoben werden, dass sie ein vollkommenes Austrocknen
ihrer Wohngewässer zu überdauern vermag. So fand ich sie z. B. in grösser Individuenzahl in einem dicht
mit Pflanzen bewachsenen Tümpel am Papenberge bei Neuhaldensleben, welcher während der Sommermonate
vollkommen versiegt, und häufig in kleinen Tümpeln auf den Saalwiesen bei Halle, welche im zeitigen
Frühjahre nicht durch Überschwemmung des Flusses, sondern nur durch Druckwässer gebildet wurden.
Sobald der Wasserstand der Saale wieder fiel, verschwanden auch die Tümpel, um im nächsten Jahre mit
dem Steigen des Flusses wieder zu entstehen. Sobald dies geschah, stellte sich auch D. castor (in Gesellschaft
besonders von Oyclops strenuus und mehreren Ostracoden- und Turbellarien-Arten) wieder ein. In
welchem Zustande D. castor (ebenso wie die übrigen Bewohner dieser periodisch entstehenden und vergehenden
Tümpel) die lange Zeit völliger Trocknis zu überdauern vermag, ist mir nicht bekannt geworden.3)
*) Die Angaben mehrerer Forscher, D. castor auch in der pelagischen Zone grösser Wasserbecken gefunden zu haben,
beruhen wie bereits zu Beginn dieses Kapitels ausgesprochen wurde — darauf, dass bis in die neueste Zeit hinein die
einzelnen Diaptomus-Arten nur ausnahmsweise von einander unterschieden wurden, und dass man irgend eine aufgefundene
Form einfach als D. castor bezeichnete. Vgl. hierzu auch Z a c h a r ia s , Z. Kenntn. d. pelag. und litt. Fauna norddeutsch.
Seen, p. 264. — In neuester Zeit ist das Vorhandensein von D. castor im Plattensee durch v. Daday angegeben worden
(Ujabb ad. a Balaton Mikrof. ism.). Wie es sich mit der Richtigkeit dieser Mitteilung verhält, vermag ich nicht zu beurteilen.
2) Z a c h a r ia s , I.e. — P o p p e , Notizen z. Fauna, p. 541. — Die Bezugnahme beider Forscher auf S a rs ist unrichtig;
denn S a r s ’ gleichnamige Copepoden-Form ist, wie bereits früher erwähnt, ja nicht der vorliegenden Art, sondern
D. denticornis Wierz. identisch.
3) Einen wichtigen Beitrag zur Lösung der interessanten Frage von der Wiederbelebung der Copepoden nach
langen Trockenperioden gab in jüngster Zeit Claus: „Über die Wiederbelebung im Schlamme eingetrockneter Copepoden
und Copepoden-Eier“. Derselbe hat durch Versuche festgestellt, dass Diaptomus „in Eiform die Eintrocknung überdauert,
während Ci/clops lediglich in verschiedenen Stadien der Cyclopidreihe, sowie als ausgebildetes Geschlechts!ier in latentem
Leben verharrt“. Und zwar glaubt er, dass das g ew ö h n lich e Diaptomus-^A vermöge der „harten Eiersackhülle, welche
kapselartig die abgelegten Eier umschliesst und als harte Schale, dem Ephippium der Daphniden-Eier vergleichbar, einen
ausreichenden Schutz vor absoluter Austrocknung gewährt“, die Trocknis überdauert.
Gleichwie S a r s bezüglich der von ihm aus australischem Schlamme gezogenen Ostracoden und zweier Diaptomus
Arten (On some Freshw. Ostracoda and Copepoda etc.) und N o rd q u ist bezüglich einer verwandten Erscheinung bei
Heterocope (s. später), so glaubte auch ich, um mir die Erscheinung der plötzlichen Wiederbevölkerung völlig ausgetrockneter
Tümpel zu erklären, zur Annahme von Dauereiern bei Copepoden, w e lc h e a lle rd in g s noch n iem a ls b e o b a c h te t
worden sind, meine Zuflucht nehmen zu müssen. (Zur Höhlenfauna des Karstes, p. 348). Claus, der wahrscheinlich
meine Arbeit nicht gekannt hat, erwähnt die Möglichkeit einer Dauereierbildung bei Copepoden gar nicht. Seine Annahme,
dass die gewöhnlichen Eier von Diaptomus vermöge der „harten Eiersackhülle“ vor absoluter Austrocknung geschützt seien,
erscheint mir übrigens recht einleuchtend.
In dieser Arbeit nimmt Claus auch Bezug auf früher von mir (Beitr. z. Kenntn. p. 15—18) nach derselben Richtung
hin angestellte Versuche und sagt: „dass die negativen (?) Ergebnisse derselben, weil diese nicht den in der Natur obwaltenden
Bedingungen vollkommen Rechnung tragen, nichts zu beweisen vermögen, und dass meine Meinung auf einem Irrtum
beruht, durch diese Versuche einer Lösung der Frage näher gerückt zu sein.“ Leider führt er nicht aus, warum den natürlichen
Bedingungen nicht vollkommen Rechnung getragen worden ist. Ich nahm Schlamm aus Tümpeln, in welchen, nachdem
das Wasser versiegt war, viele Copepoden eingesunken waren, übergoss einen Teil des noch feuchten Schlammes mit Wasser
und beobachtete, „dass schon am folgenden Tage einige Ostracoden und Copepoden in demselben nmherschwammen.“ Die
andere Portion des Schlammes liess ich vollkommen austrocknen: nach dem Wiederbefeuchten erwachte aber kein Tier.
Inwiefern diese Versuche unnatürlich sein sollen, vermag ich nicht einzusehen! Höchstens könnte man einwenden, dass die
Trockenperiode zu kurz gewesen sei. Es ist aber wohl kaum anzunehmen, dass wirklich Copepoden aus dem Schlamme
erstanden wären, wenn derselbe länger trocken gelegen hätte. Dass durch, meine Versuche die Frage ihrer Lösung etwas