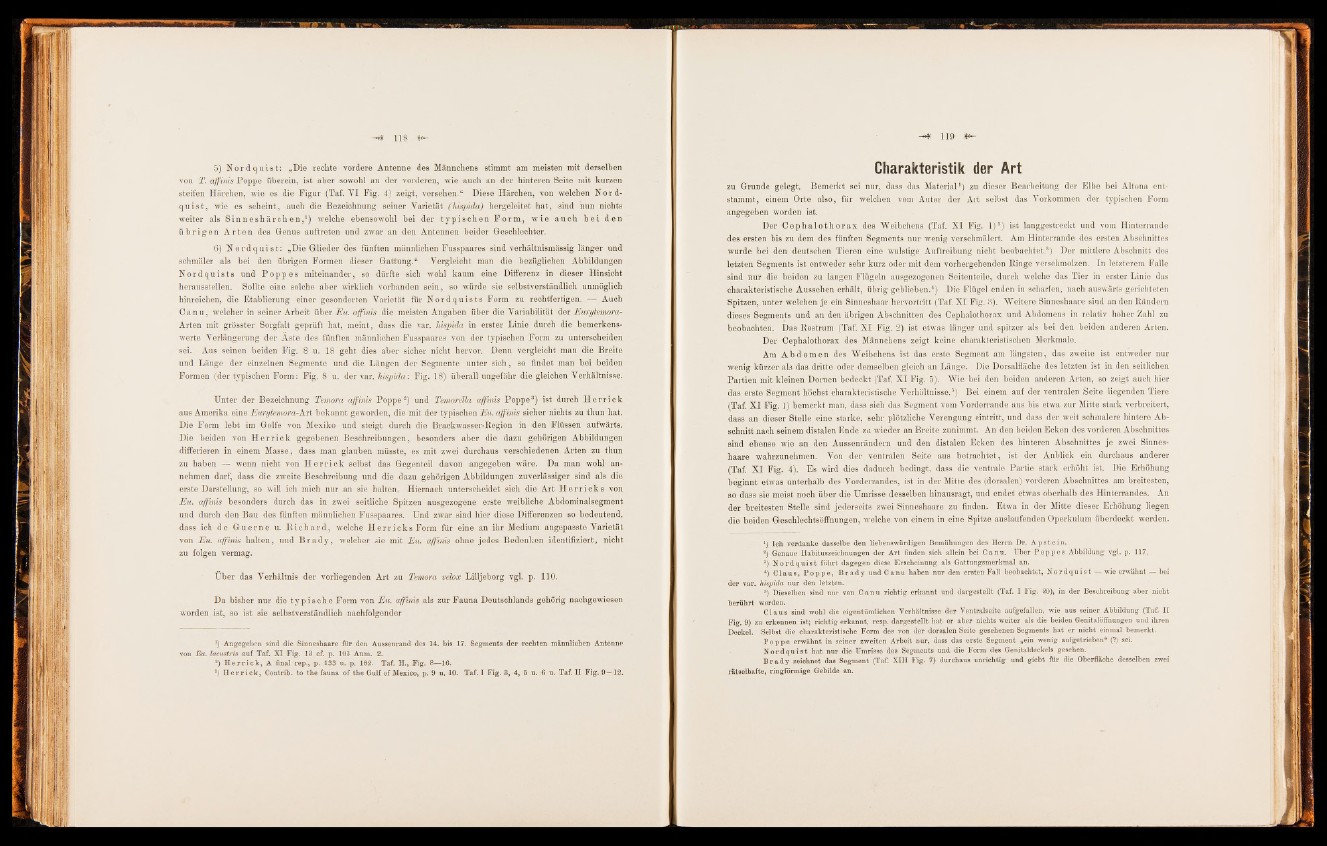
5) N o r d q u i s t : „Die rechte vordere Antenne des Männchens stimmt am meisten mit derselben
von T. affinis Poppe überein, ist aber sowohl an der vorderen, wie auch an der hinteren Seite mit kurzen
steifen Härchen, wie es die Figur (Taf. VI Fig. 4) zeigt, versehen.“ Diese Härchen, von welchen N o rd -
q u i s t , wie es scheint, auch die Bezeichnung seiner Varietät (hispida) hergeleitet hat, sind nun nichts
weiter als S in n e s h ä r c h e n ,1) welche ebensowohl bei der ty p i s c h e n F o rm , w ie a u c h b e i d e n
ü b r ig e n A r t e n des Genus auftreten und zwar an den Antennen beider Geschlechter.
6) N o r d q u i s t : „Die Glieder des fünften männlichen Fusspaares sind verhältnismässig länger und
schmäler als bei den übrigen Formen dieser Gattung.“ Vergleicht man die bezüglichen Abbildungen
N o r d q u i s t s und P o p p e s miteinander, so dürfte sich wohl kaum eine Differenz in dieser Hinsicht
herausstellen. Sollte eine solche aber wirklich vorhanden sein, so würde sie selbstverständlich unmöglich
hinreichen, die Etablierung einer gesonderten Varietät für N o r d q u i s t s Form zu rechtfertigen. — Auch
C a n u , welcher in seiner Arbeit über Eu. affinis die meisten Angaben über die Variabilität der Eurytemora-
Arten mit grösster Sorgfalt geprüft hat, meint, dass die var. hispida in erster Linie durch die bemerkenswerte
Verlängerung der Aste des fünften männlichen Fusspaares von der typischen Form zu unterscheiden
sei. Aus seinen beiden Fig. 8 u. 18 geht dies aber sicher nicht hervor. Denn vergleicht man die Breite
und Länge der einzelnen Segmente und die Längen der Segmente unter sich, so findet man bei beiden
Formen (der typischen Form: Fig. 8 u. der var. hispida: Fig. 18) überall ungefähr die gleichen Verhältnisse.
Unter .der Bezeichnung Temora affinis Poppe2) und Temorella affinis Poppe8) ist durch H e r r i c k
aus Amerika eine Eurytemora-Art bekannt geworden, die mit der typischen Eu. affinis sicher nichts zu thun hat.
Die Form lebt im Golfe von Mexiko und steigt durch die Brackwasser-Region in den Flüssen aufwärts.
Die beiden von H e r r ic k gegebenen Beschreibungen, besonders aber die dazu gehörigen Abbildungen
differieren in einem Masse, dass man glauben müsste, es mit zwei durchaus verschiedenen Arten zu thun
zu haben — wenn nicht von H e r r i c k selbst das Gegenteil davon angegeben wäre. Da man wohl annehmen
darf, dass die zweite Beschreibung und die dazu gehörigen Abbildungen zuverlässiger sind als die
erste Darstellung, so will ich mich nur an sie halten. Hiernach unterscheidet sich die Art H e r r i c k s von
Eu. affinis besonders durch das in zwei seitliche Spitzen ausgezogene erste weibliche Abdominalsegments
und durch den Bau des fünften männlichen Fusspaares. Und zwar sind hier diese Differenzen so bedeutend,
dass ich de G u e rn e u. R i c h a r d , welche H e r r i c k s Form für eine an ihr Medium angepasste Varietät
von Eu. affinis halten, und B r a d y , welcher sie mit Eu. affinis ohne jedes Bedenken identifiziert, nicht
zu folgen vermag.
Uber das Verhältnis der vorliegenden Art zu Temora velox Lilljeborg vgl. p. 110.
Da bisher nur die ty p i s c h e Form von Eu. affinis als zur Fauna Deutschlands gehörig nachgewiesen
worden ist, so ist sie selbstverständlich nachfolgender
1) Angegeben sind die Sinneshaare für den Aussenrand des 14. bis 17. Segments der rechten männlichen Antenne
von Eu. lacustris auf Taf. XI Fig. 13 cf. p. 103 Anm. 2.
2) H e r r ic k , A final rep., p. 133 u.-p, .182. Taf. H., Fig. 8—16.
3) H e r r ic k , Contrib. to the fauna of the Gulf of Mexico, p. 9 u. 10. Taf. I Fig. 3, 4, 5 u. 6 u. Taf. II Fig.,9—12.
Charakteristik der Art
zu Grunde gelegt. Bemerkt sei nur, dass das Material1) zu dieser Bearbeitung der Elbe bei Altona entstammt,
einem Orte also, für welchen vom Autor der Art selbst das Vorkommen der typischen Form
angegeben worden ist.
Der C é p h a lo th o r a x des Weibchens (Taf. XI Fig. I ) 2) ist langgestreckt und vom Hinterrande
des ersten bis zu dem des fünften Segments nur wenig verschmälert. Am Hinterrande des ersten Abschnittes
wurde bei den deutschen Tieren eine wulstige Auftreibung nicht beobachtet.8) Der mittlere Abschnitt des
letzten Segments ist entweder sehr kurz oder mit dem vorhergehenden Ringe verschmolzen. In letzterem Falle
sind nur die beiden zu langen Flügeln ausgezogenen Seitenteile, durch welche das Tier in erster Linie das
charakteristische Aussehen erhält, übrig geblieben.4) Die Flügel enden in scharfen, nach auswärts gerichteten
Spitzen, unter welchen je ein Sinneshaar hervortritt (Taf. XI Fig. 3). Weitere Sinneshaare sind an den Rändern
dieses Segments und an den übrigen Abschnitten des Céphalothorax und Abdomens in relativ hoher Zahl zu
beobachten. Das Rostrum (Taf. XI Fig. 2) ist etwas länger und spitzer als bei den beiden anderen Arten.
Der Céphalothorax des Männchens zeigt keine charakteristischen Merkmale.
Am A b d om e n des Weibchens-ist das erste Segment am längsten, das zweite ist entweder nur
wenig kürzer als das dritte oder demselben gleich an Länge. Die Dorsalfläche des letzten ist in den seitlichen
Partien mit kleinen Dornen bedeckt (Taf. XI Fig. 5). Wie bei den beiden anderen Arten, so zeigt auch hier
das erste Segment höchst charakteristische Verhältnisse.5) Bei einem auf der ventralen Seite liegenden Tiere
(Taf. XI Fig. 1) bemerkt man, dass sich das Segment vom Vorderrande aus bis etwa zur Mitte stark verbreitert,
dass an dieser Stelle eine starke, sehr plötzliche Verengung eintritt, und dass der weit schmalere hintere Abschnitt
nach seinem distalen Ende zu wieder an Breite zunimmt. An den beiden Ecken des vorderen Abschnittes
sind ebenso wie an den Aussenrändern und den distalen Ecken des hinteren Abschnittes je zwei Sinneshaare
wahrzunehmen. Von der ventralen Seite aus betrachtet, ist der Anblick ein durchaus anderer
(Taf. XI Fig. 4). Es wird dies dadurch bedingt, dass die ventrale Partie stark erhöht ist. Die Erhöhung
beginnt etwas unterhalb des Vorderrandes, ist in der Mitte des (dorsalen) vorderen Abschnittes am breitesten,
so dass sie meist noch über die Umrisse desselben hinausragt, und endet etwas oberhalb des Hinterrandes. An
der breitesten Stelle sind jederseits zwei Sinneshaare zu finden. Etwa in der Mitte dieser Erhöhung liegen
die beiden Geschlechtsöffnungen, welche von einem in eine Spitze auslaufenden Operkulum überdeckt werden.
!) Ich verdanke dasselbe den. liebenswürdigen Bemühungen des Herrn Dr. A p s t ein.
2) Genaue Habituszeichnungen der Art finden sich allein bei Canu. Über P o p p e s Abbildung vgl. p. 117.
8) N o rd q u is t führt dagegen diese Erscheinung als Gattungsmerkmal an.
4) Clau s, P o p p e , B ra d y und Canu haben nur den ersten Fall beobachtet, N o r d q u is t— wie erwähnt — bei
der var. hispida nur den letzten.
5) Dieselben sind nur von Canu richtig erkannt und dargestellt (Taf. I Fig. 20), in der Beschreibung aber nicht
berührt wordeü.
Clau s sind wohl die eigentümlichen Yerhältnisse der Ventralseite aufgefallen, wie aus seiner Abbildung (Taf. II
Fig. 9) zu erkennen ist; richtig erkannt, resp. dargestellt hat er aber nichts weiter als die beiden Genitalöffnungen und ihren
Deckel. Selbst die charakteristische Form des von der dorsalen Seite gesehenen Segments hat er nicht einmal bemerkt.
P o p p e erwähnt in seiner zweiten Arbeit nur, dass das erste Segment „ein wenig aufgetrieben“ (?) sei.
N o rd q u is t hat nur die Umrisse des Segments und die Form des Genitaldeckels gesehen.
B ra d y zeichnet das Segment (Taf. XIII Fig. 7) durchaus unrichtig und giebt für die Oberfläche desselben zwei
rätselhafte, ringförmige Gebilde an.