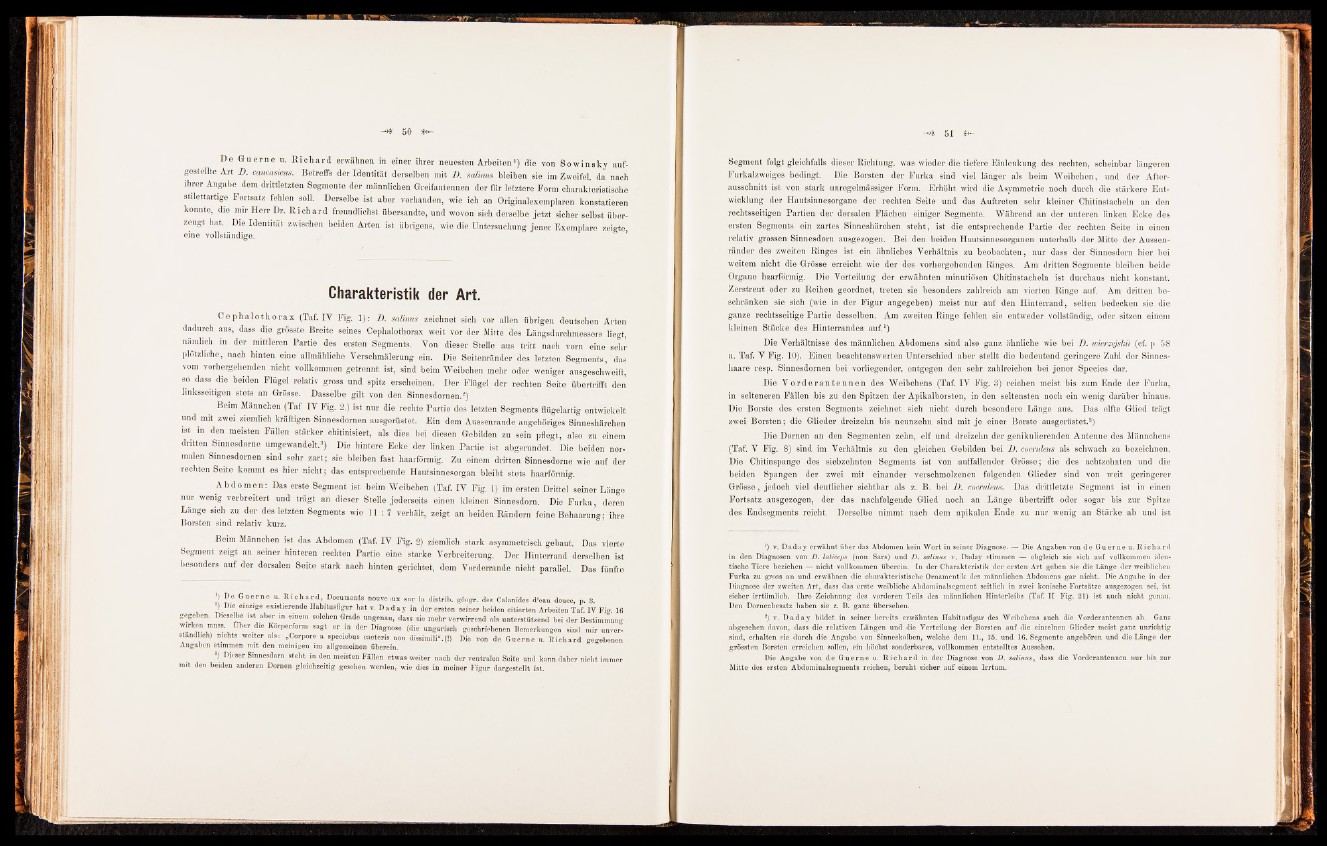
D e G u e r n e u. R ic h a r d erwähnen in einer ihrer neuesten Arbeiten’) die von S ow in s k y aufgestellte
Art S . eaucasieus. Betreifs der Identität derselben mit D. salinus bleiben sie im Zweifel, da nach
ihrer Angabe dem drittletzten Segmente der männlichen Greifantennen der für letztere Form charakteristische
stilettartige Fortsatz fehlen soll. Derselbe ist aber vorhanden, wie ich an Originalexemplaren konstatieren
konnte, die mir Herr Dr. R ic h a rd freundlichst übersandte, und wovon sich derselbe jetzt sicher selbst überzeugt
hat. Die Identität zwischen beiden Arten ist übrigens, wie die Untersuchung jener Exemplare zeigte
eine vollständige.
Charakteristik der Art.
C e p h a lo th o r a x (Taf. IV Fig. 1): D. salinus zeichnet sieh vor allen übrigen deutschen Arten
dadurch aus, dass die grösste Breite seines Cephalothorax weit vor der Mitte des Lärigsdurchmessers liegt,
nämlich in der mittleren Partie des ersten Segments. Von dieser Stelle aus tritt nach vorn eine sehi-
plötzliche, nach hinten eine allmähliche Verschmälerung ein. Die Seitenränder des letzten Segments, ' das
vom vorhergehenden nicht vollkommen getrennt ist, sind beim Weibchen mehr oder weniger ausgeschweift,
so dass die beiden Flügel relativ gross und spitz erscheinen. Der Flügel der rechten Seite übertrifft den
linksseitigen stets an Grösse. Dasselbe gilt von den Sinnesdornen.')
Beim Männchen (Taf IV Fig. 2.) ist nur die rechte Partie des letzten Segments flügelartig entwickelt
und mit zwei ziemlich kräftigen Sinnesdornen ausgerüstet. Ein dem Aussenrande angehöriges Sinneshärchen
ist in den meisten Fällen stärker ohitinisiert, als dies bei diesen Gebilden zu sein pflegt, also zu einem
dritten Sinnesdome umgewandelt.8) Die hintere Ecke der linken Partie ist abgerundet. Die beiden nor-
malen Sinnesdornen sind sehr zart; sie bleiben fast haarförmig. Zn einem dritten Sinnesdorne wie auf der
rechten Seite kommt es hier nicht; das entsprechende Hautsinnesorgan bleibt stets haarförmig.
A b d om e n : Das erste Segment ist beim Weibchen (Taf. IV Fig. 1) im ersten Drittel seiner Länge
nur wenig verbreitert und trägt an dieser Stelle jederseits einen kleinen Sinnesdorn. Die Furlca, deren
Länge sich zu der des letzten Segments wie 1 1 :7 verhält, zeigt an beiden Rändern feine Behaarung; ihre
Borsten sind relativ kurz.
Beim Männchen ist das Abdomen (Taf. IV Fig. 2) ziemlich stark asymmetrisch gebaut. Das vierte
Segment zeigt an seiner hinteren rechten Partie eine starke Verbreiterung. Der Hinterrand derselben ist
besonders auf der dorsalen Seite stark nach hinten gerichtet, dem Vorderrande nicht parallel. Das fünfte
■) De G u e rn e u. R ic h a r d , Documents nouve.ux snr la distrib. geogr. des Galanides d’eau dcuce, p. 8.
5 . ÖInzlge existierende Habitusfigur hat v. D ad ay in der ersten seiner beiden eiferten Arbeiten Taf. IV Fig. 16
gegeben. Dieselbe ist aber in einem solchen Grade ungenau, dass sie mehr verwirrend als unterstützend bei der Bestimmung
wirken muss, über die Körperform sagt er in der Diagnose (die ungarisch geschriebenen Bemerkungen sind mir unver- '
standlich) nichts weiter als: , Corpore a speciebus oaeteris non dissimi1i‘f g Die von de Guerne u. Rich ard gegebenen
Angaben stimmen mit den meinijjen im allgemeinen überein.
8) Dieser Sinnesdorn steht in den meisten Fällen etwas weiter nach der ventralen Seite und kann daher nicht immer
mit den beiden anderen Dornen gleichzeitig gesehen werden, wie dies in meiner Figur dargestellt ist.
Segment folgt gleichfalls dieser Richtung, was wieder die tiefere Einlenkung des rechten, scheinbar längeren
Furkalzweiges bedingt. Die Borsten der Furka sind viel länger als beim Weibchen, und der Afterausschnitt
ist von stark unregelmässiger Form. Erhöht wird die Asymmetrie noch durch die stärkere Entwicklung
der Hautsinnesorgane der rechten Seite und das Auftreten sehr kleiner Chitinstacheln an den
rechtsseitigen Partien der dorsalen Flächen einiger Segmente. Während an der unteren linken Ecke des
ersten Segments ein zartes Sinneshärchen steht, ist die entsprechende Partie der rechten Seite in einen
relativ grossen Sinnesdorn ausgezogen. Bei den beiden Hautsinnesorganen unterhalb der Mitte der Aussen-
ränder des zweiten Ringes ist ein ähnliches Verhältnis zu beobachten, nur dass der Sinnesdorn hier bei
weitem nicht die Grösse erreicht wie der des vorhergehenden Ringes. Am dritten Segmente bleiben beide
Organe haarförmig. Die Verteilung der erwähnten minutiösen Chitinstacheln ist durchaus nicht konstant.
Zerstreut oder zu Reihen geordnet, treten sie besonders zahlreich am vierten Ringe auf. Am dritten beschränken
sie sich (wie in der Figur angegeben) meist nur auf den Hinterrand, selten bedecken sie die
ganze rechtsseitige Partie desselben. Am zweiten Ringe fehlen sie entweder vollständig, oder sitzen einem
kleinen Stücke des Hinterrandes auf.1)
Die Verhältnisse des männlichen Abdomens sind also ganz ähnliche wie bei D. wierzejslcii (cf. p 58
u. Taf. V Fig. 10). Einen beachtenswerten Unterschied aber stellt die bedeutend geringere Zahl der Sinneshaare
resp. Sinnesdornen bei vorliegender, entgegen den sehr zahlreichen bei jener Species dar.
Die V o r d e r a n t e n n e n des Weibchens (Taf. IV Fig. 3) reichen meist bis zum Ende der Furka,
in selteneren Fällen bis zu den Spitzen der Apikalborsten, in den seltensten noch ein wenig darüber hinaus.
Die Borste des ersten Segments zeichnet sich nicht durch besondere Länge aus. Das elfte Glied trägt
zwei Borsten; die Glieder dreizehn bis neunzehn sind mit je einer Borste ausgerüstet.2)
Die Dornen an den Segmenten zehn, elf und dreizehn der genikulierenden Antenne des Männchens
(Taf. V Fig. 8) sind im Verhältnis zu den gleichen Gebilden bei D. coemleus als schwach zu bezeichnen.
Die Chitinspange des siebzehnten Segments ist von auffallender Grösse; die des achtzehnten und die
beiden Spangen der zwei mit einander verschmolzenen folgenden Glieder sind von weit geringerer
Grösse, jedoch viel deutlicher sichtbar als z. B. bei D. coeruletis. Das drittletzte Segment ist in einen
Fortsatz ausgezogen, der das nachfolgende Glied noch an Länge übertrifft oder sogar bis zur Spitze
des Endsegments reicht. Derselbe nimmt nach dem apikalen Ende zu nur wenig an Stärke ab und ist
*) v. Daday erwähnt über das Abdomen kein Wort in seiner Diagnose. — Die Angaben von de Guerne u. R ic h a rd
in den Diagnosen von D. laticeps (non Sars) und D. salinus v. Daday stimmen — obgleich sie sich auf vollkommen identische
Tiere beziehen — nicht vollkommen überein. In der Charakteristik der ersten Art geben sie die Länge der weiblichen
Furka zu gross an und erwähnen die charakteristische Ornamentik des männlichen Abdomens gar nicht. Die Angabe in der
Diagnose der zweiten Art, dass das erste weibliche Abdominalsegment seitlich in zwei konische Fortsätze ausgezogen sei, ist
sicher irrtümlich. Ihre Zeichnung des vorderen Teils des männlichen Hinterleibs (Taf. II Fig. 21) ist auch nicht genau.
Den Dornenhesatz haben sie z. B. ganz übersehen.
2) v. D ad ay bildet in seiner bereits erwähnten Habitusfigur des Weibchens auch die Vorderantennen ab. Ganz
abgesehen davon, dass die relativen Längen und die Verteilung der Borsten auf die einzelnen Glieder meist ganz unrichtig
sind, erhalten sie durch die Angabe von Sinneskolhen, welche dem 11., 15. und 16. Segmente angehören und die Länge der
grössten Borsten erreichen sollen, ein höchst sonderbares, vollkommen entstelltes Aussehen.
Die Angabe von de Guerne u. R ic h a rd in der Diagnose von D. salinus, dass die Vorderantennen nur bis zur
Mitte des ersten Abdominalsegments reichen, beruht sicher auf einem Irrtum.