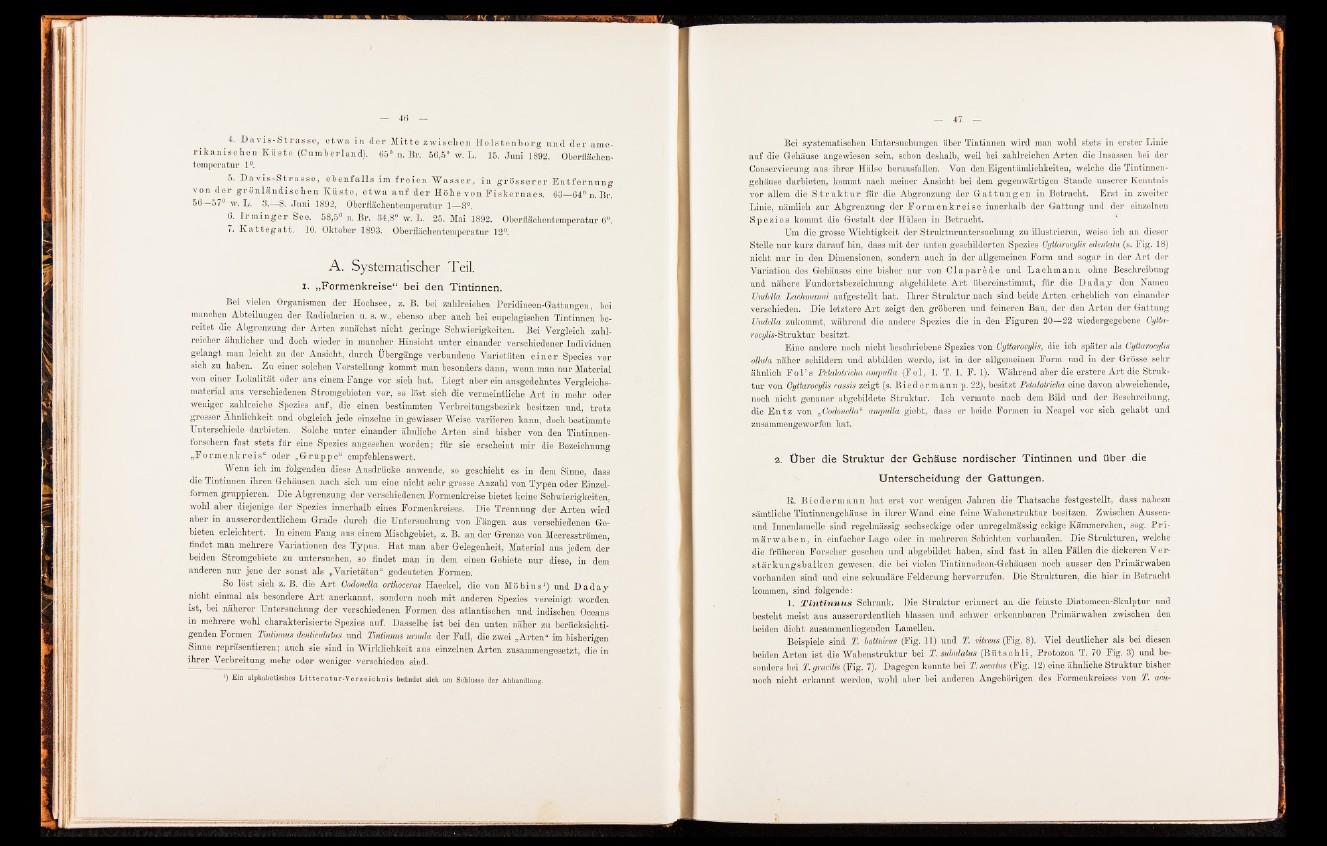
4. D a v i s - S t r a s ä e , e tw a i n d e r M i t t e z w i s c h e n H o l s t e n b o r g u n d d e r am e r
i k a n i s c h e n K ü s t e (C um b e rla n d ). 65» n. Br. 56,5“ w. L. 15. Juni 1892. Oberflächen-
temperatur 1°.
5. D a v i s - S t r a s s e , e b e n f a l l s im f r e i e n W a s s e r , i n g r ö s s e r e r E n t f e r n u n g
v o n d e r g r ö n l ä n d i s c h e n K ü s t e , e tw a a u f d e r H ö h e v o n F i s k e r n a e s . 63—64° n. Br.
56 57° w. L. 3^.:—8. Ju n i 1892, Oberflächentemperatur 1—3°.
6. I rm i n g e r See. 58,5° n. Br. 34,8° w. L. 25. Mai 1892. Oberflächentemperatur 6°.
7. K a t t e g a t t . 10. Oktober 1893. Oberflächentemperatur 12°.
A. Systematischer Teil.
i. „Fo rmenkreise“ bei den Tintinnen.
Bei vielen Organismen der Hochsee, z. B. bei zahlreichen Peridineen-Gattungen, bei
manchen Abteilungen der- Radiolarien u. s. w.,: ebenso aber auch bei enpelagischen Tintinnen bö;
re ite t die Abgrenzung der A rten zunächst nicht geringe Schwierigkeiten. Bei Vergleich zahlreicher
ähnlicher und doch wieder in mancher Hinsicht unter einander verschiedener Individuen
gelangt man leicht zu der Ansicht, durch Übergänge verbundene Varietäten e i n e r Spedes. vor
sieh zu haben. Zu einer solchen Vorstellung kommt man besonders dann, wenn man nur Material
von einer Lokalität oder aus einem Fange vor sich hat. Liegt aber ein ausgedehntes Yergleiohs-
material ans verschiedenen Stromgebieten vor, so löst sich die vermeintliche A r t in mehr oder
weniger ^zahlreiche Spezies anf, die einen bestimmten Verbreitungsbezirk besitzen und, trotz
grösser Ähnlichkeit und obgleich jede einzelne in gewisser Weise variieren kann, -ddch bestimmte
.Unterschiede darbieten. Solche u n te r einander ähnliche Arten sind bisher von den Tintinnen-
forschem fa st stets fü r eine Spezies angesehen worden ; für sie erscheint mir die'Bezeichnung
„ F o rm e n k r e i s “ oder „ G r u p p e “ empfehlenswert.
Wenn ich im folgenden diese Ausdrücke anwende, so geschieht es i n derit -Sinne, dass
die Tintinnen ihren Gehäusen nach sieh um eine nicht sehr g rosse Anzahl von Typen oder Kinzel-
formen gruppieren. Die Abgrenzung der verschiedenen Eormenkreise bietet keine Schwierigkeiten,
wohl aber diejenige cfaf Spezies innerhalb eines Formenkreises. Die Trennung der Arten wird
■aber in ausserordentlichem Grade durch die Untersuchung von Fängen aus verschiedenen Gebieten
erleichtert. In einem Fang aus. einem Mischgebiet,, z. B. an der Grenze von Meeresströmen,
findet man mehrere Variationen des Typus. H a t man aber Gelegenheit, Material aus jedem der
beiden- Stromgebiete zu untersuchen, so findet man in dem einen Gebiete n u r diese, in dem
anderen n u r jene der,sonst als „Varietäten“ gedeuteten Formen.
So löst sich z. B. die A r t Gödonetta orthoceras Haeekel, die von M ö b iu s ') und D a d a y
nicht einmal als besondere A r t anerkannt, sondern noch mit anderen Spezies vereinigt worden
ist, bei näherer Untersuchung der verschiedenen Formen des atlantischen und indischen Oceans
in mehrere wohl charakterisierte Spezies auf. Dasselbe is t bei den unten näher zu berücksichtigenden
Formen Tinünnus dmUculatus und Tinhirmm urnula der Fall, die zwei „Arten" im bisherigen
Sinne repräsentieren; auch sie sind in Wirklichkeit ans einzelnen Arten zusammengesetzt, die in
ih re r Verbreitung mehr oder weniger verschieden sind.
0 alphabetisches L itte ra tu r-V e rz e ich n is befindet sich am Schlüsse der Abhandlang.
Bei systematischen Untersuchungen über Tintinnen wird man wohl stets in erster Linie
auf die Gehäuse angewiesen sein, schon deshalb, weil bei zahlreichen Arten die Insassen bei der
Conservierung aus ih re r Hülse herausfallen. Von den. Eigentümlichkeiten, welche, die Tintinnen-
gehäuse darbieten, kommt nach meiner Ansicht bei dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnis
vor allem die S t r u k t u r für die Abgrenzung der G a t t u n g e n in Betracht. E r s t in zweiter
Linie, nämlich zur Abgrenzung der F o rm e n k r e i s e innerhalb der Gattung und der einzelnen
S p e z i e s kommt die Gestalt der Hülsen in Betracht.
Um die grosse Wichtigkeit der Strukturuntersuchung zu illustrieren, weise ich an dieser
Stelle nur kurz darauf hin, dass mit der unten geschilderten Spezies Cyttarocylis edentata (s. Fig. 18)
nicht n u r in den Dimensionen, sondern auch in der allgemeinen Form und sogar in der A r t der
Variation des Gehäuses eine bisher nur von C la p a r& d e und L a c hm a n n , ohne Beschreibung
und nähere Fundortsbezeichnung abgebildete A r t übereinstimmt, für die D a d a y den Namen
TJnääla Lachnianni aufgestellt hat. Ih r e r S tru k tu r nach sind beide Arten erheblich von einander
verschieden. Die letztere A rt zeigt den gröberen und feineren Bau, der den Arten der Gattung
Undella zukommt, während die andere Spezies die in den Figuren 20—22 wiedergegebene Cytta-
roc«/Zis-Struktur besitzt.
Eine andere noch nicht beschriebene Spezies von Cyttarocylis, die ich später als Cyttarocylis
ollula näher schildern und abbilden werde, is t in der allgemeinen Form und in der Grösse sehr
ähnlich F o l ’ s JPetalotricha ampidla (F o l, *L T. 1. F. 1). Während aber die erstere A rt die Struktu
r von Cyttarocylis cassis zeigt (s. B i e d e rm a n n p. 22), besitzt Petalotricha eine davon abweichende,
noch nicht genauer abgebildete Struktur. Ich vermute nach dem Bild und der Beschreibung,
die E n t z von „Codonella“ apiputta giebt, dass er beide Formen in Neapel vor sich gehabt und
zusammengeworfen hat.
2. Üb e r die Struktur de r Gehäuse nordischer T intinnen und ü b e r die
Unterscheidung der Gattungen.
R. B i e d e rm a n n h a t e rst vor wenigen Jahren die Thatsache festgestellt, dass nahezu
sämtliche Tintinnengehäuse in ihre r Wand eine feine Wabenstruktur besitzen. Zwischen Aussen-
und Innenlamelle sind regelmässig sechseckige oder unregelmässig eckige Kämmerchen, sog. P r i m
ä rw a b e n , in einfacher Lage oder in mehreren Schichten vorhanden. Die Strukturen, welche
die früheren Forscher gesehen und abgebildet haben, sind fa st in allen Fällen die dickeren V e r s
tä r k u n g s b a lk e n gewesen, die bei vielen Tintinnodeen-Gehäusen noch ausser den Primärwaben
vorhanden sind und eine sekundäre Felderung hervorrufen. Die Strukturen, die hier in Betracht
kommen, sind folgende:
1. T i n t i n n u s Schrank. Die S tru k tu r erinnert an die feinste Diatomeen-Skulptur und
besteht meist aus ausserordentlich blassen und schwer erkennbaren Primärwaben zwischen den
beiden dicht zusammenliegenden Lamellen..
Beispiele sind T. bottnicus (Fig. 11) und T. vitreus (Fig. 8). Viel deutlicher als bei diesen
beiden Arten is t die Wabenstruktur hei T. sübiilatus (B ü t s c h l i , Protozoa T. 70 Fig. 3) und besonders
bei T. gracilis (Fig. 7). Dagegen konnte bei T. secatus (Fig. 12) eine ähnliche S tru k tu r bisher
noch nicht erkannt werden, wohl aber bei anderen Angehörigen des Formenkreises von T. acu