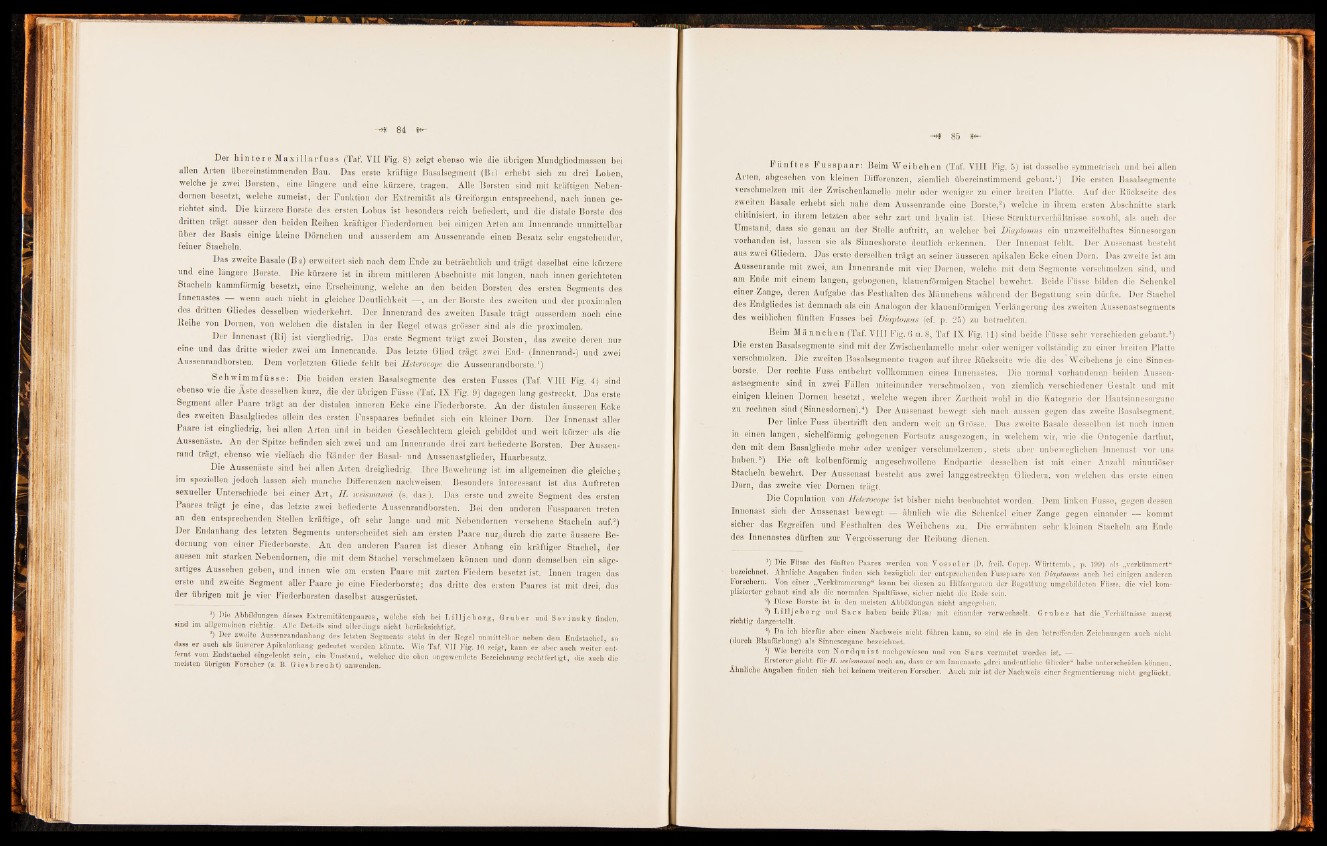
Der h i n t e r e M a x i l l a r f u s s (Taf. VII Fig. 8) zeigt ebenso wie die übrigen Mundgliedmassen bei
allen Arten übereinstimmenden Bau. Das erste kräftige Basalsegment (Bi) erhebt sich zu drei Loben,
welche je zwei Borsten, eine längere und eine kürzere, tragen. Alle Borsten sind mit kräftigen Nebendornen
besetzt, welche zumeist, der Funktion der Extremität als Greiforgan entsprechend, nach innen gerichtet
sind. Die kürzere Borste des ersten Lobus ist besonders reich befiedert, und die distale Borste des
dritten trägt ausser den beiden Reihen kräftiger Fiederdornen bei einigen Arten am Innenrande unmittelbar
über der Basis einige kleine Dörnchen und ausserdem am Aussenrande einen Besatz sehr engstehender,
feiner Stacheln.
Das zweite Basale (B 2) erweitert sich nach dem Ende zu beträchtlich und trägt daselbst eine kürzere
und eine längere Borste. Die kürzere ist in ihrem mittleren Abschnitte mit langen, nach innen gerichteten
Stacheln kammförmig besetzt, eine Erscheinung, welche an den beiden Borsten des ersten Segments des
Innenastes wenn auch nicht in gleicher Deutlichkeit —, an der Borste des zweiten und der proximalen
des dritten Gliedes desselben wiederkehrt. Der Innenrand des zweiten Basale trägt ausserdem noch eine
Reihe von Dornen, von welchen die distalen in der Regel etwas grösser sind als die proximalen.
Der Innenast (Ri) ist viergliedrig. Das erste Segment trägt zwei Borsten, das zweite deren nur
eine und das dritte wieder zwei am Innenrande. Das letzte Glied trägt zwei End- (Innenrand-) und zwei
Aussenrandborsten. Dem vorletzten Gliede fehlt bei Heterocope die Aussenrandborste.1)
S c hw im m fü s s e : Die beiden ersten Basalsegmente des ersten Fusses (Taf. V III Fig. 4) sind
ebenso wie die Äste desselben kurz, die der übrigen Füsse (Taf. IX Fig. 9) dagegen lang gestreckt. Das erste
Segment aller Paare trägt an der distalen inneren Ecke eine Fiederborste. An der distalen äusseren Ecke
des zweiten Basalgliedes allein des ersten Fusspaares befindet sich ein kleiner Dorn. Der Innenast aller
Paare ist eingliedrig, bei allen Arten und in beiden Geschlechtern gleich gebildet und weit kürzer als die
Aussenäste. An der Spitze befinden sich zwei und am Innenrande drei zart befiederte Borsten. Der Aussen-
rand trägt, ebenso wie vielfach die Ränder der Basal- und Aussenastglieder, Haarbesatz.
Die Aussenäste sind bei allen Arten dreigliedrig. Ihre Bewehrung ist im allgemeinen die gleiche;
im speziellen jedoch lassen sich manche Differenzen nachweisen. Besonders interessant ist das Auftreten
sexueller Unterschiede bei einer Art, H. weismanni (s. das.). Das erste und zweite Segment des ersten
Paares trägt je eine, das letzte zwei befiederte Aussenrandborsten. Bei den anderen Fusspaaren treten
an den entsprechenden Stellen kräftige, oft sehr lange und mit Nebendornen versehene Stacheln auf.2)
Der Endanhang des letzten Segments unterscheidet sich am ersten Paare nur^d'urch die zarte äussere Be-
dornung von einer Fiederborste. An den anderen Paaren ist dieser Anhang ein kräftiger Stachel , der
aussen mit starken Nebendornen, die mit dem Stachel verschmelzen können und dann demselben ein sägeartiges
Aussehen geben, und innen wie am ersten Paare mit zarten Fiedern besetzt ist. Innen tragen das
erste und zweite Segment aller Paare je eine Fiederborste; das dritte des ersten Paares ist mit drei, das
der übrigen mit je vier Fiederborsten daselbst ausgerüstet.
’) Die Abbildungen dieses Extremitätenpaares, welche sich bei L i l l j e b o r g , G ru b e r und S o v in sk y finden,
sind im allgemeinen richtig. Alle Details sind allerdings nicht berücksichtigt.
2) Der zweite Aussenrandanhang des letzten Segments steht in der Regel unmittelbar neben dem Endstachel, so
dass er auch als äusserer Apikalanhang gedeutet werden könnte. Wie Taf. VII Fig. 10 zeigt, kann er aber auch weiter entfernt
vom Endstachel eingelenkt sein, ein Umstand, welcher die oben angewendete Bezeichnung rechtfertigt, die auch die
meisten übrigen Forscher (z. B. G ie sb re c h t) anwenden.
F ü n f t e s F u s s p a a r : Beim W e ib c h e n (Taf. VIII Fig. 5) ist dasselbe symmetrisch und bei allen
Arten, abgesehen von kleinen Differenzen, ziemlich übereinstimmend gebaut.1) Die ersten Basalsegmente
verschmelzen mit der Zwischenlamelle mehr oder weniger zu einer breiten Platte. Auf der Rückseite des
zweiten Basale erhebt sich nahe dem Aussenrande eine Borste,2) welche in ihrem ersten Abschnitte stark
chitinisiert, in ihrem letzten aber sehr zart und hyalin ist. Diese Strukturverhältnisse sowohl, als auch der
Umstand, dass sie genau an der Stelle auftritt, an welcher bei Diaptomus ein unzweifelhaftes Sinnesorgan
vorhanden ist, lassen sie als Sinnesborste deutlich erkennen. Der Innenast fehlt. Der Aussenast besteht
aus zwei Gliedern. Das erste derselben trägt an seiner äusseren apikalen Ecke einen Dorn. Das zweite ist am
Aussenrande mit zwei, am Innenrande mit vier Dornen, welche mit dem Segmente verschmolzen sind, und
am Ende mit einem langen, gebogenen, klauenförmigen Stachel bewehrt. Beide Füsse bilden die Schenkel
einer Zange, deren Aufgabe das Festhalten des Männchens während der Begattung sein dürfte. Der Stachel
des Endgliedes ist demnach als ein Analogon der klauenförmigen Verlängerung des zweiten Aussenastsegments
des weiblichen fünften Fusses bei Diaptomus (cf. p. 25) zu betrachten.
Beim M ä n n c h e n (Taf. VIII Fig. 6 u. 8, Taf. IX Fig. 11) sind beide Füsse sehr verschieden gebaut.3)
Die ersten Basalsegmente sind mit der Zwischenlamello mehr oder weniger vollständig zu einer breiten Platte
verschmolzen. Die zweiten Basalsegmente tragen auf ihrer Rückseite wie die des Weibchens je eine Sinnesborste.
Der rechte Fuss entbehrt vollkommen eines Innenastes. Die normal vorhandenen beiden Aussen-
astsegmente sind in zwei Fällen miteinander verschmolzen, von ziemlich verschiedener Gestalt und mit
einigen kleinen Dornen besetzt, welche wegen ihrer Zartheit wohl in die Kategorie der Hautsinnesorgane
zu rechnen sind (Sinnesdornen).4) Der Aussenast bewegt sich nach aussen gegen das zweite Basalsegment.
Der linke Fuss übertrifft den ändern weit an Grösse. Das zweite Basale desselben ist nach innen
in einen langen, sichelförmig gebogenen Fortsatz ausgezogen, in welchem wir, wie die Ontogenie darthut,
den mit dem Basalgliede mehr oder weniger verschmolzenen, stets aber unbeweglichen Innenast vor uns
haben.5) Die oft kolbenförmig angeschwollene Endpartie desselben ist mit einer Anzahl minutiöser
Stacheln bewehrt. Der Aussenast besteht aus zwei langgestreckten Gliedern, von welchen das erste einen
Dorn, das zweite vier Dornen trägt.
Die Copulation von Heterocope ist bisher nicht beobachtet worden. Dem linken Fusse, gegen dessen
Innenast sich der Aussenast bewegt — ähnlich wie die Schenkel einer Zange gegen einander — kommt
sicher das Ergreifen und Festhalten des Weibchens zu. Die erwähnten sehr kleinen Stacheln am Ende
des Innenastes dürften zur Vergrösserung der Reibung dienen.
*) Uie Füsse des fünften Paares werden von V o s s e ie r (D. freil. Gopep. Württemb., p. 199) als „verkümmert“
bezeichnet. Ähnliche Angaben finden sich bezüglich der entsprechenden Fusspaare von Diaptomus auch bei einigen anderen
Forschern. Von einer „Verkümmerung“ kann bei diesen zu Hilfsorganen der Begattung umgebildeten Füsse, die viel komplizierter
gebaut sind als die normalen Spaltfüsse, sicher nicht die Rede sein.
2) Diese Borste ist in den meisten Abbildungen nicht angegeben.
3) L i llj e b o r g und S a r s haben beide Füsso mit einander verwechselt. G ru b e r hat die_.Verhältnisse zuerst
richtig dargestellt.
4) Da ioh hierfür aber einen‘Nachweis nicht führen kann, so sind sie in den betreffenden Zeichnungen auch nicht
(durch Blaufärbung) als Sinnesorgane bezeichnet.
8) Wie bereits von N o rd q u is t nachgewiesen und von S a rs vermutet worden ist. —
Ersterer giebt für H. weismanni noch an, dass er am Innenaste „drei undeutliche Glieder“ habe unterscheiden können.
Ähnliche Angaben finden sich bei keinem weiteren Forscher. Auch mir ist der Nachweis einer Segmentierung nicht geglückt.