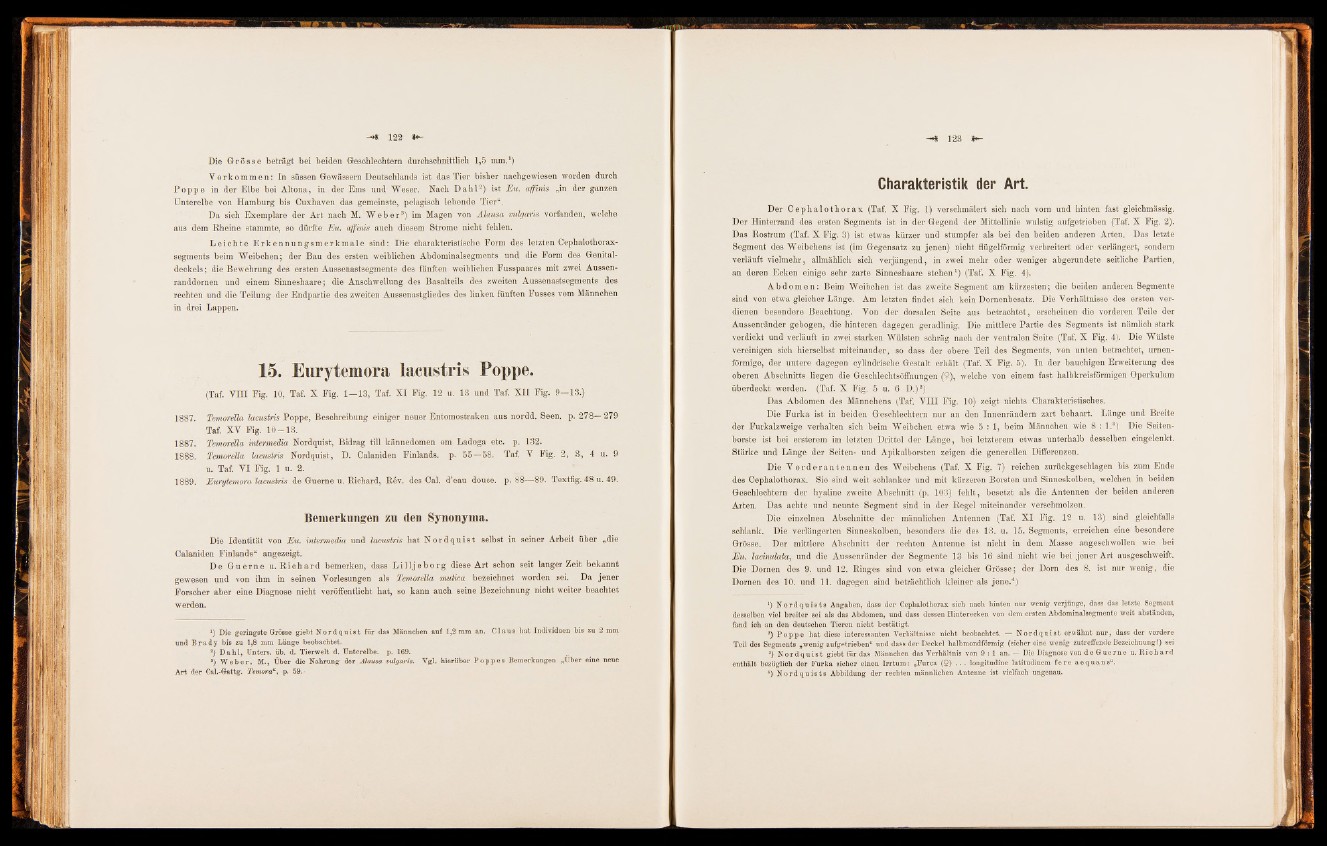
Die G rö s s e beträgt bei beiden Geschlechtern durchschnittlich 1,5 mm.1)
Y o rk om m e n : In süssen Gewässern Deutschlands ist das Tier bisher nachgewiesen worden durch
P o p p e in der Elbe bei Altona, in der Ems und Weser. Nach D a h l3) ist Eu. affinis „in der ganzen
Unterelbe von Hamburg bis Cuxhaven das gemeinste, pelagisch lebende Tier“.
Da sich Exemplare der Art nach M. W e b e r 8) im Magen von Alausa vulgaris vorfanden, welche
aus dem Rheine stammte, so dürfte Eu. affinis auch diesem Strome nicht fehlen.
L e i c h t e E r k e n n u n g sm e r k m a l e sind: Die charakteristische Form des letzten Cephalothorax-
segments beim Weibchen; der Bau des ersten weiblichen Abdominalsegments und die Form des Genitaldeckels;
die Bewehrung des ersten Aussenastsegments des fünften weiblichen Fusspaares mit zwei Aussen-
randdornen und einem Sinneshaare; die Anschwellung des Basalteils des zweiten Aussenastsegments des
rechten und die Teilung der Endpartie des zweiten Aussenastgliedes des linken fünften Fusses vom Männchen
in drei Lappen.
15. Eurytemora lacustris Poppe.
(Taf. YIH Fig. 10, Taf. X Fig. 1—13, Taf. XI Fig. 12 u. 13 und Taf. XII Fig. 9—13.)
1887. Temorella lacustris Poppe, Beschreibung einiger neuer Entomostraken aus nordd. Seen. p. 278—279
Taf. XY Fig. 1 0 -1 3 .
1887. Temorella intermedia Nordquist, Bidrag tili kännedomen om Ladoga etc. p. 132.
1888. Temorella lacustris Nordquist, D. Calaniden Finlands. p. 55—58. Taf. Y Fig. 2, 3, 4 u. 9
u. Taf. YI Fig. 1 u. 2.
1889. Eurytemora lacustris de Gueme u. Richard, Rev. des Cal. d’eau douce. p. 88—89. Textfig. 48 u. 49.
Bemerkungen zu den Synonyma.
Die Identität von Eu. intermedia und lacustris hat N o r d q u i s t selbst in seiner Arbeit über „die
Calaniden Finlands“ angezeigt.
De G u e rn e u. R i c h a r d bemerken, dass L i l l j e b o r g diese Art schon seit langer Zeit bekannt
gewesen und von ihm in seinen Vorlesungen als Temorella mutica bezeichnet worden sei. Da jener
Forscher aber eine Diagnose nicht veröffentlicht hat, so kann auch seine Bezeichnung nicht weiter beachtet
werden.
*) Die geringste Grösse giebt N o rd q u is t für das Männchen auf 1,2 mm an. Clau s hat Individuen bis zu 2 mm
und B ra d y bis zu 1,8 mm Länge beobachtet.
2) D ah l, Unters, üb. d. Tierwelt d. Unterelbe. p. 169.
3) W e b e r, M., Über die Nahrung der Alausa vulgaris. Vgl. hierüber Po pp es Bemerkungen „Über eine neue
Art der Cal.-Gattg. Temorau, p. 59.-
Charakteristik der Art.
Der C e p h a lo th o r a x (Taf. X Fig. 1) verschmälert sich nach vorn und hinten fast gleichmässig.
Der Hinterrand des ersten Segments ist in der Gegend der Mittellinie wulstig aufgetrieben (Taf. X Fig. 2).
Das Rostrum (Taf. X Fig. 3) ist etwas kürzer und stumpfer als bei den beiden anderen Arten. Das letzte
Segment des Weibchens ist (im Gegensatz zu jenen) nicht flügelförmig verbreitert oder verlängert, sondern
verläuft vielmehr, allmählich sich verjüngend, in zwei mehr oder weniger abgerundete seitliche Partien,
an deren Ecken einige sehr zarte Sinneshaare stehen1) (Taf. X Fig. 4).
A b d om e n : Beim Weibchen ist das zweite Segment am kürzesten; die beiden anderen Segmente
sind von etwa gleicher Länge. Am letzten findet sich kein Dornenbesatz. Die Yerhältnisse des ersten verdienen
besondere Beachtung. Yon der dorsalen Seite aus betrachtet, erscheinen die vorderen Teile der
Aussenränder gebogen, die hinteren dagegen geradlinig. Die mittlere Partie des Segments ist nämlich stark
verdickt und verläuft in zwei starken Wülsten schräg nach der ventralen Seite (Taf. X Fig. 4). Die Wülste
vereinigen sich hierselbst miteinander, so dass der obere Teil des Segments, von unten betrachtet, urnenförmige,
der untere dagegen cylindrische Gestalt erhält (Taf. X Fig. 5). In der bauchigen Erweiterung des
oberen Abschnitts liegen die Geschlechtsöffnungen (9), welche von einem fast halbkreisförmigen Operkulum
überdeckt werden. (Taf. X Fig. 5 u. 6 D.)3)
Das Abdomen des Männchens (Taf. VIII Fig. 10) zeigt nichts Charakteristisches.
Die Furka ist in beiden Geschlechtern nur an den Innenrändern zart behaart. Länge und Breite
der Furkalzweige verhalten sich beim Weibchen etwa wie 5 : 1 , beim Männchen wie 8 : l .8) Die Seitenborste
ist bei ersterem im letzten Drittel der Länge, bei letzterem etwas unterhalb desselben eingelenkt.
Stärke und Länge der Seiten- und Apikalborsten zeigen die generellen Differenzen.
Die Y o r d e r a n t e n n e n des Weibchens (Taf. X Fig. 7) reichen zurückgeschlagen bis zum Ende
des Cephalothorax. Sie sind weit schlanker und mit kürzeren Borsten und Sinneskolben, welchen in beiden
Geschlechtern der hyaline zweite Abschnitt (p. 103) fehlt, besetzt als die Antennen der beiden anderen
Arten. Das achte und neunte Segment sind in der Regel miteinander verschmolzen.
Die einzelnen Abschnitte der männlichen Antennen (Taf. XI Fig. 12 u. 13) sind gleichfalls
schlank. Die verlängerten Sinneskolben, besonders die des 13. u. 15. Segments, erreichen eine besondere
Grösse. Der mittlere Abschnitt der rechten Antenne ist nicht in dem Masse angeschwollen wie bei
Eu. lacinulata, und die Aussenränder der Segmente 13 bis 16 sind nicht wie bei jener Art ausgeschweift.
Die Dornen des 9. und 12. Ringes sind von etwa gleicher Grösse; der Dorn des 8. ist nur wenig, die
Dornen des 10. und 11. dagegen sind beträchtlich kleiner als jene.4)
f) N o .rd q u is ts Angaben, dass der Cephalothorax sich nach hinten nur wenig verjünge, dass das letzte Segment
desselben viel breiter sei als das Abdomen, und dass dessen Hinterecken von dem ersten Abdominalsegmente weit abständen,
fand ich an den deutschen Tieren nicht bestätigt.
2) P o p p e hat diese interessanten Verhältnisse nicht beobachtet. — N o rd q u is t erwähnt nur, dass der vordere
Teil des Segments „wenig aufgetrieben“ und dass der Deckel halbmondförmig (sicher eine wenig zutreffende Bezeichnung!) sei
8) N o r d q u is t giebt für das Männchen das Verhältnis von 9 : 1 an. — Die Diagnose von de G u e rn e u. R ic h a rd
enthält bezüglich der Furka sicher einen Irrtum: „Furca (9) • • • longitudine latitudinem fe re a e q u a n s “.
4) N o rd q u is ts Abbildung der rechten männlichen Antenne ist vielfach ungenau.